- Brunngasse / Rue des Fontaines
- Burgplatz / Place du Bourg
- Burggasse / Rue du Bourg
- Jakob-Rosius-Strasse / Rue Jakob-Rosius
- Kanalgasse / Rue du Canal
- Kirchgässli / Ruelle de l'Eglise
- Obergasse / Rue Haute
- Obergässli / Ruelle du Haut
- Quellgasse / Rue de la Source
- Ring
- Römergässli / Rue des Romains
- Schmiedengasse / Rue des Maréchaux
- Untergasse / Rue Basse
- Untergässli / Ruelle du Bas
- Juravorstadt / Faubourg du Jura
- Mühlebrücke / Pont du Moulin
- General Dufour-Strasse / Rue du Général-Dufour
- Das Dufour Schulhaus - Überblick
- Das Dufour Schulhaus - Kloster und Spital
- Das Dufour Schulhaus 1818-1819
- Das Dufour Schulhaus - Abram-Emmanuel und Edouard Tièche
- Das Dufour Schulhaus 1818 - Louis Agassiz
- Das Dufour Schulhaus 1818 - Oberst Friedrich Schwab
- Das Dufour Schulhaus 1820-1827
- Das Dufour Schulhaus 1828-1835
- Das Dufour Schulhaus - Lehrer in geheimer Mission
- Das Dufour Schulhaus 1836-1838
- Das Dufour Schulhaus 1837 Jean Joseph Hisely
- Das Dufour Schulhaus 1839-1842
- Das Dufour Schulhaus 1843-1849
- Das Dufour Schulhaus 1845 Albert Friedrich Haller
- Das Dufour Schulhaus Kinder der Fabrik
- Das Dufour Schulhaus 1850-1869
- Das Dufour Schulhaus - Armin und Arnold Mueller
- Das Dufour Schulhaus 1870-1880
- Das Dufour Schulhaus 1881-1887
- Das Dufour Schulhaus - Die Buchdruckerfamilie Gassmann
- Das Dufour Schulhaus 1885 - Hermann Aegler
- Das Dufour Schulhaus - Die Bieler Bijouteriefamilie Weber
- Das Dufour Schulhaus 1887 - Karl Walser
- Das Dufour Schulhaus 1888 Robert Walser I
- Das Dufour Schulhaus 1888 Robert Walser II
- Das Dufour Schulhaus 1888-1891
- Das Dufour Schulhaus 1891 Grock
- Das Dufour Schulhaus 1892 - Gottlieb Hauser
- Das Dufour Schulhaus 1892-1895
- Das Dufour Schulhaus 1896-1898
- Das Dufour Schulhaus 1893 - Eduard Amsler
- Das Dufour Schulhaus 1896 - Hermann Hubacher
- Das Dufour Schulhaus 1897 - Emil Meyer
- Das Dufour Schulhaus - Die Familie Lanz
- Das Dufour Schulhaus 1897 - Fritz Antenen
- Das Dufour Schulhaus 1899-1903
- Das Dufour Schulhaus 1904-1905
- Das Dufour Schulhaus 1902 Werner Bourquin
- Das Dufour Schulhaus 1902 - MAURICE UND ANDRÉ VAUCHER
- Das Dufour Schulhaus 1903 - Hans Zulliger
- Das Dufour Schulhaus 1903 - Hans Zulliger II
- Das Dufour Schulhaus 1905 - Karl Schoechlin
- Das Dufour Schulhaus 1906-1908
- Das Dufour Schulhaus 1908 - Hans Schoechlin
- Das Dufour Schulhaus 1909-1910
- Das Dufour Schulhaus 1951-2011
Das Dufour-Schulhaus / L' école Dufour 1884

Wilhelm und Charles Gassmann
Die in Biel geborenen Brüder Wilhelm und Charles Gassmann, Schüler vom Dufourschulhaus Biel, gehörten zur 5. Generation einer Familie, die ununterbrochen im Buchdruck- und Verlagsgeschäft tätig war. Ein Rückblick:

Bereits 1407 wurde Berchthold Gassmann aus Wollerau Bürger von Zürich. Im folgten 1422 Heiri, Hans, Rudi und Uli Gassmann nach. Nachdem sie sich in Zürich
niedergelassen hatten, verpflanzte sich das Geschlecht in andere Kantone. Der aus Eich im Kanton Luzern stammende Müller Fridolin Gassmann (gest. 1653) heiratete 1619 BERTHA FLURI von Solothurn
und wurde 1629 in das Burgerrecht der Stadt Solothurn aufgenommen.[12] Das Gassmann-Geschlecht übte in Solothurn die verschiedensten Berufe aus, darunter
Apotheker, Verwalter städtischer Fonds und Priester. Pater Carli Gassmann war Konventual in St. Urban und Karl Fidel Gassmann Sekretär der Stadtkanzlei.
Gassmann-Wappen
Das 1939 von Paul Boesch gezeichnete Wappen des Buchdruckerfamilie Gassmann zeigt in Rot auf einem grünen Dreiberg drei grüne Eichenzweige mit je einer goldenen Frucht und zwei grünen Blättern,
dann den Helm. Darüber befindet sich ein grüner Eichenzweig mit goldener Frucht und vier grünen Blättern als Helmzierde. Zwei aufgerichtete Greifen dienen als Schildhalter. Unten rechts ist der
Druck mit «Paul Boesch» signiert.[40]
1. GENERATION - Franz Joseph Gassmann I (1755-1802)
ab 1788 Herausgeber der ersten Zeitung des Kantons Solothurn
Franz Joseph Gassmann I, genannt Hubridas, sitzt in der Verenaschlucht bei Solothurn. Aquarellierte Federzeichnung von Laurent Midart, 1794.
Franz Joseph Gassmann I, ein Nachkomme von Fridolin Gassmann, wurde am 21. Februar 1755 in Solothurn als zweitältester Sohn des Schuhmachers Johann Viktor Gassmann (1725-1795) und der tief religiösen Maria Anna Burki (1722-1792) geboren. Der Bruder seines Vaters hiess Urs Franz Josef Gassmann (1719-1795) und war Pfarrer in Oberkirch. Das Geburtshaus von F. J. G. I befand sich an der «Hinteren Gasse». Dort wuchs er mit fünf Geschwistern, von denen drei in jungen Jahren starben, in kleinbürgerlichen Verhältnissen auf.[36] Das Haus stürzte 1775 ein.[42]
Ausbildung bei den Jesuiten
Seine Eltern schickten F. J. G. I ins Jesuitenkollegium der Stadt, damit er sich später zum Geistlichen ausbilden lassen konnte. Dort wirkte Pater Joseph Ignaz Zimmermann (1737–1797), der
die Poesie liebte und eine Reihe von schweizerischen Dramen dichtete, darunter auch Wilhelm Tell (Basel 1777). Auf seine Anregung hin wurde 1769 erstmals unter den üblichen Schulprämien
ein Preis für deutsche Dichtung und 1772 für deutschen Prosastil ausgesetzt. Zu den ersten Schülern Zimmermanns, die sich einen Preis in deutscher Sprache errangen, gehörte Gassmann. Der spätere
Solothurner Ratsherr und Schriftsteller Urs Joseph Lüthy (1765-1837) wurde von Gassmann in die Welt der deutschen Poesie eingeführt, die er mit Begeisterung las. 1774 wurde Pater Zimmermann
Professor der Rhetorik in Luzern und nahm seinen Schüler gleich mit.[5] J. G.
I, der davon träumte Schauspieler oder Dramaturg zu werden, spielte dort im Lustspiel Der Wohltätige Murrkopf und im Singspiel Die kleine Aehrenleserinn, die von den
Hochobrigkeitlichen Schulen Luzerns im Brachmonat 1778 aufgeführt wurden. Die Bühne befand sich auf einem abgeernteten Kornfeld.[7]
Auf Empfehlung von Zimmermann erhielt F. J. G. I eine Stelle als Hauslehrer beim Staatsschreiber und HistorikerJoseph Anton Felix von Balthasar (1737–1810). In
dessen Umfeld entfremdete sich Gassmann dem Studium der Theologie. Möglicherweise trugen auch die Anfeindungen, denen seine Lieblingslehrer Zimmermann und der Dichter Pater F. Grauer durch den
herrschenden Klerus ausgesetzt waren, dazu bei. Auf Anraten von Zimmermann erlernte er in Luzern beim Stadtbuchdrucker Jost Franz Jakob Wyssing die Buchdruckerkunst und kehrte dann nach Solothurn
zurück. Damit wurde er zum Begründer der Buchdruckerdynastie Gassmann. F. J. G. I fand: «Solothurn war schon immer der Lieblingsort französischer Dichter. Auch jetzt besitzen wir wiederum den
grössten Dichter Frankreichs. Es ist Abbé Jacques Delille (1783-1813), der Sänger der Gärten. Zu den fröhlichsten Augenblicken meines Lebens zähle ich die Viertelstunde, die mir ein Gespräch mit
diesem berühmten Mann ermöglichte.»[8] Gassmanns Worte inspirierten Professor MARTIN GISI 1898 zu seiner historisch-literarischen Untersuchung
Französische Schriftsteller in und von Solothurn.
Die Geschichte des Buchdrucks in Solothurn begann mit dem aus Bern stammenden Buchdrucker Samuel Apiarius, der am 12. November 1565 eine Aufenthaltsbewilligung und eine Druckgenehmigung erhielt.
1566 zog er nach Basel. Das 1646 gegründete Jesuiten-Kollegium benötigte aufgrund seiner zahlreichen Schüler eine Buchdruckerei, die der Solothurner Burger Johann Jakob Bernhart 1658 einrichtete.
Sie ging 1685 an seinen Sohn und 1698 an dessen Witwe. Der verbannte französische Dichter Jean Baptiste Rousseau liess hier 1712 seine Œuvres diverses drucken.
Philipp Jakob Schärer (1711-1779) leitete die 1750 gegründete und vom Kollegiums-Rat beaufsichtigte «Hoch-Obrikeitliche Buchdruckerey Typographia Illustrissimae Reipublicae», in der
Hauptgasse 2 «am Stalden». Gassmann begann in Schärers Buchdruckerei zu arbeiten und erhielt nach dessen Tod am 29.
November 1780 dessen Amt und Titel.[5] Die Konditionen waren wie folgt: «Alles, was zur obrigkeitlichen Buchdruckerei gehört, fällt Gassmann als
lebenslängliches Lehen zu. Die hochobrigkeitliche Buchdruckerei darf keine andere Firmenbezeichnung haben. Sie untersteht der Präventivzensur der Obrigkeit. Alle staatlichen Aufträge sind prompt,
billig und mit dem erforderlichen Anstand auszuführen. Schärers Lehrling, der Solothurner Bürgerssohn Ludwig Vogelsang, muss von Gassmann bis zum Ende der Lehrzeit übernommen werden.»[36]
Die Brüder Gassmann
Am 4. Januar 1781 übernahm F. J. G. I das Inventar der hochobrigkeitlichen Buchdruckerei. Sein erstgeborener Bruder Johann Georg Gassmann (1748-1813), ein Handelsmann aus Solothurn,
leistete die Bürgschaft und zog ebenfalls in das Haus. Dort lebte auch Franz Josephs Lebensgefährtin Maria Jacobea Schmid (1756-1839), die Tochter eines in spanischen Diensten stehenden
Offiziers, die er auf romantische Weise «entführt» hatte.[36] F. J. G. I druckte gemeinsam mit seinem Bruder unter dem Namen «Gebrüder Gassmann»
(Josephum et Georgium Gassmann) in der hochobrikeitlichen Buchdruckerei mehrere Bücher, darunter Verordnung seiner hochfürstlichen Gnaden des hochwürdigsten Bischoffs von Lausanna, betreffend
die Aufhebung etlicher Feyertage, für einen Theil des löblichen und alt-katholischen Cantons Solothurn… (1783) und Anfangsgründe der lateinischen und deutschen Sprachkunst (1785).
Der ständige Streit zwischen den beiden Brüdern führte schliesslich dazu, dass Johann Georg Gassmann 1785 seine Koffer packte und 1790 an der Hermesbühlstrasse 21 ein spätbarockes Wohnhaus
errichtete.
Journalist im Namen der Menschenrechte
Gassmanns Charakter war geprägt von uneigennütziger Liebe zu seinen Mitbürgern und Enthusiasmus für die Menschenrechte. Viele Bürger wussten nicht genau, was Menschenrechte überhaupt bedeuten.
Gassmann formulierte es folgendermassen: «Freiheit, Sicherheit, Eigentum und Gleichheit. Diese vier Rechte liegen in der Natur des Menschen und sind unveräusserlich.»[33] In Olten hielt er einen Vortrag über das Betteln von Kindern in der Schweiz. Bald darauf wurde er Ehrenmitglied der Solothurner Schildwache, was ihn besonders stolz
machte.

Das Solothurnische Wochenblatt
Der Aufschwung des Zeitungswesens begann mit der Vervollkommnung des Postwesens. Charakteristisch für die Schweizer Zeitungen jener Zeit war ihr Inhalt, der sich
hauptsächlich aus ausländischen Nachrichten zusammensetzte. Inländische Themen wurden nur selten behandelt, da die Zensur die Berichterstattung über schweizerische Angelegenheiten verbot. Titel
wie Montägliche Churer-Zeitung, Bernisches Freytagsblättlein, Luzernische Dienstagzeitung usw. hätten vom Inhalt her, genauso gut im Ausland gedruckt werden können. In diese Periode des
Zeitungswesens fällt die Gründung der ersten solothurnischen Zeitung durch F. J. G. I. [43]
Der unternehmungslustige junge Mann begann am 5. Januar 1788 mit der Herausgabe vom Solothurnischen Wochenblatt. Dabei konnte er seine journalistischen Fähigkeiten unter Beweis stellen.
Vor Erscheinen der ersten Ausgabe wurde unter dem Titel Vorläufiger Versuch eine Ankündigung herausgegeben, in der die Leser über die Erscheinungsweise und Einteilung der neu gegründeten
Zeitung informiert wurden. F. J. G. I: «Nie hat Geld oder Ehrgeiz, Furcht oder Schmeichelei den Stoff zu einem Aufsatz bestimmt.» Dennoch waren finanzielle Mittel wichtig, um das Blatt
umzusetzen. Gassmann war anfangs skeptisch: «Nach den vielen Ermunterungen, die wir bezüglich des Wochenblatts erhalten hatten, sollte man glauben, dass die Anzahl der Abonnenten vollständiger
wäre, als sie tatsächlich ist. Statt der erwarteten 150 haben erst 17 Abonnenten Geld einbezahlt. Was mag wohl die Ursache sein?» Auch was den Inhalt des Blattes betraf, kehrte sich Gassmanns
anfängliche Begeisterung in Frustration um: «Schon in unserer ersten Anzeige haben wir um Unterstützung und Beiträge gebeten, aber es hat sich noch keine Menschenseele gemeldet.» [39] Zum Erscheinen der ersten Nummer sagte Gassmann: «Ich befinde mich in der Lage eines schüchternen Schauspielers, der zum ersten Mal eine Bühne betritt. Er kennt den
Geschmack seines Publikums noch nicht, doch er wünscht sich, ihm zu gefallen. Missfällt er, wird er ausgepfiffen. Wenn mich dasselbe Schicksal trifft, werde ich mich mit Vergnügen
zurückziehen.»
Trotz seiner Zweifel konnte sich das Blatt durchsetzen. Seine ehemaligen Schulfreunde vom Solothurner Jesuitenkollegium halfen ihm dabei. Die Leserschaft las
belehrende Abhandlungen, Auszüge aus guten, aber vergessenen Büchern, kurze Erzählungen, Anekdoten und Gedichte und wurde über die Fortschritte in der deutschen Literatur informiert. Kam einer
Leserin oder einem Leser eine Geschichte irgendwie bekannt vor, dann lag das an Gassmanns journalistischem Rezept: «Man nimmt einige Ideen alter und neuer Schriftsteller, knetet die
unterschiedlichen Gedanken durcheinander und macht wöchentlich daraus einen geniessbaren Kuchen.» Aufgrund seines ergreifenden Berichts über einen Eisbruch der Aare am 28. Januar 1789 schenkte
ihm der Rat eine Belohnung von fünf Louis d’or. Im selben Jahr berichtete er über die Feuersbrunst von Solothurn, die sich am 31. August nach Mitternacht ereignete.[43]
Ein freisinniger Lesezirkel
In pädagogischer Hinsicht wollte das Solothurnische Wochenblatt alle sozialen Schichten der Stadt Solothurn zur Verbesserung der Erziehung und Bildung der Jugend aufrufen. Um dieses Ziel
zu erreichen, wandte sich F. J. G. I an die gebildeten Kreise der Stadt. Gassmann: «Gut und Geld kann verloren gehen, aber ein wohlgebildetes Herz bleibt immer.» Inzwischen hatte sein Freund Urs
Joseph Lüthy in Solothurn eine literarische Gesellschaft gegründet. Dieser «Klub der Wochenblätter» traf sich oft auf dem «Hübeli». Man las die Werke der besten deutschen Schriftsteller, dichtete
selbst und übte Kritik, denn seit dem Ausbruch der Französischen Revolution waren viele Menschen mit der aktuellen Politik nicht einverstanden. Sie sprachen Wünsche und Verbesserungen aus, die
man «patriotische Träume» nannte. Gassmann, der älteste der jungen Literaten, notierte sich das Wichtigste, brachte es ins Solothurnische Wochenblatt und wurde zu einem der «Patrioten
von Solothurn».[24]
Gassmann: «In der derzeitigen Verfassung ist der Untertan als Mensch wenig wert. Er wird von der Gesetzgebung und allen Staatsämtern ausgeschlossen. Der Adel hingegen ist als Mensch zu viel, weil
er sich Vorzüge gegenüber den anderen herausnimmt und meistens keine Abgaben zahlt. Es herrschten Vorrechte in den Städten wie in den Kirchen. Die Schweiz hat keine einheitliche Regierungsform.
Einige Kantone sind aristokratisch, einige demokratisch und einige haben Elemente von beidem. Mehrere Kantone bezeichnen ihre Angehörigen als Untertanen. Die unteren Menschenklassen hierüber
aufzuklären gilt als Staatssünde. Nur wenige Auserwählte wissen darüber Bescheid, durften es aber aufgrund der Ketten der Pressefreiheit nicht laut sagen. Darum findet eine Revolution statt.
Vielleicht erleben wir dann mit der Zeit einheitliche Gesetze, Währungen, Gewichte und Masse. Keine inneren Kantonsgrenzsteine werden den Wanderer aufhalten, sondern nur noch das äussere Ende
unseres gemeinsamen Vaterlandes wird seine Grenzen ausmachen.»[33]
F. J. G. I gelang es, für seine Zeitung einen Kreis von aufstrebenden Schriftstellern, Künstlern und politisch Interessierten um sich zu versammeln. Zu ihnen gehörten neben Urs Joseph Lüthi, der
Musikpädagoge *Michael Trauott Pfeiffer (1771-1849), der Arzt *Peter Josef Schwendimann (1753-1809) und Kaplan Josef Schmid. Da Gassmann sehr religiös war und dies in seinen Publikationen zeigte,
wurde er auch «der allerchristlichste Journalist» und «weltlicher Missionar» genannt.[10] Durch das Solothurner Wochenblatt schlossen sich Gassmann weitere
Patrioten an, die eine Revolution im Vaterland wünschten. Zu ihnen gehörten der Altlandvogt Xaver Zeltner (1764-1835) und sein Bruder der Artillerie-Kommandant Peter Josef Zeltner (1765-1830),
der Weinhändler Urs Peter Joseph Cartier (1762-1839), St. Ursenstift-Chorherr Urs Viktor Schwaller von Ammannsegg (1771-1816) und sein Bruder Altlandvogt Karl Josef Schwaller von Ammannsegg
(1760-1838).
*Pseudonym «Urian», **Pseudonym «Dr. Sassifras» (siehe Solothurner Wochenblatt)
Abschied vom Solothuner Wochenblatt
Um Reiseerfahrungen für sein Blatt zu sammeln, begab er sich 1789 nach Leuk und 1793 nach Baden. In der Zwischenzeit besetzte Frankreich das angrenzende Fürstbistum Basel und vereinigte es 1793 als «Département du Mont Terrible» mit Frankreich. Daraufhin bezogen Solothurner Truppen an der Nord- und Westgrenze Stellung. 1794 musste er sich von seinem Solothurner Wochenblatt verabschieden, das kaum noch die Druckkosten deckte. Er verglich sich mit einem Schauspieler auf der Bühne. Mal war ihm Beifall zuteil geworden, ein anderes Mal Hohn, da das schwer zu befriedigende Publikum einmal ernste Kost, dann wieder Possenspiele verlangte. In Solothurn wurde auch dauernd gestritten. So gerieten sich die Kapuziner und Franziskaner in die Haare, ob der heilige Franziskus, als er noch lebte, eine braune Kutte wie die Kapuziner oder eine schwarze wie die Franziskaner trug. Gassmann: «Angenehme und nützliche Unterhaltung bei geschäftslosen Stunden war der Zweck meines Blattes. Nie habe ich mir zum Ziel gesetzt, die Sitten und Meinungen meiner Zeit umzugestalten. Manchmal kann man dem einen oder anderen ein Fünkchen ins Herz legen, das bei günstigen Umständen zur Flamme auflodert. Das ist alles, was eine redliche Journalistenseele tun kann. Was jedem Journalisten das Wasser in die Augen treibt, ist die Tatsache, dass er mitansehen muss, wie seine Abonnenten von Zeit zu Zeit wie Herbstblumen wegwelken. Das ist eine Schmach, die kaum ein Schriftsteller überleben wird, wenn er nicht Frau und Kind hat, die noch seiner Obhut bedürfen.»[32]
Vorkämpfer für Mädchenbildung
F. J. G. I setzte sich im Solothurner Wochenblatt für eine bessere Erziehung und Ausbildung von Mädchen aus dem Mittelstand ein. Sein Mentor Zimmermann hatte in Luzern eine Musterschule
für Mädchen eingerichtet und das Buch Die junge Haushälterin veröffentlicht. Von Gassmann inspiriert drängten weitere Solothurner zur Gründung eines Mädcheninstituts. Gassmann erhielt einen
Brief, in dem es hiess, «Mann scheut keine Kosten, um römische Scherben und griechische Rossnägel als Altertümer auszugraben, aber die Errichtung einer Mädchenschule wird sträflich
vernachlässigt.» Gassmann unterbreitete diesen Brief in seinem Wochenblatt den Stadtburgern und löste damit ein Echo aus. Am 24. März 1790 kam in der Ratsversammlung der Gedanke auf, die
Mädchenausbildung den drei solothurnischen Frauenklöstern anzugliedern. Nur langsam nahm die Idee Gestalt an. Zunächst übergab man den Frauenklöstern hie und da ein armes Kind zur Erziehung und
Verköstigung. Auf privater Basis entstand ein Fonds zur Unterhaltung von fünf bis sechs Mädchen. Gassmann insistierte weiter und schrieb im Solothurner Wochenblatt (29. 7. 1793): «Ich
kann mich nicht enthalten, hier einige patriotische Tränen über die Verwahrlosung der Töchtererziehung zu vergiessen. Schreiben, Lesen und Rechnen gehören schliesslich zu den wichtigsten Punkten
der Mädchenbildung! Gerechter Himmel! Lebt denn keine patriotische Seele in unserem Land, die zum allgemeinen Wohl die Feder ergreift und uns die Nachteile einer vernachlässigten Töchtererziehung
vor Augen führt?» Im Herbst 1793 brannte das Waisenhaus nieder. Beim Wiederaufbau des Hauses dachte man durch den bereits erwähnten Fonds zugleich an die Einrichtung eines Mädcheninstituts. Um
Neujahr 1795 zog die erste kleine Schar armer Mädchen ein. Dafür wurde eine eigene Lehrerin angestellt, die den Titel «Vorsteherin des neuen Töchter-Instituts» trug. Der wissenschaftliche
Unterricht umfasste Religionslehre, Lesen, Schreiben und Rechnen. Der Handarbeitsunterricht erstreckte sich auf Stricken, Häkeln, Nähen und das Anfertigen von Kleidungsstücken. Die Schule
übernahm die Ausführung kleinerer Arbeiten für Privatpersonen.[35]
Die Bibliothek Gassmann
In Solothurn hatte F. J. G. I auch eine Bibliothek gegründet, die 1788 einen Katalog mit 700 Büchern veröffentlichte. Darunter befanden sich Werke von Shakespeare, Bacon, Lessing, Klopstock,
Herder, Racine, Rousseau und Mendelssohn. Der Katalog klagte darüber, dass es angesichts der «allüberschwemmenden Sintflut von Schriften, womit man in dieser schreibsüchtigen Zeit heimgesucht
wird, schwer ist, das Beste herauszufischen». Gassmann war stolz, die Enzyklopädie und die Allgemeine deutsche Bibliothek zu besitzen. Besonders schätzte er Matthias Claudius,
dessen Principes philosophiques, politiques et moraux 1789 in drei Bänden erschien.

Ein sehenswerter Brunnen
Gassmann im Solothurner Wochenblatt (Nr. 24, 1793): «Vor meinem Haus steht ein prächtiger Brunnen. Kein Fremder geht daran vorbei, ohne dieses Monument der Unsterblichkeit zu bewundern.
Doch was ist an ihm so sehenswert? Seine Schale wurde aus zwei einzelnen Felsstücken gehauen. In ihrer Mitte erhebt sich eine Säule, die mit einem Schlangengeflecht im antiken Stil umwunden ist.
Oben darauf sitzt der Ritter Georg zu Pferd. Er durchbohrt mit seiner Lanze den Rachen des berüchtigten Lindwurms. Das aufbäumende Pferd und der sträubende Lindwurm, der mit seinem Schweif den
hinteren Fuss des Pferdes umschlingt, zeugen vom Genie des Künstlers. Durch diese glückliche Stellung der Statue verlieh er ihr Gleichgewicht und Haltung. Alles an diesem Steingebilde spricht,
atmet und lebt. Betrachtet man die Nervenkraft und Muskelspannung, mit der der Ritter auf die Bestie losstürzt, wird einem bang und schauerlich ums Herz. Man glaubt wirklich, den Lanzenstoss und
das Geheul des Wurms zu hören. Auf einer Stufe des Brunnens steht ein Mädchen. Sie sieht sich nach jemandem um, die ihr hilft, den vollen Wassereimer auf den Kopf zu stellen. Ich entschloss mich,
ihr zu helfen und sie richtete ihre Haube etwas zurecht. Dann wollte sie mir mit einem höflichen Kopfnicker danken, und Platsch, goss sie den Eimer über meinen Kopf.»

Gassmann als Hudibras
Als Fortsetzung vom Solothurner Wochenblatt erschien Gassmanns humoristische Wochenschrift Der schweizerische Hudibras, die er ab Juni 1797 herausgab. URS JOSEPH LÜTHY
unterstützte das Blatt unter dem Pseudonym «Hilarius Umbroso». Damit wurde F. J. G. I zum «Kulturpionier von Solothurn» und erhielt den Dichternamen «Hudibras», den er auch als Pseudonym
benutzte.[22] Der Name Hudibras entstammt einem satirischen englischen Gedicht von Samuel Butler (1612–1680), in dem er unter der Maske des abenteuerlichen
Ritters Hudibras gegen die Auswüchse des Puritaner-Fanatismus zu Felde zieht. So wollte Gassmann den Kampf mit den Auswüchsen des Zeitgeistes aufnehmen. Bald geriet F. J. G. I mit der Zensur in
Konflikt und musste dem Staatsschreiber die Inhalte vor der Veröffentlichung zur Durchsicht unterbreiten.
Die Titelvignette der ersten Nummer zeigt ihn in der Verenaschlucht auf einem Bänkchen sitzend. Unter dem Bild steht: «Hudibras denkt übersinnliche Dinge» und das Epigramm:
«Ganz einsam sitz hier Hudibras,
wie Diogen in seinem Fass.
Nun fragt es sich nur: Welcher war
von beiden wohl der grössere Narr?»
Das Hubridas-Bänklein in der Verenaschlucht
In der Verenaschlucht befindet sich ein steinernes Bänkchen, das seit 1836 den Namen «Hudibras» trägt. Diese Stelle war sein Lieblingsplatz, wo er das Rauschen des Verenabächleins bei einem
kleinen Wasserfall genoss.[16]
Links: Franz Joseph Gassmann I alias Hudibras auf einem Bild von L. L. Midart, 1794. Rechts: Das Hudibras-Bänkli, Zustand 2025.
1789 kam der französische Immigrant Louis-Auguste Baron de Bréteuil (1730-1807) nach Solothurn und legte 1791 einen Weg entlang des Baches durch die Verenaschlucht an. Laurent Louis Midart (1733-1800) fertigte dort 1794 eine idyllische Federzeichnung in Aquarelltechnik an. Auf dem Bild ruht sich F. J. G. I auf einer Bank aus, die damals Chorherr-Schwaller-Bank hiess. Das Originalbild befindet sich im Depositum des Kunstmuseums Solothurn, Inv. Nr. C 81.3. Bréteuil und Midart verehrten den Solothurner Aufklärer F. J. G. I und seine Ideen.[34] Gassmann selbst verehrte die Verenaschlucht als «Tempel der Schöpfung» und als «Wundertempel der Natur».[38] In der Nähe befindet sich in der Einsiedelei die Verena-Gedenkstätte. Gassmann: «Ewig grünende Fichten beschatten den Felsen, dessen Höhle der heiligen Verena als Ruhestätte diente. Sie war Trost, Stütze und Segen aller Armen. Menschenliebe war ihr Gesetz, Herzensunschuld ihr Reichtum und die erhabene Naturwildnis ihr Gebetsbuch. In der Nähe des Blumengartens rauscht der murmelnde Giessbach über mannigfaltigen Kiesel. Nebenan steht die kleine Hütte des Eremiten, umschlossen von jungen Bäumen.»[22] Der ehemalige Buchdrucker Franz Karl Gassmann (gest. 27.09.1846) war Eremit zu St. Verena.
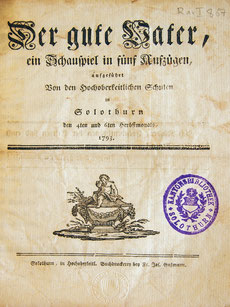
Programmhefte für Operetten, Sing- und Schauspiele
Bei F. J. G. I erschienen mehrere Programmhefte zu Oper-, Sing- und Schauspielen, die meistens von den hochoberkeitlichen Schulen Solothurns im Stadttheater aufgeführt wurden. Darunter:
Nikolaus von Flüe, oder die gerettete Eidgenossenschaft (1781), Cyrus (1786); Linna (1787), Erlachs Tod (1790), Die gute Tochter (1793), Der gute
Vater (1793), Die Belagerung Solothurns (1793), Das siegende Christenthum (1794), Matthatias (1794), Publius Kornelius Scipio (1794), Manasses, König
in Juda (1797). Rezensionen oder Ankündigungen dieser Veranstaltungen waren im Solothurner Wochenblatt unter der Rubrik «Theaterbericht» zu finden. Gassmann im Solothurnischen Wochenblatt
(12. 4. 1788): «Die Natur hat mich zum Theater bestimmt, das sagt mir mein Herz. Das Schicksal machte aus mir einen faden Schriftsteller, wie dieses Blatt bezeugt.» Dass Gassmann das Theater
publizistisch unterstützte, welches nicht von jedem geschätzt wurde, brachte ihm Anerkennung ein. In einer Rede, die Madame Korn auf der Solothurner Schaubühne hielt, sagte sie: «Wir danken dem
Journalisten, dass er die Ehre des Theaters in seinem Wochenblatt zu schützen sucht. Gold und Silber haben wir keines, aber ein dankbares Herz. Und dies ist alles, was wir ihm schenken
können.»[37]

Patriot Gassmann wird verhaftet
Am 24. November 1797 reiste Napoleon Bonaparte von Italien kommend durch Solothurn an den Kongress von Rastatt und wurde von den Patrioten freudig begrüsst. Gassmann handelte sich aufgrund
seiner der Französischen Revolution geneigten Gesinnung und der bitteren satirischen Laune seiner Zeitschrift viel Ärger ein. Er wurde am 6. Februar 1798 zusammen mit 39 anderen Patrioten,
darunter seine Mitarbeiter und Freunde aus dem Patriotenklub, von der Regierung inhaftiert. Diese Massnahme diente auch dem Schutz der «Patrioten». In der Folge konnte seine Zeitung bis zum 10.
März 1798 nicht erscheinen.
Gassmann: «Meine Gefängniszelle grenzt an zwei Nebengefängnisse, aus denen ich bisweilen einige Totenlieder hörte, und an einen finsteren Gang. Am Fuss des Gebäudes rauscht die Aare vorbei. Zur Linken stand die alte Brücke. Im Zimmer stand nichts ausser einem Strohbett, zwei hölzernen Bänken, einem Tischchen und neben der Tür ein morscher Nachstuhl.»[44] Mit dem Anrücken der französischen Bajonette und dem vom Weissenstein widerhallenden Kanonendonner kam es zu einem Volksaufstand mit der Idee, die politischen Gegner aufzuhängen. «Lasst sie hinaus, damit wir sie treffen können», riefen die Solothurner auf der Strasse. Dabei hatten sie Spiesse aus Sicheln, die an Stangen befestigt waren, dabei. Nun wollte man das Gefängnis stürmen. Dicht aneinandergedrängt harrte Gassmann nun auf seine Befreiung oder seinen Tod. Unter Lebensgefahr lenkten die Professoren Xaver Bock (1752-1829), Beat Günther und Stadtpfarrer Pfluger die tobende Menge ab, indem sie sie zu einem Gebet in der Spitalkirche hinhalten. Am 1. März 1798 traf der französische General Schauenburg (1748–1831) mit seinem Heer in Solothurn ein. Er entwaffnete die Bewohner und befreite am 2. März die «hudibrassische Patriotenfamilie». Gassmann: «Wäre Schauenburg nur acht Minuten später gekommen, so hätte uns die Wut unserer Feinde zerfleischt. Schon schoss man vier Kugeln nah an das Gitter meines Kerkers.»[33]
Einige der eingekerkerten Patrioten wurden anschliessend zu Mitgliedern der provisorischen Regierung ernannt. Gassmann setzte seine Arbeit am Hudibras fort und informierte seine Leser über verschiedene Erlebnisse, patriotische Gedichte, Volkswahlen und Erläuterungen über die neue Verfassung. Doch die Abonnentenzahl nahm ab und die Zeitschrift erschien im August 1798 zum letzten Mal. Gassmann: «Die Zeitschrift verlor sich im Sturm der Zeiten.»[10] 1798 gelangte Karl Ludwig von Erlach, genannt «General Hudibras», als Oberanführer der aargauischen Freischaren nach Solothurn, um im Zeughaus die Waffen zu holen.
Frustriernede Zeiten
Nach dem Eingehen des Hudibras klagte F. J. G. I oft über Arbeitsmangel: «Mit dem Bücherhandel steht es hier schlecht. Es gibt wenige Liebhaber von
deutscher Lektüre. Man findet keine Unterstützung. Ich hatte vor einigen Jahren eine Lesebibliothek samt einem Buchladen errichtet. Ich musste aber beides mit grossem Verlust aufgeben, nachdem
ich obendrein noch Ärger mit der damaligen Zensur hatte.» Da Gassmann sich der damaligen Regierung gegenüber nicht in allen Dingen kooperativ zeigte, wurde ihm die obrigkeitliche Buchdruckerei
wieder entzogen. Am 17. August 1798 beschloss die Regierung von Aarau die Veräusserung von Nationalgütern. Dies betraf auch die zum Verkauf bestimmte Buchdruckerei in Solothurn. Über die
Nutzungsbedingungen musste neu verhandelt werden. Gassmann bat den helvetischen Unterrichtsminister Stampfer um Hilfe, damit er die Gelegenheit erhalte, sich anderweitig einzurichten.[33] Er begründete seine Bitte damit, dass er «eine Frau, drei Kinder und eine alte Schwiegermutter zu ernähren habe». Schliesslich konnte er das alte Druckereigebäude
auf unbestimmte Zeit weiter nutzen.[36]
Durch die Folgen der Französischen Besetzung löste vom 12. April 1798 bis 10. März 1803 die neue «Verfassung der Helvetischen Republik» die Gesetze der alten Eidgenossenschaften ab. Damit erfüllte sich Gassmanns patriotischer Traum vom Einheitsstaat nach französischem Vorbild. Die Helvetische Republik umfasste
18 Kantone. 1798 verfasste Gassmann das Buch Kurzer und leichtfasslicher Unterricht über die helvetische Staatsfassung in verschiedenen Gesprächen zwischen einem Patrioten und
Antipatrioten. Es gehört zu seinen besten Arbeiten, da Gassmann darin die neue Verfassung mit klaren und verständlichen Worten vermittelt. 1799 lieferten die Solothurner Patrioten dem
fränkischen Militärhospital mehrere Körbe mit Essen für die Verwundeten. Diese menschenfreundliche Tat erfreute die Kranken mehr, als die Speisen selbst.[26]
Am 16. September 1799 begann er seine tagebuchartigen Aufzeichnungen, in dem er versuchte, seine Lebensanschauungen mit philosophischen Begriffen in Einklang zu bringen. Er begrüsste Wilhelm Meisters Lehrjahre, deren Kern er erkannte. Franz Joseph Gassmann I starb am 7. März 1802 im Alter von 47 Jahren an den Folgen eines Beinbruchs, verbannt von seinen Mitbürgern. In seiner selbst verfassten Grabschrift klagte er: «Auch hier ruht ein Sohn des Jammerns, schwach von Natur, doch strebte er nach dem Guten, meinte es redlich und starb misskannt.»
Schriften (Auswahl): 1766: ALOYS STOCKMANN: Theses ex universa Philosophia et Elementis Matheseos selectae. 1778-93: FRANK JAKOB HERMANN Neuer Solothurner Kalender. Samt einem kleinen Anhang merkwürdiger Neuigkeiten. 1781: JOSEPH IGNAZ ZIMMERMANN: Nikolaus von Flüe, oder die gerettete Eidgenossenschaft, Schauspiel. 1784: Kaufhaus Ordnung der Stadt Solothurn; Rechenkunst nach Anleitung der Normalschule in der Republik Solothurn, Teil I 1786: Rede von Johann Karl Steffan Glutz, Ritter, Schultheiss der Republik Solothurn; PETER NIVARD CRAUER: Methodenbuch für den Lehrer der Normal-, Stadt- und Landschulen in der Republik Solothurn; Lesebuch zum öffentlichen Gebrauch für die Normal- Stadt- und Landschulen in Solothurn. 1786: VON HALLER: Abhandlung über das Faulfieber für heilende Landärzte. Vorwort von Gassmann. 1787: Verordnung wegen Beziegung des Umgelds. 1789: FRANZ XAVER VOCK: Drey Predigten über den Luxus. 1788-94: F. J. G, I: Solothurnisches Wochenblatt. 1790: Anweisung zur Uniforme und Waffenübung so wohl in Handgriffen als Manoeuvres, für die Stadt und Republik Solothurn; JOSEPH IGNAZ ZIMMERMANN: Erlachs Tod - Trauerspiel. 1791: ANTON RONCA: Ehren-Rede auf die HH. Thebäischen Märtyrer Ursus, Viktor und ihre Gesellen. 1793: FRANZ JAKOB HERMANN: Die Belagerung Solothurns, Trauerspiel; CARLO GOLDONI: Die Gute Tochter - Singspiel. 1794: PETER CANISIUS: Der kleine Catechismus. 1796: Kaminfeger-Ordnung für Stadt und Land; Katholischer Katechismus zum Gebrauch der kleineren Jugend. 1797-98: F. J. G. I: Helvetischer Hudibras; 1798: F. J. G. I: Solothurns Glückwunsch auf die in Aarau getroffene Wahl des Bürgers Direktors Urs Viktor Oberlin; F. J. G. I: Kurzer und leichtfasslicher Unterricht über die helvetische Staatsfassung in verschiedenen Gesprächen zwischen einem Patrioten und Antipatrioten; F. J. G. I: Freyheits-Ode, gewidmet der gesetzgebenden Gewalt in Aarau.
2. GENERATION - Franz Joseph Gassmann II (1783-1859)
Namensgeber der «Druckerei Gassmann»
FRANZ JOSEPH GASSMANN II begann seine Buchdruckerkarriere im Zeitalter der von Napoleon 1803 gegründeten, «Schweizerischen Eidgenossenschaft» welche die «Helvetische Republik» abgelöst hatte und bis 1813 andauerte. Durch die Meditationsakte Napoleons wurde jedem Schweizer Gewerbefreiheit zugesichert. Bis 1830 folgte die Epoche der «Restauration».
Nach dem Tod seine Vaters F. J. G. I sicherte sich die Stadtgemeinde Solothurn die Buchdruckerei und wählte 1802 Ludwig Vogelsang zum neuen Buchdrucker. Vogelsang hatte seinen Beruf bei F. J. G. I gelernt und war bei ihm als Gehilfe tätig gewesen. F. J. G. II., der seine Buchdruckerlehre ebenfalls bei seinem Vater absolviert hatte, entschloss sich, eine eigene Druckerei zu eröffnen. Der Schritt in die Selbstständigkeit stiess jedoch zunächst auf Probleme. Sein Konkurrent Vogelsang, der von 1804 bis 1834 das Solothurnische Wochenblatt herausgab und für obrigkeitliche Schriften zuständig war, intervenierte. Gassmann hatte die nötigen Druckmaschinen bereits angeschafft, doch der Kleine Rat verweigerte ihm die Konzession, da er «noch allzu jung» war. Daraufhin bot sich sein Onkel Georg Gassmann als Bürge an. Unter folgenden Bedingungen durfte Gassmann seine Druckerei eröffnen: «Sie musste im Haus von Georg Gassmann eingerichtet werden, der den Betrieb beaufsichtigte und für alle Druckerarbeiten verantwortlich war. F. J. G. II muss sich im gleichen Haus häuslich niederlassen. Obrigkeitlicher Lieferant bleibt Buchdrucker Ludwig Vogelsang. Die Druckerei muss den Namen ‹Witwe Gassmann & Sohn› tragen.»

Onkel Georg Gassmann besass zwei Häuser. F. J. G. II eröffnete sein Unternehmen im Erdgeschoss der Hauptgasse 19, neben dem Zunfthaus zu Pfistern und wohnte im Haus
Hauptgasse 17.[36] 1807 musste sein Onkel die Liegenschaft aufgeben. Der junge Gassmann zog aus und etablierte sich an der Schaalgasse 10. Dieses Haus hatte
seine Mutter, Witwe Maria Jakobea Gassmann-Schmid, am 20. September 1807 erworben. Es blieb fast ein Jahrhundert lang Eigentum der Familie Gassmann. Im Erdgeschoss befand sich für die nächsten 65
Jahre die Druckerei. Selbstbewusst nannte er sie «J. Gassmann, Sohn» und gründete noch eine Verlagshandlung. Schliesslich wurde im gestattet auch Schriften für die Obrigkeitlichen zu
drucken.[36] Er gab von 1811 bis 1814 die Solothurnische Wochenschrift, die im ersten Jahrgang den Titel Vernunft und Narrheit hatte,
heraus. Redigiert wurde das Blatt von Stadtschreiber Heinrich Voitel (1775-1812) und Apotheker Xaver Fiala (1776-1825). 1824 bat der Konkurrent Vogelsang die Regierung darum, sei Privileg zu
Behalten, «die Schulbücher der Primarschulen im ganzen Kanton allein zu drucken und zu verkaufen.» Dies wurde abgelehnt. In der Reformbewegung der 30er Jahre konnte Gassmann sein Unternehmen
ausbauen und erhielt zahlreiche Regierungsschriften zum Druck, darunter den Staatskalender (1832 bis 1835). Er stand in gutem Kontakt zur benachbarten Stadt Biel, deren Bürgergemeinde 1832 bei
ihm einen Verfassungsentwurf drucken liess.[36]
F. J. G. II war verheiratet mit Anna Maria Krutter (1776-1848). Das Paar hatte die Töchter Maria Anna (1808-1864), zukünftige Setzerin der Druckerei und Mathildis (1818-1905) sowie den Sohn
Joseph Amatus (1812-1884) der das Familienunternehmen Gassmann weiterführen wird.[12]
Schriften (Auswahl): 1808: ABC- oder Namenbüchlein für die Normal-Stadt- und Landschulen des Kantons Solothurn. 1809: Anfangsgründe der deutschen Sprache. 1810: JOHANN BAPTIST HENNEBERG; Der dumme Gärtner oder Die beiden Anton - Oper. 1811: ANTOINE-GABRIEL JARS: Julie oder Der Blumentopf - Singspiel; STEPHANIE GOTTLIEB: Belmont und Konstanze oder die Entführung aus dem Serail - Oper; Kurzer leichtfasslicher Unterricht über die Obstbaumzucht; 1811-14: F. J. GASSMANN II: Solothurner Wochenschrift. 1812: Militär-Organisation für den Kanton Solothurn; Lesebuch zum öffentlichen Gebrauche für die Normal-Stadt- und Landschulen in Solothurn; Organisation des Sanitätswesens für den Kanton Solothurn. 1815: Der heilige englische Jüngling Aloysius von Gonzaga, als ein Muster fromm zu leben vorgestellt; Ordo divini officii recitandi et ecantaudi in choro insignis… (auch 1818, 1823, 1826, 1827), 1816: Anfangs-Lehren der Naturkunde der Welt- und Erd-Beschreibung in Frag und Antwort - für die Trivialschulen der Stadt Solothurn. 1817: Anfangsgründe der deutschen Sprache; Strassen-Reglement für den Kanton Solothurn. 1818: Vom heiligen Augustinus von der wahren Religion und von den Sitten der katholischen Kirche; Feuerordnung für die Stadt Solothurn; Fénelon’s Werke religiösen Inhalts. 1820: FRANZ JOSEPH HUGI: Lesebuch für die Primarschulen des Kantons Solothurn. 1822: Biblische Geschichte für Kinder. 1824: Schriften des heiligen Bernhards Bd. 1 und 2; FRANZ JOSEPH HUGI: Verfassung der naturhistorischen Kantonal-Gesellschaft in Solothurn. 1825: Johann W. Meyer / Josef Girard: Beschreibung des Bachteln oder Allerheiligen Bades bei Grenchen im Kanton Solothurn. 1826: Formenlehre der deutschen Sprache nebst den Regeln der Rechtschreibung für Primarschulen. 1831: Vorschlag der von der Stadtgemeinde ernannten Siebner-Kommission über die Stadtverfassung von Solothurn. 1832: Vortrag gehalten von dem patriotischen Verein des Kantons Solothurn.
3. GENERATION - Franz Joseph Gassmann III (1812-1884)
Begründer der Bieler Druckerei und des Seeländer Boten

Die Epoche der «Regeneration» war angebrochen, die den modernen Buchdruck einführte, die Pressefreiheit brachte und die Zensur abschaffte. 1832 gelangte die erste
Schnellpresse in die Schweiz und 1835 zählte das Land bereits 105 Druckereien.
Franz Joseph Amatus Gassmann, der in den freisinnigen Traditionen seiner Familie aufwuchs, bildete sich nach seiner Buchdruckerlehre im Geschäft seines Vaters auf einer Wanderschaft weiter. Als
Fagottspieler hatte er sein Instrument immer dabei. Zunächst arbeitete er 1832 in Yverdon als Schriftsetzer in der Buchdruckerei Fivaz, dann im selben Jahr in Sitten beim Buchdrucker Advocat und
1833 in Genf als Compositeur bei der Offizin Carl Gruaz an der Rue du Puits-Sainte-Pierre. Seine Schwester Marie Gassmann und sein Vater F. J. G. II hielten ihn durch Briefe mit Neuigkeiten aus
der Heimatstadt auf dem Laufenden. F. J. G. II: «Die Druckereigeschäfte gehen gegenwärtig sehr schwach. Wir sind schon 14 Tage ohne Beschäftigung. Spar dein Geld für eine Reise nach Frankreich,
damit du dich in der französischen Sprache üben kannst. (29. Herbstmonat 1832). Falls du zurückkommst, bin ich gern bereit, dir die Druckerei mit dem ganzen Gewerbe zu günstigen Konditionen
zu übergeben und dich immer mit Rat und Tat zu unterstützen. Du hast dann alles auf Deine eigene Rechnung zu besorgen. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, dein flüchtiges Leben in ein
erstes, mühevolles umzuwandeln. Das Blatt Der Verbreiter wäre eine schöne Beschäftigung für den Anfang, die du mit einem Lehrling auf einer eisernen Presse ausführen könntest. Unser
lieber Hausfreund Professor Franz Joseph Hugi, der uns oft besucht, hat mir versprochen, dich in deinem künftigen Unternehmen zu unterstützen.» (30. 3. 1935). [42] F. J. G. III befolgte den Rat
und stieg ab 1835 ins Geschäft seines Vaters ein.
Am 1. Oktober 1839 gründete Franz Louis Jent (1810–1867) mit F. J. G. II in der «Sauerländischen Sortimentsbuchhandlung» an der Gurzelngasse 17 die Verlagsbuchhandlung «Jent & Gassmann». Während sich Vater Gassmann um das Verlagswesen kümmerte, betreute der Sohn Franz Joseph Amatus die Druckerei. Zum Unternehmen gehörten auch eine Buchhandlung und eine Bibliothek. Regelmässig erschienen Der Verbreiter (1835–1849), der Schweizerische Bilder- oder Distelikalender (1839–1851), das Solothurner Blatt (1840–1861), das Solothurner Amtsblatt (1840–1849, 1853–1857, ab 1862) und das radikale Kampfblatt L’Hélvetie – Journal politique et littéraire (1871–1873), das vom Friedenskämpfer und Nobelpreisträger Elie Ducommun herausgegeben wurde.
Links: Gurzelngasse 17, Standort der ehemalige Verlagsbuchhandlung «Jent & Gassmann». 1883 ging die Buchhandlung an die Familie Jent und ab 1898 an Adolf Lüthy (1867-1930). Bildmitte und Rechts: Die bei J & G erschienenen Zeitung Der Verbreiter und Der Neue Bauernkalender.
Familie
Franz Joseph Amatus heiratete am 1. November 1840 in der Berner Münsterkirche die Witwe Anna Maria Bay, geb. Schaad (1811-1870), aus Schwarzhäusern, Kirchgemeinde Niederbipp.[17] Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor: die Tochter Mathildis Josefine (1841-1913), die später den Pfarrer Hugi heiratete, der Sohn des Naturforschers Franz Joseph
Hugi, sowie die Söhne und Buchdrucker Emil Josef Rudolf (1842-1871) und Eduard Otto Gassmann (1845-1902).
Gründung eines Lesezirkels
J & G eröffnete 1842 ein sogenanntes «Journalisticum», das auch als Lesezirkel bezeichnet wurde. Dabei handelte es sich um ein Leseabonnement auf bedeutende Zeitschriften. Auch der
Schriftsteller Jeremias Gotthelf abonnierte das Journalisticum, warb neue Abonnenten und freute sich regelmässig über die neuen Zeitschriften.[11]
Das Solothurner Wochenblatt
Ab dem 1. Januar 1831 erschien das Solothurner Wochenblatt, bei dem der deutsche Flüchtling Karl Mathy und Professor Franz Joseph Hugi mitarbeiteten. Bis 1849 war Dr. Peter Felber
Hauptredaktor. Das Motto der Zeitschrift lautete: «Wir haben Pressefreiheit, wollen aber nicht Pressefrechheit.» Gedruckt wurde das Blatt bis Ende März 1831 in der Offizin Vogelsang, von da bis
Ende des Jahres 1831 bei F. J. G. II, von 1832 bis Mitte Juli 1835 wiederum bei Vogelsang und vom 18. Juli 1832 bis Mitte Juli 1835 bei F. J. G. III. Von 1837 bis Ende 1839 druckte Joseph Tschan.
Mittlerweilen hatte das Blatt 1200 Abonnenten. Von 1840 bis 1861 druckte es Gassmann dann regelmässig. Die politischen Ereignisse der 40er Jahre - Klösteraufhebungen in Aarau, die
Jesuitengelegenheiten, Freischarenzüge, der Sonderbund und die Bundesrevision - waren Vorkommnisse, die die Aufmerksamkeit der Presse auf sich zogen.[43] Die Solothurnische Wochenblatt ist nicht zu verwechseln mit dem von 1835 bis 1837 erschienenen Erneuerten Solothurner Wochenblatt, des Verlegers
und Druckers Ludwig Vogelsang.

Martin Disteli
Der Oltener Maler Martin Disteli veröffentlichte einige seiner besten Arbeiten in den bei J & G herausgegeben Büchern und Kalendern. Das Bulletin des Eidgenössischen Freischiessens in
Solothurn (1840) enthielt von ihm 4 in Kupfer radierte Zeichnungen. Mehrere Radierungen erschienen 1841 im Alpina - Schweizerisches Jahrbuch für schöne Literatur. Gottfried August
Bürgers Abenteuer des berühmten Freiherrn von Münchhausen (1841) mit 16 radierten Blättern von Martin Disteli, gilt als eines der schönsten illustrierten Schweizerbücher des 19.
Jahrhunderts und ist ein Meisterwerk der Buchkunst.[15]
Disteli gab ab 1839 jährlich den erfolgreichen Schweizer Bilderkalender (Distelikalender) heraus. Dieser erschien von 1839 bis 1842 unter der Redaktion von Dr. Felber bei J & G. Da
der Verlag die neuen Konditionen Distelis nicht akzeptierte, erschien der Kalender von 1843 bis 1844 bei Xavier Amiet (1819-1869). Die Jahrgänge 1841 bis 1844 befassten sich hauptsächlich mit den
Kämpfen zwischen den Liberalen und Ultramontanen in den katholischen oder halbkatholischen Kantonen Wallis, Luzern, Solothurn und Aargau. Nachdem Disteli am 18. März 1844 an Schwindsucht
gestorben war, erwarben J & G am 27. Juli 1844 von Xavier Amiet das Verlagsrecht und den gesamten Vorrat von Distelis Schweizerischen Bilderkalender, Jahrgang 1839 bis 1844. Ebenfalls die
1844 erschienene französische Ausgabe Galerie Helvétique ou Almanach Suisse. Das Unternehmen kaufte sämtliche Zeichnungen und Skizzen, die sich im Nachlass des verstorbenen Malers
befanden. Dadurch eröffnete sich die Möglichkeit, den beliebten Kalender noch mehrere Jahre erscheinen zu lassen.[41] Dies geschah von 1845 bis 1847. 1848
verschmolz der Kalender mit dem seit 1846 von Distelis Schüler JAKOB ZIEGLER (1823-1856) herausgegebenen Illustrierter Schweizerkalender, unter welchem Namen er bei J & G bis 1851
erschien.
Jent & Gassmann und die Naturforscher
Die Gründung der Naturforschenden Gesellschaft in Solothurn 1823 verschaffte den Gassmanns regelmässig Aufträge zum Druck der Mitteilungen dieser Gesellschaft. 1826 erschien beim
Vater F. J. G. II ein Verzeichnis sämtlicher Mitglieder der Allgemeinen Schweizerischen Gesellschaft für die gesamte Naturwissenschaften, 1830 die Schrift Übersicht der Verhandlungen
der Naturforschenden Gesellschaft in Solothurn. Die Publikation machte sein Unternehmen bei den Naturforschern bekannt. Der Naturforscher Franz Joseph Hugi (1791-1855), Autor der
Naturhistorische Alpenreise, gründete 1827 in Solothurn das Naturhistorische Museum, das er 1830 an die Stadt abtrat und 1836 den Botanischen Garten. Ab 1833 unterrichtete er in der
Kantonsschule Physik und ab 1835 auch Naturgeschichte. Als er jedoch zum protestantischen Glauben überging, wurde er entlassen. 1837 heiratete er Franz Joseph Amatus Schwester Anna Maria Gassmann
(1808-1864), die Setzerin und Korrektorin seiner Arbeiten. Später wurde er Direktor des Naturhistorischen Museums Solothurn. Er brachte den Verlag Jent und Gassmann mit einer Reihe von
Naturforschern und Geologen zusammen, von denen einige sich in Solothurn aufhielten oder in der Ambassadorenstadt ihre Versammlungen abhielten. Der Naturforscher Otto Möllinger (1814-1886),
Professor an der Kantonsschule Solothurn, widmete sich vor allem der Sternenkunde. Von 1839 bis 1849 war Möllinger Redakteur der bei F. J. G III gedruckten volksbildenden Zeitschrift Der
Verbreiter gemeinnütziger Kenntnisse.
Naturforscher-Erinnerungen in der Verenaschlucht:
Findling des Geologen Amanz Gressly (Observations géologiques sur le Jura soleurois, Jent & Gassmann)
Andenken an Franz Joseph Hugi (Die Gletscher und die erratischen Blöcke, Jent und Gassmann) und Franz Vinz. Lang.
Der populäre Naturforscher und ehemalige Bieler Gymnasialschüler Professor Louis Agassiz aus Neuchâtel übergab J & G mehrere Werke. 1840 erschien bei J & G die erste genaue Höhenkarte der Schweiz. Gassmann übernahm auch den Druck und die Herausgabe der sechs Bände der Neuen Denkschrift der Allgemeinen Schweizerischen Gesellschaft für die gesamten Naturwissenschaften - Nouveau Mémoires de la société helvétique des sciences naturelles der Mémoires de la société des sciences naturelles de Neuchâtel sowie der aus diesen Werken entstandenen separaten Abdrücke. Durch die Naturforscher erhielt Solothurn den Ruf einer «wissenschaftlichen Stadt».
Reproduktion aus Déscription des Enchinodermes fossiles de la Suisse von Louis Agassiz, 1839.
Schriften der Naturforscher (Auswahl) 1837: Neue Denkschriften Bd. 1: HEINRICH RUDOLF SCHINZ Fauna helvetica oder Verzeichnis aller bis jetzt in der Schweiz entdeckten Tiere - JEAN DE CHARPENTIER: Mollusques - BERNHARD STUDER: Die Gebirgsmasse von Davos - ADOLF OTTH: Beschreibung einer neuen europ. Froschgattung - JOHANN JAKOB TSCHUDI: Monographie der schweizerischen Echsen. 1837-40: GRELLER-WAMMY: Manuel des Prisons, ou exposé historique, théorique et pratique du System penitentiaire. 2 Vol. 1838: Neue Denkschriften Bd. 2: HEINRICH RUDOLF SCHINZ: Bemerkungen über die Arten der wilden Ziegen - CHRISTOPH STÄHELIN: Untersuchungen der Badequellen von Meltingen, Eptingen und Bubendorf im Sommer 1826 - OSWALD HEER: Die Käfer der Schweiz - P. MERIAN: Mittel und Hauptresultate aus den meteorologischen Beobachtungen in Basel - AMANZ GRESSLY: Observations géologiques sur le Jura soleurois. 1838-42: LOUIS AGASSIZ: Histoire naturelle des poissons d’eau douce de l’Europe centrale in D, F, E. 1839: Neue Denkschriften Bd. 3: ARNOLD ESCHER VON DER LINTH: Contactverhältnisse zwischen krystallinischen Feldspathgesteinen und Kalk im Berner Oberland - MITTEL-BÜNDTEN, ARNOLD ESCHER, BERNHARD STUDER: Geologische Beschreibung - LOUIS AGASSIZ: Description des Echinodermes fossiles de la Suisse, Part I. - ALEX. MORITZ: Die Pflanzen Graubündens; LOUIS AGASSIZ: Déscription des Enchinodermes fossiles de la Suisse, 1 Partie: Spatangoides et Clypeastroides, Extr. du Vol. III es Nouv. Mém. ; WILLIAM BUCKLAND: Geologie und Mineralogie in Beziehung zur natürlichen Theologie mit Anmerkungen von LOUIS AGASSIZ; 1840: Neue Denkschriften Bd. 4: OSWALD HEER: Die Käfer der Schweiz - LOUIS AGASSIZ: Descript. des Echinodermes fossiles de la Suisse, Part II - CARL VOGT: Beiträge zur Nevrologie der Reptilien - AMANZ GRESSLY: Observat. géologiques sur le Jura soleurois, Part I; OTTO MÖLLIGER: Die Lehre von den Krystallformen; Mémoires de la société des sciences naturelles de Neuchâtel, Vol I u. II, avec 46 planches; LOUIS AGASSIZ: Catalogus systematicus Ectyporum Echinodermatum fossilium Musei Neocomensis; LOUIS AGASSIZ: Études critiques sur les Mollusques fossiles Vol. I; LOUIS AGASSIZ: Mémoires sur les Moules de Mollusques vivants et fossiles, Vol 1: Moules d’Acephales vivants; LOUIS AGASSIZ: Études sur les glaciers. 1841: Neue Denkschriften Bd. 5: AMANZ GRESSLY: Observat. géologiques sur le Jura soleurois, Part II - ALPHONSE DE CANDOLLE: Monstruosités végétales - CARL NÄGELI: Die Cirsien der Schweiz - Mémoire sur quelques insectes qui nuisent à la vigne dans le Canton de Vaud; FRANZ JOSEPH HUGI: Grundzüge zu einer allgemeinen Naturansicht für höhere Schulen: Die Erde als Organismus; LOUIS AGASSIZ: Untersuchungen über die Gletscher mit 32 Steindrucktafeln von Gletscheransichten. Übersetzung von Études sur les glaciers. 1842: Neue Denkschriften Bd. 6: MELCHIOR NEUWYLER: Die Generationsorgane von Unio und Anodonta - G. VALENTIN: Beiträge zur Anatomie des Zitterales - HERCULE NICOLET: Recherches pour servir à l’histoire des Podurelles - CHSTI. MARTINS: Matérieux pour servir à l’hypsométrie des Alpes pennies - KARL FRNZ LUSSER: Geognostische Forschung und Darstellung des Alpendurchschnittes vom St. Gotthard bis Art; EDOUARD DESOR: Die Besteigung des Jungfrauhorns durch Agassiz und seine Gefährten mit drei Ansichten der Jungfrau und einer Karte der Gletscher des Berner Oberlands; HEINRICH RUDOLF SCHINZ: Systematisches Verzeichnis aller bis jetzt bekannten Säugetiere, oder, Synopsis Mammalium nach dem Cuvier'schen System, 2 Bände, auch 1845; CARL VOGT: Untersuchungen über die Entwicklungsgeschichte der Geburtshelferkröte; A. MORITZI: Réflexions sur l’espèce en histoire naturelle. LOUIS AGASSIZ: Rechereches sur les Poisonns fossiles; LOUS AGASSIZ: Études critiques sur les Mollusques fossiles Vol. II, III; LOUIS AGASSZ: Nomenclateur zoologique Vol. I, II. 1843: CARL VOGT: Im Gebirge und auf den Gletschern; FRANZ JOSEPH HUGI: Die Gletscher und die erratischen Blöcke; L. RUDOLF MEYER: Die in der Schweiz einheimischen Rhynchoten, Teil 1 - Die Familie der Capsini; FRANÇOIS-JULES PICTET: Histoire naturelle générale et particulière des insectes nevroptères: seconde monographie : familles des éphémérines, auch 1845; LOUIS AGASSIZ: Nomenclateur zoologique, Vol. III, IV. 1844: WILHELM FUCHS: Die Venetianer Alpen: ein Beitrag zur Kenntnis der Hochgebirge, mit einer geognostischen Karte und Gebirgsprofilen in 18 Tafeln; LOUIS AGASSIZ: Monographie des Poissons fossiles du vieux grès rouge ou système Dévonien (Old Red Sandstone), des îles Britanniques et de Russie (bis 1845); LOUIS AGASSIZ: Nomenclateur zoologique Vol. V, VI. 1845: JAMES SOWERBY: Conchyliologie minéalogique de la Grand Bretagne, übersetzt von EDOUARD DESOR, mit einem Vorwort von LOUIS AGASSIZ; JULES THURMANN: Essai de phytostatique appliqué à la chaîne du Jura et aux contrées voisines, ou Étude de la dispersion des plantes vasculaires envisagée principalement quant à l'influence des roches soujacentes, 2 Bände, auch 1849; HEINRICH SCHINZ: Systematisches Verzeichnis aller bis jetzt bekannten Säugetiere, oder, Synopsis Mammalium nach dem Cuvier'schen System; LOUIS AGASSIZ: Iconographie des Coquilles tertiaires, réputées identiques avec les espèces vivantes…, Auszug der Mémoires de la Société helvétique des Sciences naturelles; LOUIS AGASSIZ: Études critiques sur les Mollusques fossiles Vol. IV ; LOUIS AGASSIZ: Nomenclateur zoologique Vol. VII, VIII 1846: LOUIS AGASSIZ: Nomenclateur zoologique Vol. IX, X, XI. 1847: LOUIS AGASSIZ: Nomenclateur zoologique Vol. XII; 1848: LOUIS AGASSIZ: Nomenciatoris Zoologiei Index universalis. 1851: Dr. KACHE: Relief-Tableau des Alpen- und Jura-Systems; OTTO MÖLLINGER: Astrognosie oder Anleitung zur Kenntnisse der im mittleren Europa sichtbaren Sternbilder. 1852: OTTO MÖLLINGER: Kleiner Himmels-Atlas, bestehend au 16 durchgepressten und transparenten Sterntafeln; OTTO MÖLLINGER: Zweite bewegliche Himmelskarte; OTTO MÖLLINGER: Planiglobidum des Firsterhimmels für Schulen und zum Selbstunterricht.
Inserat vom Seeländer Bote, 16. 4. 1850
Der Postheiri
Alfred Hartmanns humorvoller Postheiri (1845 bis 1875) erschien zuerst alle zwei Wochen und ab 1855 wöchentlich. Er war auch ohne Vergrösserungsglas lesbar. Die Abonnentinnen und
Abonnenten des Wochenblatts für schöne Literatur und vaterländische Geschichte erhielten ihn gratis. Das Blatt vereinte gute Buchdruckqualität mit anspruchsvollen Zeichnungen von Heinrich Jenni
(1824-1891), der auch ausserhalb der Schweiz bekannt wurde. Sporadisch wurden auch Bilder aus dem Nachlass von Disteli gezeigt. Im Postheiri las man Beiträge, die vom Basler Lällenkönig
Peppi I. persönlich verfasst wurden. Das in Fortsetzung erschienene Postheiri-Fremdwörter-Lexikon erklärte neue Begriffe: «Erdemajor heisst der Major, der zu Fuss gehen muss, im Gegensatz zum
Rossmajor, der reitet (natürlich nur in dem Moment, in dem ihn das Pferd nicht abgeworfen hat). Philosophie ist ein Ausdruck, unter dem man alles Mögliche denken kann. Gelehrte Zeitungsschreiber
brauchen ihn, wenn sie etwas Gescheites sagen wollen, aber nichts wissen.» Der Postheiri informierte über die wichtigsten Dekrete: «Die jungen bernischen Wehrmänner sollen im Gesangsunterricht
das Lied: Oh du lieber Augustin, s’Geld ist hin mit der gehörigen Präzision singen lernen.» Eine Eilmeldung aus dem Ausland besagte: «Sultan, der Lieblingshund des Prinzen Albert, ist an einer
Unverdaulichkeit gestorben. Darauf legten mehrere deutsche Höfe für drei Wochen Trauer an. Irland wird in den Belagerungszustand versetzt.»
Jent & Gassmann und Jeremias Gotthelf
Dem Schriftsteller Alfred Hartmann (1814-1897) gelang es Jeremias Gotthelf an die noch junge Firma Jent & Gassmann zu vermitteln. Diese brachten 1841 Alfred Hartmanns Alpina heraus,
in der Gotthelf seine erstmals gedruckte Novelle Wie Joggeli eine Frau sucht veröffentlichte. Im Frühling 1842 schloss Gotthelf einen Vertrag ab, in dem er sich dazu verpflichtete, in
regelmässiger Folge kleinere Erzählungen zu liefern. Diese erhielten typographisch sehr schöne Titelblätter. Von 1842 bis 1846 entstanden die sechs Bände Bilder und Sagen aus der
Schweiz, die folgende Novellen enthalten: Die schwarze Spinne, Ritter von Brandis und Das gelbe Vögelein und das arme Margrithli (Bd I, 1842), Geld und Geist oder die
Versöhnung und Der Druide (Bd. II, 1843). Bd. 3 (1843) Den Nachdruck Der letzte Thorberger (Bd. III, 1843), Die zweite und dritte Abteilung von Geld und Geist (Bd. IV und V,
1844) und Die Gründung Burgdorfs oder die beiden Brüder Sintram und Bertram (Bd. VI, 1846). Der zufriedene Gotthelf vertraute dem Verlag weitere Werke an. 1843 erschien der erste, ein
Jahr später der zweite Teil des Romans Wie Anne Bäbi Jowäger haushaltet und wie es ihm mit dem Doktern geht. Das zweibändige Werk wurde in einer Auflage von 2000 Stück verlegt. 1844
erschien Eines Schweizers Wort an den Schweizerischen Schützenverein, 1846 Der Geldstag oder die Wirtschaft nach der neuen Mode. Ab 1843 begann der Berliner Buchhändler JULIUS
SPRINGER, den berühmt gewordenen Schriftsteller aus dem Emmental zu umwerben, bis dieser ihm die Neuausgabe verschiedener Werke für deutsche Verhältnisse gestattete und höhere Honorare zahlte.
Dadurch beendete Gotthelf am 18. August 1850 die Beziehung mit J & G.[11]

Am 1. März 1849 eröffneten J & G an der Spitalstrasse 138 in Bern eine Buchhandlung. Franz Louis Jent wollte weiter expandieren und eröffnete in Biel die Verlags- und Sortimentsbuchhandlung Jent & Boltshauser. 1850 gründete er zusammen mit Gassmann in Bern die Verlagsbuchdruckerei des Bundes. Im Frühling 1872 zog die Druckerei von der Schaalstrasse 10 in die Gurzelngasse 10 um, ins ehemalige Zunftgaus zu Webern. 1887 erfolgte durch den Sohn Otto Gassmann der Umzug ins sogenannte Kosciuszkohaus an der Gurzelngasse 12, das auch als Wohnhaus diente und durch Aufbau und Anbau eines Hinterhauses erweitert wurde. 1911 übernahmen dessen fünf Töchter Frida, Klara, Alice, Elsa und Ottilia FRIDA das Haus samt dem Gebäude der Buchdruckerei.[36]
Buchdruckerei und Buchhandlung in Biel
Biel hatte um 1711 Daniel Beck als Buchdrucker und ab 1734 für viele Jahre die Burger Johann Christoph Heilmann und sein Sohn. Letztere druckten mehrere deutsche
Klassiker. Ab den 1830er Jahren wurde Biel zu einem Zentrum für Flüchtlinge, die ihre Heimatländer sowie auch die Schweiz durch Untergrundbewegungen und Revolutionen politisch umgestalten
wollten. Die Stadt wurde zu einer Hochburg der Radikalen, denen sich eine konservative Gruppe entgegenstellte. Die Konservativen waren für eine demokratische Staatsform und wollten die alte
Regierungsform beibehalten, die man 1831 mit grosser Anstrengung vom Staatsruder verdrängt hatte. [42] Im Sommer 1835 verlegten die Herausgeber des politischen Blattes Le Proscrit (auf
rotem Papier gedruckt) ihr kleines Zeitungsunternehmen vom Dörfchen Renan nach Biel. Hier setzten sie das radikale Blatt in großem Folioformat unter dem Titel Die junge Schweiz auf
Deutsch und Französisch fort. Geleitet wurde die Buchdruckerei von N. N. Girard, mit der Mitarbeit des späteren badischen Ministerpräsidenten Karl Mathy. Von nun an wurden in Biel durch
verschiedene Parteien in Tageszeitungen und Flugblättern politische Kämpfe ausgefochten. Hier standen sich die Radikalen (Alexander Schöni) und die Liberal-Konservativen (David Schwab) gegenüber,
was zu heftigen Tumulten und Sachbeschädigungen führte.[12]
Nachdem die Buchdruckerei Gassmann in Solothurn bereits eine grosse Zahl von Druckaufträgen für die Bieler Behörden ausgeführt hatte, gründete F. J. G. III zum Jahresende 1849 eine Buchdruckerei
in der Bieler Altstadt.
Links: Biel um 1850. Rechts: 1. Bieler Inserat von FRANZ JOSEPH AMATUS GASSMANN, erschienen im Seeländer Bote, Nr 1, 1. Januar 1850.
Die Druckerei befand sich zunächst provisorisch im Eckhaus Schmiedengasse 9/Rathausgässli 1, in de Räumen der ehemaligen Post. Ab dem 19. Januar 1850 war sie im Erdgeschoss des Hauses des Grossrats Heilmann an der Schmiedengasse 4 untergebracht. Später erfolgte ein Umzug ins Ernst-Schüler-Haus an der Obergasse 24.[9]

Der Seeländer Bote - Ein Parteiblatt für den Wahlkampf der Grossratswahlen
Im Vorfeld der Grossratswahlen vom Mai 1850 waren Schweizer Zeitungen wie die Berner Zeitung, der Seeländer-Anzeiger, das Thuner Blatt, die Neue Jura-Zeitung und der Guckkasten regierungsfreundlich geprägt. Im Sinne der Opposition erschienen der Schweizerische Bobachter, das Intelligenzblatt der Stadt Bern, La Suisse, Der evangelische Alpenbote und der von Gassmann ab 1. Januar 1850 herausgegebene Seeländer Bote, der im politischen Teil gegen die Radikalen zu Felde zog.[6] Dass der Seeländer Bote ein liberales-konservatives Parteikampfblatt war, zeigt auch ein Beispiel, wo F. J. G. III eine Haftstrafe von sechs Tagen verbüssen musste, weil er im Seeländer Boten die Regierung mit «ehrverletzenden Worten» bedachte. Trotz dem Wahlsieg seiner Partei zog er sich nach Solothurn zurück.[4] Am 6. Juli 1855 wurde überraschenderweise Eduard Blösch der Vorsitz im Nationalrat übertragen, die höchste parlamentarische Würde der Schweiz.
Der Seeländer Bote erschien von 1850 bis Juni 1904 jeweils dienstags, donnerstags und samstags mit einer Auflage von zunächst 1.700, später 3.000 Stück. Er hatte einen Umfang von vier Seiten und überwiegend deutschen Text. Das erste französische Inserat bewarb am 24. Januar 1850 die «Bibliothèque française». Die Bieler Stellenangebote, die einen Stadtwegmeister, Fleischinspektor und Leichenträger suchten, wurden eifrig gelesen. Es gab Leitartikel, Telegramme, Original-Korrespondenzen und Nachrichten aus allen Kantonen und Ländern. Der Samstagsausgabe wurde das Illustrierte Sonntagsblatt gratis beigelegt. Darin fanden sich Rätsel, Novellen, Erzählungen, und Humoristisches. F. J. G. III übergab sein Bieler Geschäft bereits nach sechs Monaten an seinen dort beschäftigten Halbbruder Moritz Gassmann, der im Betrieb als Schriftsetzer und Buchdrucker arbeitete.[36] Franz Joeph Amatus Gassmann kehrte nach Solothurn zurück und starb dort am 2. Mai 1884 im Alter von 72 Jahren.
3. GENERATION - Moritz Gassmann (1823-1874)
Buchdrucker, Geschäftsleiter bis 1861, Wirt vom Restaurant du Lac

Moritz Gassmann war der Sohn von F. J. G. II und der Mutter Anna Mari Born von Balsthal. Er heiratete am 22. Juli 1844 Maria Doppler (gest. 1897) aus Oltingen im Elsass. Zu ihren in Solothurn geborenen Kindern zählten Franz Wilhelm (1845-1892) und Ferdinand (1846). Die 1847 geborene Tochter Maria Emma starb nach 14 Monaten.[42]
Seit dem 21. Mai 1850 war Moritz nun für den Druck, den Verlag und die Redaktion verantwortlich.[1] Gassmann brachte 1850 die Schrift Münztäfeli für d‘ Märetlüt heraus. Diese Münztäfeli waren Tabellen zur Umwandlung des alten Geldes (Kreuzer, Batzen, Kronen) in Franken und wurden hauptsächlich auf Märkten verwendet. 1853 druckte M. G. das Gedicht Der Flüchtling von Dr. Knorr. Daraufhin wurde er auf Verlagen des Bundesrats wegen «einer zum Aufruhr anzeigenden Schrift» angezeigt und dem Richter vorgeführt.

Im selben Jahr veröffentlichte er im Seeländer Boten Nr. 24 einen «verdächtigen Artikel» gegen Jakob Stämpfli, den ehemaligen Kriegszahlmeister der
eidgenössischen Armee im Sonderbundskrieg. Obwohl M. G. nicht der Verfasser war, wurde er wegen «Ehrverletzung unter mildernden Umständen» zu vier Tagen Gefängnis verdonnert. Zudem musste er
einen Satz öffentlich widerrufen, was er am 25. August 1853 im Seeländer Boten auch tat.
1855 erschienen die Bände von C. A. Blöschs Die Geschichte der Stadt Biel und ihres Panner-Gebietes sowie ein separater Abzug von Blöschs Die Folgen der Revolution von
1798.
Umgestaltung des Seeländer Boten
Ab 1. Januar 1859 erhielt der von M. G. vergrösserte Seeländer Bote die Untertitel «Intelligenzblatt für
das Seeland» und «Feuille d’avis de
Bienne et des environs». Gleichzeitig verlegte er die amtlichen Publikationen und die Inserate aufs
Titelblatt.[9] Dazu schreibt er auf Schweizerdeutsch:
A myni geehrte Abonnente und Geneigte Leser
In Form und Tendez b’steit es nit,
Da wird i gah my gliyche Schritt;
D’Anzeige aber hei sich g’mehrt,
Und das isch d’Schuld, dass d’s Blatt sich chehrt.
I denk es wird‘ glichgültig sy,
D’Annonces z’lese vorne dri
Und nachher erst was Neu’s passiert,
Mi isch ja geng früh gnue agschmiert.
So wirde n i für Land und Stadt
Zum dütsch und weltsche Anzeig’blatt,
Das Tagesfrage o bespricht
Und mengist bringt e lust’gi G’schicht.
I chehre also d’s Chleid bloss um,
Süst bin i glych vor’m Publikum,
Das myner sygi eingedenk,
Mir sys Zutraue ferner schenk‘.
Wer Öppis publiziere wott,
Dä chöm d’rum zum Seeländer-Bott.
Und wer gern d’s Neuste will vernäh,
Der cha’s o meistes by n ihm g’seh.
Im Seeland bin i guet bekannt
Und chume wyt no umenand,
So werde d’Anzeig’ glese viel,
D’s Land uf, d’s Land ab, nit nume z’Biel.
Für dä sich hiezu bestens empfehlende
Seeländer Bote
Biel, 1. 1. 1859

Die Familie Gassmann wohnte im 1861 gekauften «Hotel du Lac» in der Büri bei Vingelz, welche sie bewirtschafteten und dem ein schöner Garten und eine Kegelbahn angehörte. Die Gästezahlen waren jedoch eher ernüchternd. 1863 wanderte M. G. in die USA aus und lies seine Familie zurück. Das Wohnhaus und andere Güter wurden im selben Jahr verkauft. M. G. wurde Faktor der Buchdruckerei des Washingtoner Volks-Tribun, einer deutschsprachigen Zeitung, die von 1875 bis 1902 jeden Samstag erschien. Als das Lokal einmal brannte berichtete die Zeitung (22. 2. 1879): «Moritz Gassmann warf seinen seidengestrickten Schlafrock auf die Flammen. Aus der stillen Menge war ein donnerndes Hurra zu hören, als wir, mit der letzten geretteten Bewohnerin des Hauses in unseren Armen der Welt verkünden durften: All is safe an we are in sured!»[36]
Schriften (Auwahl): 1851: Gutachten über die Reorganisation des Gemeindewesens im Kanton Bern; Bericht über den Tod des Herrn
Knobel und die daherige Untersuchungen; E. F. ZEHENDER: Beitrag zur gründlichen Beurteilung des Korrektionswesens der Juragewässer; E. F. ZEHENDER: Der Schweizerische
Jugendfreud, 2. umgearbeitete Auflage. 1852: Schlussbericht über die Tätigkeit der evangelisch-reformierten Generalsynode der bernischen Gesellschaft.
1855: Verzeichnis der Kunst-Gegenstände auf der Bernischen Kantonal-Kunst-Ausstellung zu Biel (Zweisprachig); C. A. BLOESCH: Geschichte der Stadt Biel und ihres
Panner-Gebietes, Bd. 1-2; C. A. BLOESCH: Die Folgen der Revolution: Anhang zur Geschichte der Stadt Biel. 1856: C. A. BLOESCH: Geschichte der Stadt Biel und
ihres Panner-Gebietes, Bd. 3. 1857: Bericht über das Unternehme der Baugesellschaft Biel. 1860: KARL HOWALD: Theobald Baselwind Leutpriester zu
Bern.
Die 4. GENERATION - Wilhelm Gassmann I (1845-1892)
Geschäftsleiter von 1861 bis 1992, Initiant vom Journal du Jura

Der am 8. März 1845 in Solothurn geborene Franz Wilhelm Gassmann kaufte von seinem Vater Moritz Gassmann im Alter von 16 Jahren am 3. Mai 1861 die Druckerei und den 1849 gegründeten Zeitungsverlag. Da er noch minderjährig war, wirkte sein Onkel F. J. G. III als sein Beistand.[102] Für die französischsprachige Bevölkerung erschien ab 1862 dreimal pro Woche das Feuille d'Avis de Bienne et de Neuveville, die früher unter dem Namen Journal de Bienne in der Buchdruckerei Heer-Betrix gedruckt wurde. Das Blatt vertrat speziell die jurassischen Interessen und wurde von Politikern wie Elie Ducommun (der bei Gassmann La vie à meilleur marché veröffentlichte), Albert Gobat und E. Bessire gefördert. Kaum 20 Jahre alt kam W. G. I von Solothurn nach Biel und übernahm 1963 den Betrieb. Neu wurde Florian Albert König verantwortlicher Redakteur.
W. G. I erweiterte das Geschäft um eine Buchbinderei und eine Sortimentsbuchhandlung. Er änderte ab 1. Januar 1863 den Untertitel des Seeländer Boten ab, liess die Bezeichnung «Intelligenzblatt» weg und setzte an dessen Stelle «Anzeigeblatt für Biel und Umgebung - Feuille d'avis de Bienne et environs». Ab 1. Oktober 1863 erschien das Konkurrenzblatt Tagblatt der Stadt Biel. Gassmann vergrösserte daraufhin das Format des Seeländer Boten und fügte jeweils samstags als Beilage das Sonntagsblatt hinzu.

Ferdinand Gassmann wird Lehrling bei Franz Wilhelm Gassmann
Das Waisenkind Ferdinand Gassmann (1846-1924), Sohn von Moritz Gassmann, lernte schon früh hart zu arbeiten und wurde schliesslich als Zimmermann verdingt. Als man ihn dort schlecht behandelte, verliess er den Arbeitsplatz. In Biel begann er in den 1860er Jahren bei seinem Bruder W. G. I eine Buchdruckerlehre, wo er den Seeländer Boten noch auf einer Handpresse druckte. Nachdem er bei der Firma Gassmann als Maschinenmeister hervorging, arbeitete er selbständig. 1871 heiratete er Elisabeth Studer (gest. 1927) von Gondiswil, die ihm die Töchter Maria Elisabeth (geb. 1872) und Amanda Josefine Bertha (geb. 1874) schenkte. 1886 gründete er mit Emil Friedrich Hasler in Basel die Buchdruckerei «Gassmann & Hasler». Ferdinand war ein begeisterter Nationalturner und hatte zahlreiche Freunde in Biel.[27]
Prämiert am Lehrlings-Preiswettbewerb Leipzig
Im März 1872 organisierte das Journal für Buchdruckerkunst erstmals einen Lehrlingswettbewerb für Buchdrucker. Die besonders knifflige Aufgabe bestand darin, eine 13 cm hohe und 9 cm
breite Visitenkarte zu erstellen. Als Preisrichter fungierten die Buchdruckereibesitzer Carl Köpfel in Berlin, Albert Mahlau in Frankfurt am Main und K. Lücke in Braunschweig. Es wurden 19
Lehrlingsarbeiten eingereicht. W. G. I hatte diese Aufgabe seinem besten Lehrling Albrecht Balmer übertragen, der die Aufgabe hervorragend löste und prämiert wurde (Platz 2). Er erhielt einen 20
Zentimeter langen und ca. 3 ½ Zentimeter hohen Winkelhaken aus Neusilber. Das im Rahmen des Preisausschreibens erforderliche Zeugnis lautete: «Der Unterzeichnete bezeugt hiermit, dass der
Lehrling Albrecht Balmer von Laugen beiliegende Karte ohne Hilfe oder Anleitung gesetzt hat und dass ihm dazu kein anderes Material als dasjenige unserer Buchdruckerei zur Verfügung stand. Biel,
22. November, 1871. Unterzeichnet von W. Gassmann.»[57]
Familie
W. G. I heiratete 1872 Rosaline Balmer von Wilderswil (1845-1.1.1913) und bald darauf bekamen sie vier Söhne:
- Wilhelm Gassmann (23.2.1873-5.11.1935), Schüler am Progymnasium Biel von 1884 bis 1889, Buchdrucker und Verleger.
- Paul Gassmann (28.2.1876-1945). Er erlernte in Bern den Beruf des Konditors und hielt sich zehn Jahre lang in London auf, wo er als Patissier im Holburn Viaduck-Hotel arbeitete. 1912 wanderte er zuerst nach Kanada und dann in die USA aus. Er war dort Chefkonditor in einem grossen Hotel in Louisville, wo er im Alter von 70 Jahren verstarb.[31]
- Hans Albert Gassmann (1877-1915), Schüler am Progymnasium Biel von 1888 bis 1893, Klassenkamerad von Dichter Robert Walser und Schulkamerad von Kunstmaler Karl Walser. Hans studierte Rechtswissenschaft an den Universitäten Bern, Leipzig und Paris. 1901 erhielt er das Fürsprecherpatent und amtete bis 1903 als Gerichtspräsident von La Neueville. Der gut bezahlte Job ermöglichte ihm ein grosses Haus mit 20 Zimmern, grossem Garten und Blick auf den See und die Alpen. Am 1. September 1903 eröffnete er ein Advokatur- und Inkassobüro in La Neuveville und in Erlach. Im selben Jahr heiratete er Rosalie Martha Läderach, die ihm den Sohn Hans und die Tochter Madeleine Rosalie Gretel schenkte. 1904 verkaufte er sein Haus, zog er von La Neuveville weg und wurde Anwalt in Courtelary. Ab 1907 praktizierte er in Biel. Von 1909 bis 1915 war er Mitglied der Kommission des Progymnasiums Biel. Politisch war er freisinnig-demokratisch orientiert und aktives Mitglied der Freimaurerloge «Stern am Jura». Er starb mit 38 Jahren.[30]
- Charles (Karl) Gassmann (28.9.1879-28.12.1954), Schüler am Progymnasium Biel von 1890 bis 1895. Metzger, Buchdrucker und Verleger,

Militärische Laufbahn
W. G. I. diente ab 1867 bei den Verpflegungstruppen. Am 25. und 26. Juni 1869 nahm er als Unterleutnant der 2. Brigade und als Brigadekommissär an einer strategisch-taktischen Marschübung von der
Aare zum Jura teil. Die Kolonne führte über den Weissenstein. 1870 war er Platzkommandant von Biel und 1871 Stabsoberleutnant im eidgenössischen Kriegskommissariat. Als im gleichen Jahr die
Bourbaki-Armee in die Schweiz kam, wurde er zum Kommandanten in Delsberg ernannt. Ab 1873 leistete er Dienst als Hauptmann im eidgenössischen Kriegskommissariat und wurde 1875 zum Stabsmajor der
Verwaltungstruppen befördert. Anschliessend kommandierte er eine Korpsverpflegungsanstalt.[9] 1879 hielt er für den Offiziersverein der Stadt Biel einen
Vortrag zum Thema «Verwaltung». 1883 liess er sich auf eigenen Wunsch in die Landwehr versetzen, die ihm das Kommando der Verwaltungskompanie 5 übertrug.
Umzug an die General-Dufour-Strasse 17
Wegen Platzmangels löste W. G. I auf Frühjahr 1873 den Mietvertrag mit Heilmann auf und verlegte seine Druckerei in ein von ihm erworbenes Haus an der General-Dufour-Strasse 17 (alte Bezeichnung
Schulgasse / Collegegasse), in dem er auch wohnte. Es befand sich direkt gegenüber dem Dufourschulhaus und hatte ein Gärtchen als Zierde. Im Erdgeschoss befand sich die Druckerei, in der
westlichen Hälfte verkaufte der Bäckermeister Locher seine Brotlaibe. Im zweiten Stock befand sich in der Wohnung der Familie das Büro von W. G. I. Von dort aus überblickte er seinen Betrieb wie
ein Kapitän von der Kommandobrücke und redigierte seine Zeitungen. In seiner Buchhandlung wurden vorwiegend klassische Literatur und einige Kunstblätter verkauft. Im dritten Stock (Dachstock)
befand sich die modern eingerichtete Druckerei. Im Hof auf der Rückseite des Hauses hatte er ein Maschinengebäude mit einem Gasmotor zum Betrieb seiner neuen Maschinen. Darunter war eine der
ersten Linotype-Maschinen, die aus New York in Europa ankamen, und die zweite, die in der Schweiz aufgestellt wurde. Dieser ersten Linotype folgten im Laufe der Jahre weitere fünf, sodass die
Maschinensetzerei schliesslich sechs Maschinen aufwies, die im Schichtbetrieb arbeiteten.[14] Beim Personal waren die Setzer
zuerst im Tageslohn und dann im Akkord angestellt. Eine Zeitlang wurde der Lohn nach Leistung verteilt. Der Lehrling hatte nach den beruflichen Arbeiten am Abend das Geschäft zu reinigen. Dann
konnte er sich in der Abendschule weiterbilden.[50]
Unterstützung der Bernischen Jurabahngesellschaft
Bei der Druckerei Gassmann erschien 1868 Eduard Martis Die Jurabahnfrage und ihre Bedeutung für Biel. Am 3. Juli 1870 wurde die Bernische Jurabahngesellschaft, spätere
Jura-Bern-Luzern und Jura-Simplon-Bahn, gegründet und schon acht Tage danach mit dem Bau der Linien Biel-Sonceboz-Tavannes und Sonceboz-Convers begonnen. Die Linie war am 1. Mai 1874
fertiggestellt. Der weitere Ausbau der Juralinien war allerdings aufgrund finanzieller Schwierigkeiten fraglich. Die Direktion hoffte auf die Mithilfe Privater. W. G. I beschloss im Journal
du Jura und im Seeländer Boten durch informative Artikel für das Projekt zu werben. Der Erfolg war so gross, dass allein in Biel von Privaten Aktien im Wert von 29.000 Franken
gezeichnet wurden. Somit konnte zusammen mit den Beträgen aus dem Jura der Ausbau gesichert werden.[28]

1873 zeigte W. G. I an der Weltausstellung in Wien Proben seiner Buchdruckerei und sicherte sich dadurch die Zuteilung der zu diesem Anlass geprägten Fortschrittsmedaille. 1878 beteiligte sich die Firma an der Pariser Weltausstellung und 1883 an der Schweizerischen Landesausstellung in Zürich.[9]
Ab 1876 erschien als «einzige französische Tagblatt des Jura» das Feuille d'Avis unter dem Titel Journal du Jura - Organe des libéraux jurassiens. Es wurde ausser Montags täglich herausgegeben.
Gassmann gab auch den Bernischen Lehrerkalender heraus. Darin waren Tabellen über sämtliche Primar- und Mittelschulen des Kantons Bern, deren Lehrkräfte sowie die Resultate der Rekrutenschule zu finden. Alles war nach Amts- und Schulbezirk geordnet. Ab dem 1. Juni 1878 brachte er einen handlichen Lokalfahrplan heraus. Zunächst umfasste dieser die Linie Bern, dann folgten die Linien Jura-Bern-Luzern, Biel-Neuenburg, Biel-Olten, Lyss-Solothurn und Lyss-Murten.[42]

Der Seeländer Bote wird Amtsanzeiger von Nidau
Durch Vertrag mit 27 Einwohnergemeinden des Amtsbezirkes Nidau wurde der Seeländer Bote ab dem 1. Oktober 1879 als amtliches Publikationsmittel des Amtes Nidau verwendet. Ausserdem
gelangte einmal wöchentlich ein Separat-Abdruck unter dem Titel Amts-Anzeiger gratis, an alle Haushaltungen des Amtes. Im Verlag Gassmann erschienen ebenfalls der Amtliche Anzeiger
für das Amt Aarberg mit einer Auflage von 3100 und der Amts-Anzeiger für das Amt Büren und die Gemeinde Grenchen mit einer Auflage von 2700 Stück.
Aufruf zum Duell
Im Seeländer Boten (9. 5. 1878) wurde auch der der ehemalige Bundesrat und zurzeit für die Franzosen kämpfende General Ulrich Ochsenbein (1811-1890) kritisiert. Dieser stellte daraufhin
gegen W. G. I Strafanzeige. Der Redaktor, der «nur die öffentliche Meinung vertrat» wurde an der Schwurgerichtsverhandlung freigesprochen. Ochsenbein, der die Gerichtskosten und eine
Entschädigung von 150 Franken an Gassmann zu zahlen hatte, wollte sich nun als Genugtuung mit Gassmann duellieren. Diese Botschaft musste Doktor Boll, Sanitätsoffizier von Aarberg, in einem Brief
übermitteln. Boll: «Ich begab mich nach Biel in die Wohnung von Gassmann. Dort teilte man mir mit, er sei nach seinen temporären Sommeraufenthalt in Sutz verreist, wo ich ihm den Brief
überbrachte.» Gassmann bat ihn um den Brief, womit Boll nicht einverstanden war, da es sich um eine Sache strengster Verschwiegenheit handelte. Am 9. September 1878 bezog Gassmann in der
Berner Tagespost Stellung dazu: «Ochsenbein hatte sich selbst als Redner ins Ehrengericht gewählt. Nach dem Gerichtsurteil wird kein vernünftiger Mensch die einfältige Zumutung am Platz
finden, die Sache noch einmal durch das Faustrecht entscheiden zu lassen. Um sich mit jemandem in den Waffen zu messen, müsste man ihn zuerst als Ehrenmann anerkennen.»[47]
Der Betrieb Gassmann trieb mittlerweile die Maschinen durch Wasserkraft an, die Beleuchtung erfolgte durch Gas. Von 1883 bis 1935 arbeitete der Buchdrucker-Maschinenmeister und Tenor Jakob Jäggi (1860-1935) mit. 1888 verzeichnete die Firma Gassmann 20 Mitarbeiter. An der Weltausstellung Paris 1889 erhielten die bei Gassmann gedruckten illustrierten Schulzeitschriften der Fortbildungsschüler und die Fortbildungsschülerin die silberne Medaille. 1891 ging das Basler Tagblatt an die Buchdruckerei Gassmann über.
Gassmann als erster Präsident der Christkatholischen Kirchgemeinde Biel
1528 trat Biel unter dem Einfluss von Thomas Wyttenbach zur Reformation über und verbot katholische Gottesdienste. Im gesamten Stadtgebiet durfte sich kein Katholik mehr niederlassen oder
Grundstücke erwerben. Die Vereinigung Biels mit der französischen Republik 1797 ermöglichte die Wiederausübung der katholischen Religion. 1815 kam Biel zum Kanton Bern. 1828 wurden die Katholiken
kirchlich dem in Solothurn residierenden Bischof von Basel unterstellt. 1847 erschien im Verlag Jent und Gassmann in Solothurn Die Christkatholische Religionslehre für die grössere Jugend des
Bistums Basel, verfasst vom Basler Bischof Joseph Anton Salzmann.
Mit der Gründung des Bundesstaats 1848 erhielten die Eidgenossen durch die Bundesverfassung Glaubens- und Gewissensfreiheit. In den 1850er Jahren hatten sich in Biel und Umgebung über 500
Römisch-Katholiken und liberale Altkatholiken niedergelassen. Durch ein grossrätliches Dekret vom 29. Mai 1865 hatten die Katholiken von Biel den Charakter einer privaten Pfarrgenossenschaft.
Diese erhielt 1873 den Status einer Kirchgemeinde. Gassmann schloss sich der christkatholischen Bewegung an, weil er in ihr die Pflegerin und Hüterin einer gesunden, natürlichen, das Evangelium
Jesu Christi ausbreitenden Frömmigkeit erkannte. Die Christkatholiken erkennen Christus allein als ihr oberstes Haupt an. Sie gehören zu den Altkatholiken, da für ihr Bekenntnis und ihre
Kirchenordnung die Prinzipien der alten katholischen Kirche massgebend sind. Gassmann beteiligte sich an den ersten Versammlungen der Christ-Katholiken an einer Vereinbarung für eine neue
Kirchenverfassung. Zudem wünschte er sich für die Bieler Christkatholiken ein eigenes Gotteshaus.
Aufgrund des Kulturkampfes erhielten sie ab 1. November 1873 die von den Römisch-Katholiken neuerbaute Marienkirche als Gotteshaus. Sie bestand damals nur aus der sogenannten Unterkirche (der
heutigen Krypta). Der Regierungshalter rief am 2. November 1873 eine freisinnig-katholische Kirchgemeindeversammlung ein. So entstand der Christkatholische Kirchgemeinderat Biel. Anschliessend
wurde der katholische Kirchenrat als erste liberal-katholische Gemeinde im bernischen Jura konstituiert. W. G. I wurde mit 88 von 101 Stimmen zum ersten Präsidenten der freisinnigen
Christkatholischen Kirchgemeinde Biel gewählt. Dieses Amt übte er bis 1892 aus. Der Bund (4. 11. 1873): «Ein Ereignis, welches zu den schönsten Hoffnungen für den Fortschritt der liberalen Ideen
in unserer Gegend berechtigt.» 1874 wurde Gassmann in den Bieler Gemeinderat gewählt und in der Berner Hochschule eine christkatholische Fakultät gegründet. 1875 mussten die Christ-Katholischen
die Marienkirche an die Stadt Biel abtraten. Die Abtretung erfolgte unter der ausdrücklichen Bedingung, dass die Kirche dauerhaft für den christkatholischen Gottesdienst genutzt wird. Dazu
veröffentlichte Gassmann die Schrift Der sogenannte Verkauf der katholischen Kirche in Biel.
Hinsichtlich der Organisation der Schweizer Altkatholiken zu einer eigenständigen Kirchengemeinschaft fanden zuerst in Bern (14. Juni 1874) und dann in Olten (27. September 1874) Verhandlungen
statt. Auf der letzteren Konferenz wurde als Titel der neuen Gemeinschaft das Prädikat «christkatholisch» angenommen, wobei die Bezeichnungen «alt-» und «liberal-katholisch» verworfen wurden. Vom
14. und 15. Juni 1875 tagte in Olten die erste Nationalsynode der christkatholischen Kirche der Schweiz. Gassmann war Mitglied dieses Nationalsynodalrats und wirkte als Sekretär und
Schriftführer. Empfohlen wurde der von dem Zentralkomitee ausgearbeitete Verfassungsentwurf der Synode, die Vorlagen über die Geschäftsordnung der Synode und des Synodalrates, der Bischofswahl
und die bischöfliche Amtsführung. Es wurde beantragt, dass die priesterliche Kleidung beim Gottesdienst möglichst einfach sein sollte, die Muttersprache als Kirchensprache gelte, der Beichtzwang
und das Fasten abgeschafft werde und die Priester heiraten dürfen. Verlangt wurde auch die Abkehr vom Marien-, Heiligen- und Reliquienkult. Die Nationalsynagoge soll sich aus dem Bischof, drei
Geistlichen und Laien zusammensetzen.
Die katholischen Kirchgemeinde Biel wurde 1876 zum christkatholischen Nationalbistum. Damit war die katholische Kirchgemeinde Biel durch einen demokratischen Entscheid christkatholisch geworden.
1876 hatte die christkatholische Kirche der Schweiz einen Bestand von 55 Kirchgemeinden und 17 Vereinen mit 73.380 Gläubigen. 1877 verzeichnete die christkatholische Kirchgemeinde Biel 1100
Mitglieder, 35 Taufen, 6 Eheschliessungen und 11 Begräbnisse. 150 Kinder erhielten christkatholischen Unterricht. 1883 fand eine Erneuerungswahl des Kirchgemeinderats statt, in der Gassmann 123
von 124 Stimmen erhielt. Im Juni 1884 organisierte er den Bieler Besuch der Delegierten der Nationalsynode der Christkatholischen Kirche der Schweiz. Gassmanns Programm umfasste «Hochamt und
Predigt in unserer Kirche, Sitzung in der Aula des Mädchenschulhauses, Bankett im Schweizerhof und Spaziergang in der Umgebung der Stadt». Am 16. Mai 1886 wurde in der Marienkirche die neue
Kanzel eingeweiht. In Solothurn kamen in der Druckerei und im Verlag von F. J. G. III die Christkatholische Religionslehre (1877) und das Christkatholische Gesangsbuchs
heraus.

Am 11. Dezember 1887 hatte die katholische Kirchgemeinde Biel Wahltag, bei der Gassmann als Präsident einstimmig wieder gewählt wurde. Durch das Dekret des bernischen Grossen Rates vom 28. Februar 1898, wurde die bisherige katholische Kirchgemeinde Biel aufgelöst und in eine römisch-katholische und eine christkatholische staatlich anerkannte Kirchgemeinde umgewandelt. 1903 errichtete die christkatholische Kirchgemeinde an der Quellgasse 27 eine Kirche im neuromanischen Stil. Am 10. Januar 1904, am Sonntag nach dem Fest «Epiphanie» (Erscheinung des neu geborenen Herrn vor den Weisen aus dem Morgenland), weihte der Bischof der Christkatholischen Kirche der Schweiz, Dr. Eduard Herzog, die neue Kirche auf den Namen «Epiphaniekirche». Herzog hatte 1898 am Begräbnis Gassmanns teilgenommen und sah nun dessen Wunsch nach einer eigens für die Christkatholiken erbaute Kirche erfüllt.
Präsident des Schweizerischen Grütlivereins
Am 20. Mai 1838 gründeten deutschschweizerische Handwerker in Genf den Grütliverein. Ihr Anliegen war es, dass jeder Schweizer über genügend patriotische Bildung verfügte, um aktiv an der
schweizerischen Demokratie teilnehmen zu können. In ihren Versammlungen sprachen sie sich mit «Bürger» an.[62] Mit der am 1. April 1849 gegründeten Sektion
Biel des Schweizerischen Grütlivereins begann in Biel eine rege politische Tätigkeit, wie sie in der Stadt bisher noch nicht beobachtet worden war. Die Tätigkeit des Vereins erstreckte sich auf
alle Gebiete: So wurden 1849 ein Männerchor, 1871 eine Schützengesellschaft und 1874 eine Turnsektion gegründet. Deutschlehrer Albert Galeer (1816-1851) war lange Zeit Zentralpräsident der Bieler
Sektion.[64] Sein Vater Johann Leonhard Galeer heiratet Anna Margaretha Stauffer aus Biel und liess sich 1828 als Gypsermeister in Biel nieder, wo er sich
1830 in das Bürgerrecht einkaufte. Seit 1. Oktober 1851 gab das Zentralkomitee des Schweizerischen Grütlivereins das Vereinsorgan Der Grütlianer heraus. Die Idee des Grütlivereins als
eine sozial ausgerichtete, aber vaterländisch eingestellte Organisation, stiess bei den Behörden nicht immer auf volles Verständnis.[67] Auf Veranlassung
Eduard Blöschs verbot der Regierungsrat von 1852 bis 1854 den Grütliverein wegen seiner Abhängigkeit von den politischen Ansichten Galeers. [64] In der Folge entwickelte sich der Verein zusammen
mit seinen verschiedenen Untersektionen und erreichte mit dem Zentralfest des Schweizerischen Grütlivereins vom 10. und 11. August 1856 einen Höhepunkt. 27 Sektionen waren vertreten.[65]
W. G. I hatte im Gegensatz zu seinem Vater eine radikale Richtung eingeschlagen. Er war Mitglied des Schweizerischen Grütlivereins und ab 1864 laut Grütlianer (26.10.1864) Mitglied
der französischsprachigen Sektion des Bieler Grütlivereins (la section française de la société fédérale du grutli de Bienne). Weitere Mitgliedern waren u.a. die Uhrmacher Choppard, Präsident
(Sonviller), Gallandat (Rovray), Donier (Buttes), Huguenin und Dubuis (La Chaux-de-Fonds) sowie der Uhrenfabrikant Carrel-Botteron.
Gassmann unterzeichnete seine Beschlüsse stets mit «patriotischem Gruss und Handschlag». In der Sitzung des Schweizerischen Grütlivereins vom 4. Juli 1865 des Schweizerischen Grütlivereins fand
eine vierstündige Diskussion über die Revision der Bundesverfassung statt. Sekretär Gassmanns hatte eine Eingabe verfasst, die besagte, dass «die Revision der Bundesverfassung einer gründlichen Prüfung unterzogen werden müsse». Zu den wichtigsten Punkten gehörten: 1) Freiere und
einheitlichere Niederlassungsbedingungen für Schweizer in allen Kantonen, 2) Wahl des Bundesrats durch das Volk, 3) Abschaffung des Ohmgeldes. Im Grütlianer stand, dass die französische
Sektion «bei der Bevölkerung Biels in verdientem Ansehen» stand. An der Generalversammlung des Schweizerischen Grütlivereins am 18. Juni 1866 in Schwyz, waren aus Biel zwei Vertreter der
deutschsprachigen und zwei der französischsprachigen Sektion anwesend. Gassmann war der aktivste der Bieler Delegierten. Das französische Organ Le Grütli entsprach seiner Auffassung nach
nicht dem Vereinszweck. Gassmann im Grütlianer (13. 6. 1866): «Es braucht eine bessere Redaktion und klarere Statuen für das Blatt. Das französische Organ muss dem
Grütlianer gleichgestellt werden.» In Übereinstimmung mit weiteren französischsprachigen Sektionen stellte er daraufhin im Zentralkomitee folgenden Antrag: «Das französische Organ Le
Grütli wird Vereinseigentum. Das neue Zentral-Komitee wird beauftragt, mit speziellen Vorschlägen betreffend Redaktion und Druck vor den Gesamtverein zu treten und sie genehmigen zu lassen.»
Der Antrag wurde angenommen und Le Grütli erschien in einem grösseren Format.
1866 wurde die Zentralleitung des Schweizerischen Grütlivereins mit 67 Stimmen der deutschen und französischen Sektion Biel übertragen und Gassmann ihr Präsident.[66] Gassmann im Grütlianer (8.8.1866): «Der Grütliverein muss immer das werden, was seine Gründer im Auge hatten, die Schweizerische freie Männerschule. Hierzu bedarf
es vor allem Einigkeit. Das Komitee ist bestrebt, in der französischen Schweiz neue Sektionen zu gründen.» Das Komitee setzte sich aus folgenden 7 Mitgliedern zusammen:
Wilhelm Gassmann, Redaktor, Präsident
Jakob Aebersold, Schneidermeister, Vizepräsident
Eduard Beerstecher, Bieler Gymnasiallehrer, 1. Sekretär
Johann Roth, Uhrmacher
Adam Wysshaar, Uhrmacher, Kassier
Friedrich Lauffer, Buchhändler, Archivar
Friedrich Sauser, Regoziant, Buchhalter[63]
Die französische Sektion Biel gründete 1866 eine Vorschussbank, die im ersten Jahr 426 Darlehen und Diskontierungen in Höhe von insgesamt 137.000 Franken gewährte. Am Januar 1867 entschied der Zentralverband mit 920 Stimmen, dass Gassmann den Druck und den Verlag des Le Grütli übernimmt. Redakteur wurde Ed. Beerstecher. Die erste Ausgabe unter der neuen Redaktion erschien in der ersten Februarwoche 1867. In dieser Zeit traten mehrere deutsche Sektionen, darunter Hamburg und Mannheim, aus dem Gesamtverband des Grütlivereins aus. Am 25. Juli 1868 verabschiedete sich Gassmann als Präsident des Zentralkomitees, da der neue Sitz St. Gallen wurde. Er blieb dem Bieler Grütliverein weiterhin treu, dem sich im Verlauf der Jahre weitere Mitglieder der Druckerei Gassmann anschlossen. Eine Abnahme der Mitgliederzahl erfolgte durch die gegründeten Sektionen Bözingen und Madretsch. 1888 erfolgte in Biel die Annahme einer eigenen Druckerei für den Grütliverein und die Gründung der Arbeiterunion. 1891 kaufte der Verein, nachdem sich aus dem selben eine wirtschaftliche Genossenschaft gebildet hatte, in der Bieler Altstadt das Abtenhaus. Er erhielt dadurch ein eigenes Heim mit Wirtschaft zur «Helvetia» und Volksküche. 1891 bestand der Gesamtverein aus 352 Sektionen mit 15977 Mitgliedern. 1892 schloss sich die französische Sektion Biel der Arbeiterunion an.[65]
Wenn es darum ging, ein gemeinnütziges Unternehmen zu fördern, eine gute, fortschrittliche Idee im Schulwesen oder im politischen Leben zu verwirklichen oder einen Anlass Biels gebührend zu feiern, dann stand W. G. I. immer in der ersten Reihe. Der Bieler Stadtarchivar Werner Bourquin im Bieler Tagblatt (1. 2. 1949): «Als die liberalen Politiker im Kanton Bern den bernischen Volksverein ins Leben riefen, ergriff Gassmann die Initiative zur Gründung einer Sektion Biel, welche am 13. Juli 1872 beschlossen wurde. Gassmann amtete als Präsident, Bijoutier AUGUST WEBER als Vizepräsident. Gassmann war zudem Präsident des Grütlivereins. Als Mitglied des Bieler Stadt- und Gemeinderats bekleidete er lange Zeit im Gemeinderat das Amt eines Vizepräsidenten.»[9] 1886 erklärte der Grosse Stadtrat Gassmanns Antrag bezüglich der Unentgeltlichkeit des Sekundarunterrichts für erheblich. Bourquin: «Als Zeitungsverleger bemühte er sich, einen sinnvollen Kontakt zwischen der Stadtkanzlei und der Presse zu schaffen. Auf seine Anregung hin beauftragte der Gemeinderat den Stadtschreiber damit, jeweils den hiesigen Zeitungen nach Schluss der Gemeinderatssitzungen einen Auszug über diejenigen Beschlüsse zu übermitteln, die für die Öffentlichkeit von Interesse waren. In seiner Zeitung nahm er zu allen politischen Tagesfragen Stellung. Gassmann war ebenfalls in der Polizei und in der Fertigungskommission vertreten. Als 1877 die Vorarbeiten für die grosse Wasserversorgung aufgenommen wurden, gehörte Gassmann als Vertreter des Stadtrats zum Verwaltungsrat. 1880 wurde er in die Direktion der Gas- und Wasserwerke gewählt.»[9] Gassmann war ab 1846 Mitglied und von 1869 bis 1892 der 4. Präsident der «allgemeinen Krankenkasse der Stadt Biel und Umgebung», der ältesten Krankenkasse Biels. Der Eintritt war für die Arbeiterschaft nicht obligatorisch. Er gehörte zum Komitee der Narhalla und organisierte 1886 für die Bieler Faschingszunft den historischen Umzug. Von 1889 bis 1892 war er der Staatsvertreter im Verwaltungsrat des Progymnasiums. Gassmann war ebenfalls Mitglied des «Börsenvereins der Deutschen Buchhändler» zu Leipzig.
Gassmann als Hundeliebhaber
In Sutz widmete sich W. G. I mit Leidenschaft der Hundezucht. Besonders stolz war er auf die englische Mastiffhündin «Miss», die an der Berner Internationalen Hundeausstellung prämiert wurde und
deren Mutter aus dem Jardin d’Acclimatation in Paris stammte. Gassmann war Mitglied der Schweizerischen Kynologischen Gesellschaft (SKG).
Ein langsam aufkommendes Nieren- und Herzleiden begannen seine Tätigkeiten einzuschränken. Er starb im ehemaligen Pfarrhaus Sutz am 8. April 1892 mit 47 Jahren an Herzversagen. Die Beerdigung fand in Biel am 10. April statt. Unter den Anwesenden befand sich Bischof Herzog. Mit einem Lied des Männerchors der «Typographia» schloss die Feier. Danach entschloss sich die Witwe Rosalie Gassmann dazu, von Sutz wegzuziehen.[3]
Schriften (Auswahl): 1872: Chemins de fer du Jura Bernois, 1. rapport pr. 1871. 1875: Companie des chemins de fer du Jura Bernois, septième rapport; FRATER HILARIUS: Almanach Catholique Suisse - nouveau Disteli. 1876: SAMUEL SCHINDLER-MONNING: Petition der Schweizer Glashütten-Besitzer an den Hohen Ständerath bezüglich der Kinderarbeit in de Fabriken / Pétition des verreries suisses au Haut Conseil des Etats relativement au travail des enfants dans les fabriques, article 15 du projet du Haut Conseil national de juin 1876. 1877: Règlement d'organisation et d'administration du synode catholique du canton de Berne du 30 septembre 1877; ALBERT GOBAT: Recours aux Chambres de la Confédération suisse pour la Municipalité de Delémont contre le Conseil fédérale de la République; Dr. CRAMER: Bemerkungen zu der Ordnung des kirchlichen Religionsunterrichts vom 10. Oktober 1877 und zu den kirchlichen Eheverkündungen; FRATER HILARIUS: Neuer Distelikalender 1877. 1878: ULRICH OCHSENBEIN: Ulrich Ochsenbein vor dem Volksgerichte: stenographisches Bulletin der Assisenverhandlungen im Pressprozesse des Herrn General Ulrich Ochsenbein gegen die Redaktionen des "Seeländer Boten" und der "Berner Tagespost"; FRATER HILARIUS: Neuer Distelikalender 1878; Bemerkungen zu der Ordnung des kirchlichen Religionsunterrichts vom 10. Oktober 1877 und zu den kirchlichen Eheverkündungen. 1879: Nidauer Anzeiger: amtliches Publikationsorgan für den Amtsbezirk Nidau (Serie) 1880: Notizkalender für Lehrer; W. STURM, Musikdirektor in Biel: Der Katechismus eines Gesangslehrers. 1881: G. FERRIER-HOUMARD: Manuel d’instruction civique et de civilité; W. STURM: Die Aussprache der Schriftsprache für den Gesang. 1884: Fragments et éphémérides de l'histoire de la réaction patricienne-conservative-ultramontaine de 1850 à 1854 dans le canton de Berne. 1885: CHARLES-HENRI MARTIN: Erophiles - poésies. 1886: CHARLES-HENRI MARTIN: Pégase - nouvelle. 1887: ELIE DUCOMMUN: Sourires - poésies.
Die 4. GENERATION - Witwe Rosalie Gassmann (1845-1913)
Betriebsleiterin von 1892 bis 1895
Rosalie Gassmann führte den Betrieb an der General-Dufour-Strasse 17 von 23. Juli 1892 bis 1. Mai 1896 unter dem Namen «Vve W. Gassmann» weiter. Sie betreute die Buchdruckerei und die Assortimentsbuchhandlung und war für die Herausgabe des Journal du Jura und des Seeländer Boten verantwortlich. Für die Redaktion dieser Blätter war Jakob Krull zuständig. Der Seeländer Bote erschien ab 16. August 1892 unter ihrem Namen. In Biel wurde 65 Prozent Deutsch und 35 Prozent Französisch gesprochen. «Bienne» lautete der Poststempel, weil Biel zum Postkreis Neuenburg gehörte. 1892 war das Jahr der grossen Arbeitslosigkeit. Eine Untersuchung von Haus zu Haus ergab im Industriezentrum Biel (Biel, Bözingen, Madretsch) 701 notleidende Familien mit 2472 Familienmitgliedern, darunter 1435 unerzogene Kinder. Davon waren 225 Familien ohne Verdienst und 476 teilweise verdienstlos. Eine Bürgerversammlung beschloss eine ganze Reihe Massregeln zur Bekämpfung des Notstandes, über die der Seeländer Bote laufend berichtete. Rosalie Gassmann fügte ab 12. Januar 1895 jeweils samstags eine zweiseitige Beilage dem Seeländer Boten dazu. Für den Bieler Verleger *Ernst Kuhn druckte sie mehrere Bücher. Der Verein ehemaliger Bieler Studierender bedankte sich bei Rosalie für den Druck ihrer Statutenentwürfe und für finanzielle Rücksichtnahme, die keine andere Bieler Firma zeigte.
Schriften (Auswahl): 1893: *ALBERT MAAG; Geschichte der Schweizertruppen im Kriege Napoleons I, Bd. 2. 1894: GUSTAVE CORREVON: Denkschrift zuhanden des hohen schweizerischen Bundesrates von Seiten des Verbandes des Hilfsgesellschafte der französischen Schweiz. 1895: *A. BÄHLER: Mitteilungen über den Grimselpass und das Grimselhospiz; *ED. BÄHLER: Jean Le Comte de la Croix, gewidmet Dr. Emil Blösch.
Die 5. GENERATION - Wilhelm Gassmann II (1873-1935)
Schüler am Progymnasium Biel von 1884 bis 1889, Initiant vom Bieler Tagblatt

Eduard Friedrich Wilhelm Gassmann wurde am 23. Februar 1873 in Biel geboren. Nach der Primarschule schloss er seine Schulbildung 1889 mit dem Progymnasium ab. Seine Jugendzeit verbrachte er im Winter im Elternhaus an der Dufourstrasse und im Sommer auf dem schönen Landgut in Sutz. Da vier Generationen seiner Familie Buchdruckermeister und Zeitungsverleger waren, fühlte er sich dazu verpflichtet, ebenfalls diesen Beruf zu ergreifen.[13]
Im väterlichen Geschäft absolvierte er seine Lehrzeit. Dann arbeitete er in Genf als Setzer im Verlag der Tribune de Genève. Hier erweiterte er seine
Kenntnisse und bildete sich speziell im Zeitungsfach aus. In Paris trat er eine Stelle in einer Druckerei an. Dort gab er eine kleine Zeitung heraus, die mit jugendlicher Begeisterung zu den
politischen Tagesfragen äusserte und sich grosser Beliebtheit erfreute. Albert Gobat, der spätere bernische Regierungsrat und Erziehungsdirektor, gehörte ebenfalls zu den Mitarbeitern des
Pariserblattes. Mit einem kurzen Aufenthalt in London schloss W. G. II seine berufliche Ausbildung im Ausland ab und kehrte nach Biel zurück.[6] Er trat in
das von seiner Mutter geführte Geschäft ein und beschloss, den gesamten Betrieb neuzeitlich umzustellen. Als Praktiker lag ihm insbesondere die technische Umgestaltung der Buchdruckerei am
Herzen. Aber die räumlichen Verhältnisse im Haus an der Dufourstrasse erwiesen sich als ungünstig.
Ein Seifenhersteller macht sich die Hände schmutzig
Kaum hatte W. G. II am 1. Mai 1896 die Druckerei und den Verlag auf seinen Namen übernommen, wurde er bereits in eine Schlammschlacht zwischen den beiden Seifenherstellern Gebrüder Schnyder in
Madretsch und Lever Frères in London (Sunlight-Fabrik) verwickelt. Auslöser war ein Flugblatt, in dem behauptet wurde, die Lever-Seife sei die beste aller Zeiten. Die Gebrüder Schnyder
versuchten, diese Behauptung mit chemischen Analysen zu widerlegen. Daraufhin brachten die Lever Frères ein neues Flugblatt heraus, das als Beilage in 24 Zeitungen, darunter der Seeländer
Bote, verbreitet wurde. Die Gebrüder Schnyder zeigten daraufhin den Verleger Gassmann wegen Ehrverletzung an. W. G. II beteuerte, dass dies ohne böse Absicht geschehen sei und er das
Flugblatt auch nicht gedruckt habe. Die Geschworenen sprachen ihn dennoch wegen geringer Ehrverletzung für schuldig.[46]

Der Guide Gassmann
W. G. II gelang es, den von W. G. I erst nur für lokale Verhältnisse herausgegebenen Fahrplan zu einem vielbeliebten Kursbuch für die ganze Schweiz auszubauen. Er erhielt 1897 den Namen Guide
Gassmann und wurde in einem hübschen Einband mit Goldtitel präsentiert. Durch das Miniaturformat (6:8 cm) lies er sich sehr gut in der Westentasche tragen und zeichnete sich somit durch einen ehr
günstige Preis aus.[6] Aufgeführt waren das Netz der Bundes- und Nebenbahnen,
sowie der Schiffkurse. Ein Spezialregister für die verschiedene Städte und Ortschaften orientierte über die direkten Anschlussstrecken. Die Bieler Stadtausgabe enthielt eine Sonderbeilage, die
die Ankunft- und Abfahrtszeiten der städtischen Tram- und Buslinien aufzeigte.
W. G. II gelang es, den ursprünglich nur für lokale Verhältnisse von W. G. I herausgegebenen Fahrplan zu einem beliebten Kursbuch für die ganze Schweiz auszubauen. Es erhielt 1897 den Namen
Guide Gassmann und wurde in einem hübschen Einband mit Goldtitel präsentiert. Durch sein Miniaturformat (6,8 cm) liess es sich sehr gut in der Westentasche tragen und zeichnete sich
somit durch einen sehr günstigen Preis aus.[6] Aufgeführt waren das Netz der
Bundes- und Nebenbahnen sowie der Schiffsverbindungen. Ein Spezialregister für die verschiedenen Städte und Ortschaften informierte über die direkten Anschlussstrecken. Die Bieler Stadtausgabe
enthielt eine Sonderbeilage mit den Ankunfts- und Abfahrtszeiten der städtischen Tram- und Buslinien.
Die Genauigkeit des Fahrplans erforderte die Zusammenarbeit von Hunderten von Personen, bis die ersten Fahrpläne im Entwurf fertiggestellt waren. Nur wenige Wochen standen zur Verfügung, um das
zahlreiche Material zu verarbeiten und im Satz zu erstellen. Nur wenige Tage blieben, um die definitiven Fahrplänen zu überarbeiten und den Druck der vielen Zehntausende von Exemplaren
durchzuführen. Um den Veröffentlichungstermin einzuhalten, sorgten mehrere Maschinen gleichzeitig für den Druck. Danach erfolgte das Falzen, Heften und Einbinden in den ebenfalls zu druckenden
Umschlag. Erst nachdem die Exemplare auf Spezialschneidmaschinen den sogenannten Beschnitt passiert hatten, war der Fahrplan versandfertig.[45]

Neues Domizil an der Freiestrasse 11
W. G. II entschloss sich 1898 zu einem Neubau an der Freistrasse wo er ein grosses Wohngebäude und dahinter eine geräumige Buchdruckerei errichtete. Im Seeländer Boten (25. 4. 1899)
teilte er mit: «Heute ist nun auch das Administrationsbüro des Seeländer Boten und des Journal du Jura von der Dufourstrasse an die Freiestrasse 11 übergesiedelt. Es befinden sich nun sämtliche
Büros und Ateliers der Buchdruckerei im Neubau.» Das Unternehmen konnte sich nun erfolgreich weiterentwickeln. Dazu gehörte auch das Aufrüsten von modernen Maschinen, denn bisher musste die
Zeitung von der erste bis zur letzten Seite von Hand gesetzt werden. In seiner Druckerei stand seit 1898 die zweite Setzmaschine der Schweiz. In tausend Einzelteile von Baltimore (USA)
angeliefert und in Holzkisten verpackt, musste die amerikanische «Simplex Lynotype Mergenthaler» zuerst montieren werden. Begleitet wurde die komplizierte Maschine nur von einer englischen
Gebrauchsanweisung.[20] Die drei Setzer Ernst Popitz (1850-1949), Cäsar Villars (1868-1953) und Robert Muster (1868-1953) machten sich mit Hilfe eines
Englisch-Wörterbuchs an die Arbeit. Einige Monate später rutschte in Biel die erste bleigeschlossene Setzmaschinenzeile in kunstvoll gestochener Schwabacher-Frakturschrift, Breite 16 ½ Cicero, in
Sammelschiff hinunter. ROBERT MUSTER bediente die Maschine 51 Jahre lang.[49]
Die Verschmelzung des Seeländer Boten mit den Seeländer Nachrichten zum Bieler Tagblatt
Durch die Übernahme des Tagblatt der Stadt Biel, der ältesten Zeitung des Seelands, entstand am 7. Juni 1904 das Bieler Tagblatt als freisinniges Organ und täglicher Anzeiger für Stadt und Land. Gleichzeitig wurde darin der Seeländer Bote integriert, der dadurch ebenfalls täglich erschien. Somit hiess die Zeitung Bieler Tagblatt und Seeländer Bote. Die Gratisbeilage Illustriertes Sonntagsblatt wurde beibehalten. Durch die Übernahme der Seeländer Nachrichten trug das Bieler Tagblatt ab dem 3. Juli 1904 die Untertitel «Seeländer Bote und Seeländer Nachrichten». Die Integration der beiden Zeitschriften brachten dem Bieler Tagblatt 2.500 neue Abonnenten. Gassmann bot einen günstigen Abonnentenpreis von nur 8 Franken jährlich an. Inserate von Abonnenten wurden besonders günstig berechnet. Die politische Richtung des Blattes blieb laut Redaktion und Verlag unverändert: «Das Blatt steht nach wie vor für einen gesunden, besonnenen Fortschritt auf politischem und wirtschaftlichem Gebiet ein.» In Biel wurden durch verschiedene Verleger insgesamt fünf Tageszeitungen herausgegeben. Während die Zeitungen früher alle auf Schnellpressen gedruckt und anschliessend gefalzt werden mussten, schaffte der Verlag Gassmann im Zuge der Rationalisierung 1907 als erster in Biel eine 8-Seiten-Zeitungsrotationsmaschine an. Bald folgten weitere.
Eine Stadt- und eine Landausgabe
Am 25. Oktober 1913 erschien in Biel das Konkurrenzblatt Seeländer Tagblatt vom Verlag Andres und Kradolfer, dessen Titel aus je einem Wort vom Seeländer Boten und vom Bieler Tagblatt zusammengesetzt war. Ab dem 1. Februar 1919 erhielt die Stadtausgabe den Titel Bieler Tagblatt und die Landausgabe Seeländer Bote. Der Inhalt war bei beiden Blättern identisch. Dieses sogenannte Kopfblattsystem ging darauf zurück, dass zu einem Blatt (Der Seeländer Bote) später die Herausgeberrechte eines zweiten (Bieler Tagblatt) hinzu kamen.[50] Im gleichen Monat brach in Gassmanns grossem Gebäude an der Dufourstrasse und in dem sich unter anderem die Büros der Agentur Publicitas befanden, ein Grossbrand aus. Die Mieter der oberen Stockwerke konnten aufgrund der Schnelligkeit des Feuers nichts von ihrem Mobiliar retten. Die beiden oberen Stockwerke wurden vollständig zerstört und der Rest des Gebäudes ziemlich stark beschädigt, sodass das Haus als verloren betrachtet werden musste.[51]
Die Buchdruckerei Gassmann schliesst ihre Tore
Im Jahr 1918 spürte die Firma die Folgen des Landesstreiks. Sämtliche Fabriken, Geschäfte und Wirtschaften in der Stadt Biel und der Umgebung wurden geschlossen – wenn nötig, auch mit Gewalt.
Arbeitswillige wurden von den Streikbefürwortern aus den Firmen herausgezerrt. Beim Bahnhof wurde das Zugpersonal von den Maschinen geholt. 33 patriotische Vereine zogen durch die Strassen Biels.
Zunächst bestand der militärische Schutz der Stadt aus drei Landsturmkompanien des Bataillons 1, später rückte das Militär ein. Schliesslich gab die Druckerei Gassmann ein Flugblatt heraus, in
dem verkündet wurde, dass der Streik beendet sei. Die Blätter wurden von Mitgliedern der Bürgerwehr an die Bevölkerung verteilt. Diese Leute wurden misshandelt. Die Unruhen gingen weiter. Die
Buchdruckerei Gassmann musste vorübergehend geschlossen werden, bis das Militär die Ordnung wiederherstellte.[23] Das Bieler Tagblatt (15. 11.
1918): «Das Bieler Tagblatt konnte während vier Tagen nicht erscheinen, auch uns hatte der Generalstreik gegen unseren Willen die Feder aus der Hand genommen.»
Am 1. Januar 1920 integrierte W. G. II das von ihm gekaufte Seeländer Tagblatt in den Seeländer Boten. So erhielten die Abonnenten statt des Seeländer Tagblatts nun den
Seeländer Boten. Am 1. 7. 1924 erhielt er das Verlagsrecht der Seeländer Nachrichten. Diese fusionierten mit dem Bieler Tagblatt und Seeländer Boten, das seinen Namen
weiterführte.
W. G. II sah sich aufgrund von Krankheitssymptomen gezwungen, beruflich kürzer zu treten. Längere Kuraufenthalte am Genfersee veranlasste ihn schliesslich, 1923 seinen Wohnsitz nach Montreux zu
verlegten. Sein jüngerer Bruder Charles Gassmann (1879-1954) sprang für ihn ein.[6] Als Seniorchef führte W. G. II die Druckerei ab 1. 1. 1926 als
Kollektivgesellschaft zusammen mit Charles unter dem Namen «W. & Ch. Gassmann». Diese umfasste die Buchdruckerei und das Verlegen des Journal du Jura, des Feuille d’avis de
Bienne et Neuveville, des Bieler Tagblatt und Seeländer Bote und des Fahrplans Guide Gassmann.
Familie:
W. G. II war von 1898 bis 1910 mit Lea Lisa Corbat von Bonfol verheiratet. Im gleichen Jahr heiratete er die Bielerin Berthe Pauline (25.11.1875-1963), geborene Moulin.[12] Berthe’s Vater starb bereits einige Monate nach ihrer Geburt. Nach dem Besuch der städtischen Primar- und Sekundarschule folgte sie ihrer ältesten Schwester
nach Übersee. Voll überwältigender Eindrücke kehrte sie 20jährig, wieder in die Schweiz zurück. Sie liess sich mit ihrer Mutter in Lausanne nieder, wo sie sich mit Hingabe ihrem Beruf als
Optikerin widmete. Nach ihrer Heirat mit W. G. II half sie im Zeitungsbetrieb mit.[48] Kinder: Marguerite Rosalie Louis (10. 10. 1903) und Jacques
Gassmann, Ingenieur an der Escuela Superior de Electricidad de Paris in Madrid.
Jagdleidenschaft
W. G. II war ein naturverbundener und waidgerechter Jäger. Um das ökologische Gleichgewicht beizubehalten, informierte er sich genauestens über den Wildbestand. Dazu zählte auch der Schutz des
vom Aussterben bedrohten Rebhuhns. Gottfried Müller berichtet: «Als ich 1904 dem Seeländischen Jagdschutzverein beitrat, war Vorstandsmitglied W. G. II Jagdschreiber. Seine Jagdprotokolle zeigten
echte Waidmannsdfreude und Sorgfalt. Er blieb der Jagd auch treu, als er in Montreux wohnte. 1930 war ich aus gesundheitlichen Gründen selbst monatelang dort und bald verbrachte ich meine Zeit
regelmässig bei ihm und seiner Frau zu Hause. Wir haben oft am heimeligen Kaminfeuer seines Arbeitszimmers gegessen und die heimatlichen Jagdprobleme diskutiert. An schönen Tagen nahm er mich mit
in seine waadtländischen Jagdgebiete, die Rohneebene, und erklärte mir seine Pflegemassnahmen, die kurzfristigen Bannbezirke, die Fasanenaufzucht und die Schongebiete für das Wasserflugwild. So
blieb er auch in der zweiten Heimat seinen jagdlichen Grundsätzen treu.»[12] Als seine Frau Bertha 1964 starb,
wählte sie die sozialen Institutionen Bieler Krippe, Wildermeth-Spital und Asile des Aveugles de Lausanne als Erben. Das Haus Dufourstrasse 17 wurde auf diese drei Institutionen übertragen. Durch
die grosszügige Gabe entstand der Kindergarten-Pavillon «Bertha Gassmann» und das alte Gebäude an der Bubenbergstrasse konnte renoviert werden. Das Haus an der Dufourstrasse 17 wurde 1967
abgerissen.
Schriften (Auswahl): 1902: ROBERT MOSER: Mémoire relatif à de nouveux projets de chemins de fer dans la région u Jura. 1904: Bieler Tagblatt, Tageszeitung (Serie). 1905: HAND KAMPF: Allerlei Technisches - Vorträge vom Technikum Biel; EMANUEL MARTIG: Geschichte des Bernischen Lehrersemiars zu Hofwil und Bern von 1883 bis 1905; LOUIS EGGER: Presse und Publikum. 1908: MAX GMÜR - Die Haftpflicht der Automobile; LOUIS-JACQUES CRELIER: Géométrie cinématique plane. 1909: KARL GEISER: Beiträge zur Geschichte des Wasserrechtes im Kanton Bern. 1910: JACOB WYSS: Die alten Wohnstätten des Gymnasiums in Biel. 1911: Bericht des Gemeinderates an den Stadtrat 1910 - Geschäftsbericht der Stadt Biel (Serie). 1912: In rei memoriam: manifestations officielles du pacifisme contre la guerre déclarée par l'Italie à la Turquie en septembre 1911. 1914: Die Schweizerischen Eisenbahnschulen. 1918: Neue Wind- und Wetterlehre. 1925: Paul-Henri Cattin - Memoriam. 1926: JOSEPH KRAUS: Festschrift zum fünfzigjährigen Jubiläum der Sektion Biel des Schweizer. Typographenbundes.
Die 5. Generation: Charles Gassmann (1879-1954)
Schüler am Progymnasium Biel von 1890 bis 1895, Geschäftsführer von 1936 bis 1954

Charles Gassmann wurde am 28. September 1879 im ehemaligen Pfarrhaus in Sutz geboren. Zunächst ergriff er den Beruf des Metzgers und führte eine eigene Metzgerei an
der Untergasse, unterhalb der Kirchterrasse. Am 25. Juni 1901 heiratete er Maria Helena Olga Laubscher (1880-1961) aus Täuffelen. Das junge Ehepaar entschloss sich, in die Vereinigten Staaten und
nach Kanada zu ziehen, um Erfahrungen in der Hotelbranche zu sammeln. In Toronto erfuhr Charles 1913 vom Tod seiner Mutter Rosalie. 1919 starb sein Töchterchen im Alter von 14 Jahren.[18] Im gleichen Jahr kehrten sie zurück und Charles trat in die Familien-Druckerei ein. Am 26. September 1921 kam Carl Wilhelm (Willy) zur Welt.
Das Team Wilhelm & Charles Gassmann
Charles leitete ab 1926 mit seinem Bruder Wlhelm die Firma «W. & Ch. Gassmann». Am 39-km-Ski-Dauerlauf auf dem Mont Solei 1950 stifteten die beiden den Pokal «Journal du Jura».
Schriften (Auswahl): 1926: SIEGFRIED FREY: Gedanken zur Demokratie. 1927: WILLIAM PIERREHUMBERT: Une fruitière du Haut Jura il y a
trois cents ans; JULES EMILE HILBERER: Poèmes de Grèce et d’Italie. 1928: HANS KUNZ: Öffentliche Vertragsurkunden und ihre Gültigkeit nach schweizerischem
Recht; 1929: ALI GROSLIMUND: Folletête 1865-1926, Biografie. 1931: GOTTFRIED HAGER: Warum sind wir Christen? - Gebrochene Augen klagen
an. 1932: WERNER BOURQUIN: Die Rebgesellschaft Twann-Ligerz-Tüscherz; HANS SCHÖCHLIN: Technische Schule und Verantwortung. 1933:
WERNER BOURQUIN: Die Bieler Presse von ihren Anfängen bis zur Gegenwart. 1934: HANS KELLER: Der elektrische Einäscherungsofen im Krematorium Biel.
Rasante technische Entwicklung
Charles führte das Geschäft vom 14. April 1936 bis 14. Mai 1946 als Einzelfirma. Ihm zur Seite stand OLGA als weitblickende Geschäftsfrau.[19] Auf
technischer Seite entwickelte sich das Unternehmen rasant: 1936 wurde die alte Rotationsmaschine von 1907 durch eine moderne 16-Seiten-MAN-Rotationspresse ersetzt, die 30.000 Zeitungen pro Stunde
drucken konnte. Sie stammte aus der Fabrik Augsburg-Nürnberg. Unter den Schriftsetzer-Lehrlingen befand sich Eugen Künzlee, der später Sportredaktor beim Bieler Tagblatt wurde. 1937
brachte die Druckerei Gassmann die erste Ausgabe des Romans Un homme à travers le monde. Lucien Marsaux erzählt von den Hoffnungen, Fehlern, Versuchen und Begeisterungen eines
Bauernsohns aus Solothurn, der in das ehemalige Bistum Basel ausgewandert ist. Die Geschichte spielt u.a. in Biel.[29]
Am 23. April 1941 installierte die Buchdruckerei Gassmann als 1. Bieler Firma einen Fernschreiber. Nun konnten die Nachrichten ohne Zeitverlust übermittelt werden. Ab 1946 leitete Charles die
Firma zusammen mit seinem Sohn Willy Gassmann (1921-1992). Im selben Jahr kamen zwei weitere Fernschreiber der englischen Firma Creed hinzu, einen für das Journal du Jura und einen für
das Bieler Tagblatt und den Seeländer Boten. Sie konnten die Nachrichten nur empfangen, daher bestanden zwei eigene Telefonleitungen zur Schweizerischen Depeschenagentur in
Bern. Der Siemens Fernschreiber war sowohl zum Empfang wie auch zum Senden eingerichtet. Er vermittelte die Nachrichten der beiden Agenturen United Press und Exchange Telegraph. Um
schnellstmöglich die Sportnachrichten zu erhalten, installierte Gassmann auf den Sportplätzen Gurzelen in Biel und Brühl in Grenchen eigene Telefonanschlüsse. Zusätzlich wurde ein Botendienst
eingerichtet. So konnte im Sonntagsextrablatt die neusten Sportresultate veröffentlicht werden.[50]
Die 16-Seiten Rotationsmaschine MAN von 1936. Repr. aus Wirtschaftsgeschichte der Stadt Biel, 1948, S. 395
Die Zweitouren-Schnellpresse Kelly 2 con 1947. Repr. aus Wirtschaftsgeschichte der Stadt Biel, 1948, S. 395

Bis 1946 wurde das Bieler Tagblatt morgens gedruckt. Von der Druckerei aus fuhr man mit eigenen Autos zu den Ablagestellen im Seeland. Von dort aus besorgten die Zeitungsausträger den Zustelldienst noch vor dem Mittag. Als die Post einen dritten Zustelldienst einführte, verzichtete man auf das eigene Verträgersystem und überliess die Auslieferung der Post. Die Zeitungen wurden nun nachts gedruckt, sodass sie die Briefträger bei Dienstantritt austragen konnten.[42] Der Inseratenteil verwaltete die Annoncenfirma «Publicitas AG» an der Dufourstrasse, mit der der Verlag Gassmann ein vertragliches Pachtsystem verband. Im Sommer 1947 erhielt die Buchdruckerei eine moderne Zweitouren-Schnellpresse. Auf ihr wurde 1948 für den Zürcher Verlag H. Diriwächter das Buch Bieler Wirtschaftsgeschichte gedruckt. [50] Das qualitativ hochstehende Werk erschien im Quartformat, auf glänzendem Kunstdruckpapier und in schöner Antiqua-Schrift. Der Einband trägt das Wappen Biels.[50] Am 1. Januar 1949 konnte das 100-jährige Bestehen des Seeländer Boten mit einer Sondernummer gefeiert werden.
Treffen der 1879er Progymnasialklasse des Dufourschulhauses Biel
Am 7. Mai 1944 nahmen 20 ehemalige Progymnasialschüler und der Lehrer Louis Gueniat (gest. 1951) am traditionellen Klassentreffen teil. Sie wurden vom Organisator Charles Gassmann freudig begrüsst. Anschliessend erfolgte ein Ausflug nach Twann. Der Augenarzt und Sänger Franz Della Casa (gest. 1949) und Karl Walker erfreuten die Schulkameraden mit einigen eindrucksvollen Liedern.
In seiner Freizeit war Charles Gassmann Präsident vom Buchdruckerverein Biel-Seeland, Mitglied des Kirchenrats der christkatholischen Kirche und von 1936 bis 1951 Vorstandsmitglied des kantonalbernischen Zeitungsverlegerverbands,[18] Am 20. Juli 1951 feierten er und OLGA die goldene Hochzeit. Nach seinem Tod am 28. Dezember 1954 übernahm Sohn Willy (1921-1992) die Betriebsleitung.
Schriften der Buchdruckerei und des Verlags Ch. Gassmann (Auswahl): 1935: Willy Gassmann 1873-1935. 1936: LUCIEN MARSAUX: Le Renouveau; 50 Jahre Seeclub Biel 1886-1936; 25 Jahre christliche Studentenvereinigung Bern. 1937: Le problème de la navigation fluviale suisse: brochure offerte par l'Association suisse de navigation du Rhône au Rhin; GRETI, WEHRLI-FREY: Bi Römers am See; LUCIEN MARSAUX: Un homme à travers le monde: roman; GEORGÉ CAMILLE: Lueurs de rampe: théâtre; B. MOSER und EDUARD LANZ: Freiwilliges Arbeitslager Petinesca; WERNER BOURQUIN: Die Kirchgemeinde Twann in der Refomationszeit. 1938: ALBERT SCHLUEP: Chantons: un nouveau manuel de chant scolaire; GIOVANNI RUFFINI: Aus der grossen Zeit des Grenchenbades; WERNER BOURQUIN: Schießwesen und Schützenfeste in Biel; Actes de la Société Jurassienne d’Émulation 1937; GIOVANNI RUFFINI: Aus der grossen Zeit des Grenchenbades; HENRI JOLIAT: Essai du l’archéologie et l’histoire du Jura bernois. 1939: FRITZ DENZLER: Der Römertunnel: eine Erzählung aus dem Seeland zur Römerzeit. 1940: Regionale Ausstellung des Schweiz. Kunstvereins 1940 in Solothurn; ADOLF KÜRY: Rituale der Christkatholischen Kirche der Schweiz; ANDRÉ RAIS: Un Chapitre de chanoines dans l’ancienne Principauté épiscopale de Bâle: Moutier-Grandval. Tome I. 1942: WERNER BOURQUIN: Die Apotheker im alten und neuen Biel. 1943: ROBERT BAUDER: Communes jurassiennes à travers deux crises et une guerre; ROBERT BAUDER: La situation financière des communes franco-montagnardes et des communes industrielles du Jura Sud et les moyens propres à leur venir en aide. 1944: CHARLES NOYER: La kératose arsénicale et le cancer arsénical. 1946: PAUL WEISS: Die Heimarbeit in der schweizerischen Uhrenindustrie. 1947: HANS HUTZLI: Beitrag zur Kenntnis der Darmstrongylose der Ziegen 1948: RENÉ FELL: Wirtschaftsgeschichte der Stadt Biel. 1949: WERNER BOURQUIN: Oberst Eduard Will, Gründer der Bernischen Kraftwerke. 1950: WERNER BOURQUIN: Jakob Rosius, Astronom, Kalendermacher, Mathematiker und Lehrer. 1951: Seebutz - Heimatbuch des Seelandes und Murtenbiets mit Kalendarium (Serie) 1952: ANDRÉ RAIS: Les trois fontaines monumentales de Porrentruy; HANS MÜLLER: Krone Aarberg. 1953: Christkatholisches Kirchenblatt (Serie); HANS MESSERLI: Schwermetallwirkungen auf die Erythrocytenpermeabilität und ihre Beziehung zur Frage der Potentialgifttheorie.
Epilog: Der in Biel geborene Willy (Carl Wilhelm) Gassmann (26.9.1921-17.3.1992), Sohn von Charles und Olga Gassmann, absolvierte in Basel und Genf eine umfassende Ausbildung zum Buchdruckerberuf. 1954 übernahm er nach dem Tod seines Vaters Charles Gassmann die Firma an der Freiestrasse. Willy heiratete am 25. Juni 1943 die Grenchnerin Elsbeth Mary Wittmer (geb. 25.6.1921). Sie war die Tochter von Max Otto und Marie Born. Das Paar hatte drei Kinder: die Töchter Ursula und Maja Elsbeth (geb. 26. 11. 1951) sowie den Sohn Marc. Von 1956 bis 1982 amtierte er als Präsident des EHC Biel und führte die Mannschaft 1978 und 1981 zum Sieg als Schweizer Meister. Er war Mitbegründer der Bieler Kunsteisbahn, die 1958 mit 5.000 Zuschauer eingeweiht wurde. 1958 drehte W. G. einen Film über das Eidgenössische Schützenfest in Biel. Unter der Leitung von W. G. konnte 1973 das Eisstadion in Betrieb genommen werden, das über die erste überdachte Eisfläche in Biel verfügte. Er unterstützte 25 Jahre als Kassierer und Verwaltungsmitglied die «Genossenschaft Kunsteisbahn». 1965 war er der OK-Präsident des Bielfestes, über das Bundespräsident Hanspeter Tschudi sagte: «Ich habe noch selten ein so schönes Volksfest erlebt.»[60] W. G. präsidierte mehrere Jahre lang den Yachtclub Bielersee, der ihn zum Ehrenpräsidenten ernannte.

Für die Braderie war er als Präsident und Pressechef tätig. Für die 10. Braderie lud er die Redakteure von 50 Zeitungen ein und machte das Fest damit im ganzen Land bekannt. Er war Mitglied des Panathlon Clubs Biel und des Curling Clubs Biel. Auch in der Faschingszunft, die ihm 1956 die Ehrenmitgliedschaft verlieh, war er zeitweise als Präsident tätig. Gassmann: «Nach dem Krieg waren grosse Schwierigkeiten zu überwinden, um das Brauchtum zu neuem Leben zu erwecken.» So erfand er für die Faschingszunft den populären Apachenball.[59]
Die Unternehmung Gassmann entwickelte sich im Laufe ihrer Geschichte zum führenden Medienhaus der Region Biel-Seeland.[61] 1954 modernisierte W. G. vom Bieler Tagblatt die Druckschrift und wechselte von der Frakturschrift zu einer besser lesbaren lateinischen Schrift (Antiqua). 1955 übernahm er die Verlagsrechte vom L'Express und dessen Redakteure Paul Schaffroth und Jean-Pierre Maurer, die in die Redaktion des Bieler Tagblatts, bzw. des Journal du Jura eintraten. Somit haben sich die Verlagshäuser Bieler Tagblatt/Seeländer Bote, Journal du Jura und Express zusammengeschlossen. 1961 erfolgte die Errichtung einer Pensionskasse und Felix Märkli wurde zum ersten «Chefredakteur» ernannt. Am 17. April 1962 beschloss der Gemeinderat die Herausgabe eines Neuen Bieler Jahrbuchs, dass in der Folge bei der Druckerei und im Verlag Gassmann herauskam.
«Die Stadt Biel arbeitet eng mit dem Verlag Gassmann zusammen,
z.B. bei der Herausgabe des Bieler Jahrbuches oder des Amtsanzeigers.»
Hans Stöckli, ehem. Stadtpräsident von Biel, Bieler Tagblatt, 31. 10. 1994
Seit 1966 ist das Bieler Tagblatt die einzige deutschsprachige Tageszeitung in der Stadt Biel. Es erfolgte die Gründung der Annoncen Agentur AG und die Eröffnung einer Lokalredaktion in Lyss mit Sekundarlehrer Max Gribi als Redakteur.[61] Am 1. September 1972 erfolgte der Anschluss an die amerikanische Nachrichtenagentur «Associated Press».
Die Druckerei Gassmann und der Altstadtleist Biel: Postkartenkollektion, anlässlich der Altstadtchilbi erstmals erschienen 1969. Plakate der Altstadtchilbi, des
Chlausers und des Altstadtlaufs (31x65 cm, schwarz und rot).
Willy Gasmanns Sohn Marc (geb. 1948) trat 1972 der Firma bei. Ab 1975 war er Technischer Direktor und aus der bisherigen Einzelfirma «W. Gassmann» wurde eine Aktiengesellschaft. Am 27. März
1979 wurde M. G. Alleinverleger des Bieler Tagblatts und des Journal du Jura. Gleichzeitig wurde er zum Delegierten des Verwaltungsrates der Buchdruckerei W. Gassmann AG
ernannt. [55] Im Privatleben wirkte M. G. u.a. als Burgerrat- und Forstkommissionspräsident der Burgergemeinde Biel und war zehn Jahre Mitglied der Braderiekommission. Ab 1976 arbeitete bei
Gassmann die erste Industriebuchbinderin der Schweiz, Susanne Loder aus Lyss. Als Reaktion auf die 1978 bei Cortesi erschienene Bieler Gratis-Wochenzeitung Biel/Bienne, lancierte W. G. die
Gratis-Wochenbeilage Donnerstags-Blatt/Jura-Jeudi, die in rund 90.000 Haushalte geliefert wurde. Am 20. Februar 1979 stellte die Buchdruckerei vom hundertprozentigen Bleisatz auf ein
computergesteuertes Satzsystem um, das zu den modernsten Europas gehörte. Auf dem Bildschirm «setzten» flinke Tasterinnen bis zu 20.000 Buchstaben pro Stunde.[53]
Ab dem 2. Juli 1980 erhielt das Bieler Tagblatt erstmals Seitenzahlen.[56] 1982 musste M. G. die Leitung des Betriebes übernehmen, nachdem der
langjährige Direktor tödlich verunglückt war. Der bis dahin dem Donnerstag-Blatt beigegebene unterhaltende Teil, wurde durch eine täglich erscheinende, neu konzipierte «Mosaik»-Seite ersetzt.
1983 wurde der Versand des Bieler Tagblatt und des Journal du Jura auf Computer umgestellt. Ab 29. Februar 1984 sendet das von einer Gruppe Journalisten gegründete Lokalradio
Canal 3, vorerst ohne die Beteiligung von Gassmann und Cortesi.

1989 kam der Umzug ins Druckereizentrum Bözingenfeld. Das Unternehmen erhielt eine 160 Tonnen schwere 64-Seiten-Offsetrotationsmaschine, die vierfarbig druckte. Die Druckgeschwindigkeit verdoppelte sich dadurch auf 30.000 Exemplare pro Stunde. M. G. wurde Mitglied im Verwaltungsrat der Schweizerischen Depeschenagentur AG (SDA). In einer zweiten Bauetappe entstand 1991 im Bözingenfeld ein Verlagsneubau, der 1993 bezogen werden konnte. Die Qualitätsdruckerei und die neuen Produktionsanlagen führten zu Aufträgen für hochwertige Werbeprospekte au der Uhrenindustrie. Zu Gassmanns Kunden zählten bald Firmen wie Certina, Rolex, Longines, Rado, Movado und Zenith. 1991 übernahm Gassmann die Wochenzeitung Le Jura Bernois/Feuille d’avis de Saint-Imier et du Vallon (Saint Imier).
Der Übergang von der sechsten zur siebten Generation erfolgte 1992 mit dem Tod von Willy Gassmann. Bieler Tagblatt und Journal du Jura richteten sich neu aus. Aus den betont bürgerlichen Blättern wurden sogenannte überparteiliche, in denen alle politischen Strömungen zu Wort kamen.[58] Gassmann übernahm 1992 mit 55 % Aktienkapital L'Impartial (La Chaux-de-Fonds). Ab 1993 druckte Gassmann das Konkurrenzblatt Biel-Bienne von Mario Cortesi. 1994 erfolgte der Abriss des ehemaligen Gassmann-Gebäudes an der Freiestrasse und die vor über 200 Jahren gegründete Druckerei Courvoisier trat der Gassmann-Gruppe bei. Als erstes Unternehmen der grafischen Branche in der Region Bielseeland wurde die W. Gassmann AG 1995 mit dem Qualitätssicherungs-Zertifikat ausgezeichnet. Ab 1995 besorgte die Druckerei die Herstellung der LTV-Telefonbücher. Im gleichen Jahr gründen die Medienunternehmen Canal 3, Büro Cortesi und W. Gassman AG das zweisprachige TeleBielingue. Die Idee war, ein neues Sprachrohr für Biel, das Seeland und den Berner Jura zu schaffen. Die Konzession wurde 1997 erteilt. TeleBärn reichte beim Bundesrat Beschwerde ein. TeleBielingue ging am 15. März 1999 auf Sendung.
Ebenfalls 1999 entstand auf Initiative der W. Gassmann AG. die Internetseite «Regionales Gedächtnis Biel-Seeland». 2000 zog das Unternehmen ins Medienzentrum am Robert-Walser-Platz, wo man nun die Redaktionen Bieler Tagblatt und Journal du Jura unterbrachte. Als die W. Gassmann AG ihr 150-Jahr-Jubiläum feierte, lud das Unternehmen 20 Autorinnen und Autoren dazu ein, eine Lokalgeschichte zu verfassen. Diese sind im Geschenkband Zeitgeschichte zusammengefasst und können in einer erweiterten Fassung beim «Regionalen Gedächtnis» abgerufen werden. 2002 erfolgte der Druck vom Expo.02 Journal, das sechsmal pro Woche zwischen 15. Mai und 20. Oktober in allen Bahnhöfen und auf den Arteplages auflag. Das Expo-Tagebuch des Verlags W. Gassmann AG erinnerte die Leserinnen und Leser an 159 Expo.02-Tage.[54] Journal du Jura, L'Express (La Chaux-de-Fonds) und L'Impartial (Neuchâtel) begannen 2003 auf redaktioneller Ebene zusammenzuarbeiten. Später gesellte sich Le Quotidien Jurassien (Delémont) dazu. Die Inseratenkombinationen «Presse 99» (Bieler Tagblatt mit Berner Zeitung und Solothurner Zeitung) sowie «Romandie combi» (Journal du Jura mit L'lmpartial, L'Express, Le Quotidien Jurassien, La Liberte und Le Nouvelliste trugen zur positiven Entwicklung der beiden Tageszeitungen bei.[52]

2006 wurde das «Regionale Gedächtnis» in «Mèmreg» umgetauft. 2007 kam die Akquisition von Canal 3: Die Radio Bilingue AG erwarb 2/3 der Aktien von Radio Canal 3. Im neu konstituierten Verwaltungsrat von Canal 3 amtete Marc Gassmann als Präsident. 2008 erhielten TeleBielingue und Radio Canal 3 die Konzession nach neuem RTVG.[61] 2009 wurde der Verlag «W. Gassmann AG.» zur «Gassmann Media AG». 2012 ging Gassmann im Zeitungsrotationsdruck eine langfristige Zusammenarbeit mit dem Druckzentrum der Büchler Grafino AG ein und stellte den Betrieb der Zeitungsrotationsmaschine in Bözingen ein. Das Bieler Tagblatt und das Journal du Jura werden nun in Bern gedruckt. Nicht betroffen von der strategischen Neuausrichtung war das Geschäftsfeld Kunden-Akzidenzdruck von Gassmann und der Courvoisier Arts Graphiques SA für hochwertige Kataloge, Broschüren und Bücher. In Bözingen arbeiteten im Akzidenzdruckbereich rund 80 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Betrieb verfügt über leistungsfähige und modernste Produktionsanlagen mit Veredelungsmöglichkeiten und Weiterverarbeitungsanlagen. 2012 erwirbt Gassmann die Landwirtschafts- und Naturzeitung Zeitung Terre & Nature.[67] M. G., Verleger und Eigentümer der Gassmann-Gruppe, übertrug 2013 die operative Geschäftsführung an die Unternehmensleitung. Am «European Newspaper Congress» in Wien 2017 wurde das Bieler Tagblatt mit vier «Awards of Excellence» für Fotografie und Gestaltung ausgezeichnet. 2019 feierte TeleBielingue sein 20-jähriges Jubiläum. 2018 erhielt Gassmann von der Stadt Biel die Konzession für die Herausgabe des Amtlichen Anzeigers.
Ende 2020 verkaufte M. G. die Mediengruppe Gassmann an den Walliser Unternehmer Fredy Bayard. In dem Unternehmen arbeiten rund 280 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen Druck, Print-, Online- und elektronische Medien, Verwaltung, Marketing und Verkauf.[61] Martin Bühler: «Wenige Wochen später wurde Marc Gassmann von einer unabhängigen Jury der Wochenzeitung Biel Bienne zum Bieler des Jahres 2020 gekürt. Sein Name stehe nicht nur für viele Jahrzehnte unabhängigen Journalismus. Er habe mit dem Verkauf auch dafür gesorgt, dass der Bieler Journalismus nicht von Zürich, Bern oder Lausanne aus gesteuert werde. Damit endet die 7. Generation der Familie Gassmann. Die Geschichte der traditionsreichen Bieler Medien geht weiter, untrennbar verbunden mit dem Namen Gassmann.»[58] 2021 wurde Gassmann Media alleiniger Inhaber von TeleBielingue. Ab 2022 kooperiert das Unternehmen mit CH Media und präsentiert sich auf dem Internetportal «Ajour.ch». 2023 spannten die Radiosender RJB und Canal 3. Als 2024 das Bakom die Konzession für TeleBielingue nicht erneuern wollte, unterschrieben 5544 Personen die Petition «TeleBielingue, unsere regionale Identität». Anbieter, welche keine Konzession erhalten dürfen weitersenden aber ohne finanzielle Unterstützung vom Bund. 2025 feierte das Medienhaus Gassmann am Walserplatz 7 der Tag der offenen Tür und 175 Jahre Bieler Tagblatt.

Unterhaltungslektüre in Fortsetzung
Ab 1897 erschienen im Feuilleton des Seeländer Boten Fortsetzungsromane und Erzählungen. Sie wurden zum traditionellen Bestandteil der Firma Gassmann. Der erste war Reinhold Ortmanns
Krimi Im Hause des Verderbens, der sich über 48 Tage erstrecke. Fortsetzungen erschienen auch in der im Seeländer Boten beigelegten Illustrierte Sonntagsblatt. Der 1904 im
Seeländer Boten begonnene Roman Der Sturm fand seine Fortsetzung im Bieler Tagblatt, das diese Tradition weiterführte. Die Geschichten erstreckten sich zunächst auf
einen Zeitraum von zwei Monaten und noch länger. E. von Der Haves Wer ist sie? (1910) fesselte die Leser 83 Tage. Hier lohnte sich das Abonnement. Mit der Zeit reduzierten sich die
Beiträge, etwa H. Hesses Tatsachenroman Der Untergang der Titanic - Erlebnisse eines Geretteten (1914, 7 T.).
Im Bieler Tagblatt waren talentierte Schweizer Autorinnen und Autoren zu lesen, Dazu zählt die ehemalige Kellnerin Rosa Weibel aus Radelfinden, die durch einen Unfall Schriftstellerin
wurde. Sie verfasste die Werke Im Schweigenalphüttchen (1906, 7T), Es hat einen anderen viel lieber als mich! (1906, 5 T.) sowie Agnes Wieland (1919, 25 T.). Der Bieler
A. Stucki brachte Bitzius, der Türkenprinz (1909, 3 T.). Fritz Denzler, Velomechaniker in Täuffelen, schrieb Der Römertunnel (1939, 8 T.), In Not und Tod - Das Schicksal
eines Volkes (1940, 8 T.) sowie Julia Alpinula (1942, 7 T.).

Nationalrat Hans Müller aus Aarberg veröffentlichte den historischen Roman Berner im Kampf (1957, 85 T.), der während der Franzosenzeit im Seeland
spielt. Von der Bieler Dichterin Marguerite Janson zeigte das Sonntags-Beilage ihren mit dem Literaturpreis ausgezeichneten Gegenwartsroman
Auburg und das Tal (1958, 13 T.) und Gestern waren wir Kinder (Juni 1960, 33 T.). Die Lysser Dichterin Ida Frieda Gerber-Gysi brachte den im Seeland spielenden Roman Als das
Wasser kam (1964, 35 T.) und Troika (1967, 45 T.), der in der Stadt Bern angesiedelt ist. Der in Biel geborene Schriftsteller Franz Hohler berichtete über Die Rückeroberung
(1992, 30 T.).
Zu den internationalen Autorinnen und Autoren zählten Georg Okonkowski (Drehbuchautor von «Die blonde
Geisha» mit Im Schatten der alten Hansestadt (1905, 55 T.) und der im Alter von 30 Jahren verstorbene
Heinrich Schaumberger mit Im Hirtenhaus (1908, 40 T.). Adolf Stark, Autor von Wer tat es? (1908, 5 T.) starb am 2. 5. 1943 im Ghetto Theresienstadt.

Mehrere Frauen veröffentlichten ihre Werke unter einem männlichen Pseudonym (Maximiliane Von Weissenthurn als «Max», Gertrud Jähne als «Gert Rothberg», Jenny Hirsch, eine der Führerinnen der Frauenbewegung in Deutschland als «Fritz Arnefeldt», Ottilie Söllner, Böhmische Erzieherin und Schriftstellerin, als «C. Vollbrecht».) Ein Beitrag der in Hamburg geborenen Jüdin Lola Stein lautete Die schwarze Kugel (1921).
Von der deutschen Schriftstellerin Anny Wothe-Mahn , die 1882 die Frauenzeitschrift Deutsche Frauenblätter gründete, erschienen im Bieler Tagblatt 21 Geschichten: Die Frauen von Sundsvallhof (1916, 37 T.), Strandgut (1916, 45 T.), Hallig Hooge (1919, 28 T.), Ragna Svendburg (1919, 30 T.), Seegespenster (1920, 32 T.), Mechthild vom Mörth (1920, 14 T.), Kinder des Rheines (1921 37 T.), Die goldene Brücke (1923, 17 T.), Zauber-Runen (1926, 37 T.), Von fremden Ufern (1927, 36 T.), Die rote Burg (1927, 37 T.), Bob Heil! - Ein Wintersportroman aus St. Moritz (1928, 38 T.), Auf blauen Wogen (1928, 33 T.), Das Land der Tränen (1928, 30 T.), Die weisse Frau (1929, 30 T.), Ins Sonnenland (1929, 44 T.), Und doch (1929, 27 T.), San Martino (1930, 18. T.), Am roten Kliff (1931, 37 T.), Sturmvögel (1932, 41 T.), Die Sonnenjungfer (1932, 30 T.)
Für Spannung sorgte Agatha Christies Es geschah vor 16 Jahren (1965) und Das Böse unter der Sonne (1989). Hitchcock-Drehbuchautor Ben Hecht erzählte Geschichten aus Chicago und Hollywood (1992, 50 T.)
Collection «Gassmann» im Archiv Altstadtleist Biel, 2025
Schriften der Buchdruckerei und des Verlags «W. Gassmann» und «Gassmann Media AG» (Auswahl): 1955: RENÉ FELL: Le curieux destin d’une ville: Bienne, son passé, son présent, son avenir. 1956: Cornichons Biennois - Die offizielle Fasnachtszeitung (Serie); WERNER BOURQUIN: Das Gesicht der Stadt Biel und eines Marktes, einer Gasse, eines Hauses; WERNER BOURQUIN: Rockhall; HANS MÜLLER: Berner im Kampf. 1958: MARCUS BOURQUIN: Die St. Peters-Insel in der Kunst Franz Niklaus Königs. 1963: Neues Bieler Jahrbuch - Nouvelles annales biennoises 1962 (Serie). 1965: FRITZ ALLIMANN-LAUBSCHER: Geschichte der Dampfschifffahrt auf dem Bielersee; MARIE-CHRISTINE RYHINER: Heiteres und Beschauliches vom Bielersee. 1967: Jugend und Sport/Jeunesse et sport: revue d’éducation physique de l’Ecole fédérale de gymnastique et de sport Macolin (Serie); OTTO M. WENGER: Gedanken über dies und das; KURT WILD: Export - unser Schicksal. 1969: OTTO ARN: Seeländische Ortsnamen. 1971: Willkomme in Biel, 2. Aufl.; 75 Jahre Faschingszunft Biel; RENÉ BROTBECK: Die Chorfenster der Stadtkirche Biel. 1974: RENÉ FELL: Mes âges. Les années de formation. 1976: ROBERT AEBERHARD: Fachausdrücke aus Politik und Wirtschaft. 1977: ROBERT AEBERHARD: Politisches Vokabular, aktualisierte Fassung. 1978: Gymnasia Biennensis 1903-1978. 1980: ROBERT AEBERHARD: Kirchen im Seeland. 1982: Willkommen in Biel, 3. Aufl.; GWERDER, LIECHTI, MEISTER: Die Geschichte der Schifffahrt auf den Juragewässern. 1986: ROLF NEESER: Biel/Bienne - Bilder einer Region. 1988: ANDREAS URWEIDER: Rolf Neeser - Vieille Ville de Bienne. 1989: Der Seebutz - Heimatbuch des Seelandes und Murtenbiets; PAUL HERTIG: Der Ausnahmefall Leben; MARIO CORTESI: Biel - Bienne: die Stadt am See = la ville au bord du lac = the city on the lake. 1990: 100 Jahre Ingenieurschule Biel/100 ans Ecole d'Ingénieurs Bienne; HANS HERRLI: Dem Geheimnis Pflanze auf der Spur; VALENTIN CRASTAN: Die Energiepolitik im Spannungsfeld von Ökologie und Fortschritt; WERNER MARTI, Ds Johr uus; PETER WSSBROD: Hommage au Théâtre, 1991: HERVÉ GAUVILLE, ANDREAS MEIER, BERNHARD FIBICHER: Tabula Rasa - 25 Künstler im Stadtraum Biel. 1992: JEAN-CLAUDE KUNZ: Kunz. 1993: RUDOLF WEHREN: Sara lächelt - eine seltsame Geschichte; WERNER HADORN: Die Geschichte der Gemeinnützigen Gesellschaft Biel. 1994: Die Grenzbrigade 3: 1938-1994, Kunst und Kommunikation; Hundert Jahre FDP der Schweiz; LUTZ EICHENBERGER: Die Eidgenössische Sportschule Magglingen 1944-1994; MARGRIT WICK-WERDER, PIETRO SCANDOLA, WILLY SCHELLENBERGER: 100 Jahre Elektrizitätswerk Biel/100 ans Service de l’électricité de Bienne; FRED TELLER: Rockhall in Biel. 1995: HEINZ-PETER KOHLER: H. P. Kohler - Eine Künstlermonographie; RICHARD PAUL LOHSE: La construction est le tableau. DANIEL DE COULON, JEAN-ROLAND GRAF: Biel zwischen Bielersee und Berner Jura. 1996: WERNER HADORN: Der Geist von Biel, PETER RENATUS: 100 Jahre FC Biel-Bienne: 1896-1996. SCHWYN, STUCKI, ZIEGELMÜLLER: Seeland - Sehland; ROLAND KUHN: Ernst Kuhn - Biel-Bienne, Photographies. 1997: MARGRIT WICK-WERDER, MONIQUE HELFER, 100 Jahre Faschingszunft Biel, HEINZ GRIEB, WERNER MARTI: 50 Jahre Schulhaus Linde; JEAN-CLAUDE KUNZ: Mes voyages intérieurs. 1999: FLAVIA TRAVAGLINI: Die Katastrophe der Neptun, MARIO CORTESI: Sie veränderten Biel - Ils ont changé Bienne; ANDREAS TSCHERISCH: Bieler Tramwartehäuschen 1927-1941; WERNER und MARCUS BOURQUIN: Biel, Stadtgeschichtliches Lexikon; KURT FRIEDRICH HUBACHER: Das Johanniter-Rebgut zu Twann. 2000: MARGRIT WICK-WERDER: Spuren einer Stadt; ROBERT MEISTER: La vie d‘Albert Anker, au fil de sa correspondance; MATTHIAS NAST: Zeitgeschichte: Geschichten in der Zeitung. 2001: BÉAT APP: Chasseral - roi des sommets; ERNST BÜHLER: Natursteinmosaike. 2002: Expo.02: das Tagebuch/Livre du Bord; DENISE WITTWER HESSE: Die Familie von Fellenberg und die Schulen von Hofwyl. RUDOLF WEHREN, GIANNI VASARI: Schöne Stadt. 2004: MARGRIT und MARKUS WICK-WERDER, MADELEINE BETSCHART: Museum Schwab Biel - Das archäologische Fenster der Region; MARGRIT WICK-WERDER: Brunnen-Büchlein; DIETER STAMM: Tod in Biel. 2005: MARGRIT WICK-WERDER, RENÉ VILLARS: Einst, jetzt: Bieler Stadtansichten = Hier, aujourd'hui: Bienne en images; WERNER HADORN: Biel-Bienne - La ville bilingue au bord du lac; DIETER STAMM: Bänziger und andere Geschichten; BÉAT APP: Das Seeland - Dem Wasser nach; NIKLAUS BASCHUNG: Hilfe, wir sind glücklich, JEAN-CLAUDE KUNZ: Mes souffrances, mes passions, mes colères. 2006: DIETER STRAMM: Amarie von Biel 2008: Was aus mir wurde - Ce que je devenais; WERNER HADORN: Hans Stöckli und zwanzig Jahre Bieler Stadtentwicklung. 2009: BÉAT APP: Drei-Seen-Land - seine Weinberge und Hügel. 2010: SABINE KRONENBERG: Elisabeth Weyeneth: eine Mordbrennerin; RETO C. PADRUTT: 175 Jahre Berner Kantonalbank 2013: AUBERSON, WICK-WERDER; KAESTLI: Bieler Geschichte, Bd. I-II; THIERRY LEJARDS: La Téne, un Site, un Mythe, Bd. I-II. 2014: BEAT MONING: EHC Biel - 75 Jahre. 2015: THEO MARTIN: 600 Jahre Spital Biel; REGINE FREI: Finale im Nebel. 2016: WERNER HADORN: Gemeinnützige Gesellschaft Biel 1891-2016. 2017: PETER RENATUS: Handball in Biel: wie aus HBC und HC Gym der HS Biel wurde; BÉAT APP, MARKUS SCHÄR: Fisch, Mensch, Natur. 2022: ANDRIN ALBRECHT: Ausbruch - Kurzgeschichten aus Biel und dem Seeland
Quellen/Sources: 1) Werner Bourquin, «Die Buchdruckerei Gassmann» in Bieler Tagblatt, Biel, 11. 1. 1957, S. 3; - 2) «Besitzerwechsel der Buchdruckerei Gassmann» in Seeländer Bote, Biel, 23. 5. 1863, S. 1; - 3) Walter Senn-Holinghausen, «Wilhelm Gassmann» in Schweizer Zeitbuch 1892, St. Gallen, 1893, S. 111; - 4) Fritz Probst, «Die traditionsreiche Geschichte der Buchdrucker-Familie Gassmann» in Bieler Tagblatt, Biel, 2. 12. 1989, S. 21; - 5) Walter von Arx, «Ein Zeitungsschreiber vor 100 Jahren» in Sonntagsblatt der Bund, 25. 1. 1891, S. 27f; - 6) «Wilhelm Gassmann» in Bieler Tagblatt, Biel, 6. 11. 1935, S. 1; - 7) Willhelm Tell: ein Trauerspiel. Der Wohlthaetige Murrkopf: ein Lustspiel, die kleine Aehrenleserinn: ein Singspiel, aufgeführt von den Hochoberkeitlichen Schulen zu Lucern im Brachmonat 1778, Luzern, 1778; - 8) Martin Gisi, Französische Schriftsteller in und von Solothurn, Solothurn 1898, S. 39; - 9) Werner Bourquin, «100 Jahre Buchdruckerei Gassmann Biel» in Bieler Tagblatt, Biel, 1. 2. 1949, S. 2-7; - 10) Johann Mösch, «Franz Josef Gassmann als Erziehungsschriftsteller», Mitteilungen des Historischen Vereins des Kantons Solothurn, Band 9, 1919, S. 128ff; - 11) Leo Altermatt, «Briefe des Verlages Jent & Gassmann in Solothurn an Jeremias Gotthelf in Lützelflüh» in Jahrbuch für Solothurnische Geschichte, Band 9, Solothurn, 1936, S. 77ff; - 12) Werner und Marcus Bourquin, Biel Stadtgeschichtliches Lexikon, Büro Cortesi, Biel 1999; - 13) Willy Gassmann, Buchdrucker und Verleger, 1873-1935, Biel, 1936, S. 5ff, - 14) «Chs. & W. Gassmann Biel-Bienne» in Biel-Bienne: Wirtschaftsgeschichte von Biel, Diriwächter, Zürich 1948, S. 392ff; - 15) W. Aeberhardt, «1841: Eine Solothurner Offizin druckte Meisterwerke der Weltliteratur» in Der Bund, Bern, 30. 3. 1941, S. 103; - 16) Dr. Fr. Lang, Die Einsiedelei und die Steinbrüche bei Solothurn, Solothurn, 1885, S. 5; - 17) «Eheverkündigung von Franz Joseph Amatus Gassmann und Marianne Bay» in Intelligenzblatt der Stadt Bern, 11. 11. 1840, S. 3; - 18) H. «Charles Gassmann-Laubscher - Verleger und Buchdrucker» in Bieler Tagblatt, Biel, 29. 12. 1954, S. 1; - 19) «Olga Gassmann-Laubscher» in Bieler Tagblatt, Biel, 1. 4. 1961, S. 3; - 20) Matthias Nast, Zeitgeschichte - Geschichten in der Zeitung, Druck und Verlag Gassmann, Biel, 2000; - 21) Werner Bourquin, 50 Jahre in der Buchdruckerei Gassmann, 9. 9. 1933, Biel, S. 1; - 22) M. B., «Ein Besuch in der Einsiedelei» in Jurablätter: Monatsschrift für Heimat- und Volkskunde, März, Derendingen, 1971, S. 43ff; - 23) «Buchdruckerei Gassmann vorübergehend geschlossen» in Tagblatt des Grossen Rates des Kantons Bern Jahrgang 1918, Bern 1919, S. 789ff; - 24) «Urs Joseph Lüthy» in Neuer Nekrolog der Deutschen, 1. Teil, 1838, Weimar 1840, S. 3ff; - 25) Dr. Karl Dändliker, Geschichte der Schweiz, Band 3, Zürich, 1895, S. 149; - 26) Der Freyheitsfreund oder das alte helvetische Tagblatt, 29. 10. 1799, S. 111; - 27) «Ferdinand Gassmann» in Bieler Tagblatt, Biel, 12. 6. 1924, S. 2; - 28) Dr. Albert Kuntzemüller, «Biel im schweizerischen und internationalen Eisenbahnverkehr» in Bieler Tagblatt, Biel, 15. 8. 1947, S. 4; - 29) Buchbesprechung «Un homme à travers le monde» in L'impartial, La Chaux-de-Fond, 28. 8. 1937, S. 3; - 30) «Hans Gassmann» in Bieler Tagblatt, Biel, 28. 6. 1915, S. 2; - 31) «Paul Gassmann», Journal du Jura, Biel, 28. 9. 1945, S. 2; - 32) Walther von Arx, «Ein Zeitungsschreiber vor hundert Jahren» in Der Bund, Sonntagsblatt, Bern, 22. 2. 1891, S. 62; - 33) Franz Joseph Gassmann I, Kurzer und leichtfasslicher Unterricht über die helvetische Staatsfassung in verschiedenen Gesprächen zwischen einem Patrioten und Antipatrioten, Solothurn, 1798, S. 7ff; - 34) Petra Schröder, «Rüttenen, Waldpark Wengistein», S. 88, PDF; - 35) Johann Mösch, «Der Ruf nach einem Mädcheninstitut» in Mitteilungen des Historischen Vereins des Kantons Solothurn, Band 9, Verlag der Buchdruckerei Gassmann, Solothurn, 1918, S. 141ff; - 36) Leo Altermatt, Die Buchdruckerei Gassmann A. G. Solothurn, Solothurn 1939, S. 74ff; - 37) Korn, «Rede auf der Solothurnischen Schaubühne» in Solothurnisches Wochenblatt, Solothurn, 10. 5. 1788; - 38) Letizia Schubiger-Serandrei, Laurent Louis Midart 1733?-1800, Kunstmuseum Solothurn, 1992; - 39) Franz Joseph Gassmann I, «Vorläufiger Versuch des Solothurnischen Wochenblatts» in Solothurner Wochenblatt, Band I, Jahrgang 1788, Sammlung Zentralbibliothek Solothurn, Sign. X R. 19; - 40) «Wappen von Buchdrucker Gassmann» in Nachlass Paul Boesch, Burgerbibliothek Bern, abgerufen 2025; - 41) «Übernahme von Distelis Werken» in Börsenblatt für den deutschen Buchhandel, Nr. 81, Leipzig, 10. 9. 1844; - 42) Fritz Allimann-Laubscher, «Die Gassmann von Solothurn und Biel», Bern, 1968, Staatsarchiv Kanton Bern, Sign. C 341; - 43) Rudolf Baumann, Ein Beitrag zur Geschichte der solothurnischen Buchdruckerei und der solothurnischen Zeitungen bis zum Jahr 1848, Balstahl, 1909, S. 16ff; - 44) Franz Joseph Gassmann, «Gefängnisreise» in Helvetischer Hubridas, Solothurn, 24. 3., 1798, S. 59; - 45) «Vom Guide Gassmann und von Fahrplänen im allgemeinen» in Bieler Tagblatt, 6. 5. 1933, S. 5; - 46) «Presseprozess gegen Gassmann» in Tagblatt der Stadt Biel, Biel, 19. 2. 1898, S. 4; - 47) Ulrich Ochsenbein, Das Gottesgericht und meine Verleumder, 1878, Bern, S. 3f; - 48) «Frau Berthe Gassmann-Moulin» in Bieler Tagblatt, Biel, 22. 6. 1963, S. 3; - 49) «Ehrung langjähriger Maschinensetzer» in Bieler Tagblatt, Biel, 30. 1. 1970, S. 18f; - 50) «100 Jahre Seeländer Bote», Jubiläumsausgabe, Biel, 1. 2. 1949, S. 2-18; - 51) «Grand incendie à Bienne» in La national suisse, 4. 2. 1919, S. 3; - 52) Marc Gassmann, «Firmenchef in siebter Generation» in Der Geist von Biel, Biel, 31. 8. 1994, S. 5; - 53) hsp., «Vom Blei zum Computer» in Bieler Tagblatt, Biel, 11. 6. 1980, S. 18; - 54) «Bieler Chronik», Bieler Jahrbuch 2001, Satz und Druck: W. Gasmann AG, Biel 2002, S. 314; - 55) Willy Gassmann: «In eigener Sache» in Bieler Tagblatt, Biel, 27. 3. 1979, S. 3; - 56) «Bieler Tagblatt erhält Seitenzahlen» in Bieler Tagblatt, Biel, 2. 6. 1980, S. 1; - 57) «Lehrlings-Preisbewerbung» in Journal für Buchdruckerkunst, 18. 10. 1871, S. 37 / 20. 3. 1872, S. 12; - 58) Martin Bühler, «Gassmann: 240 Jahre Kommunikation» in Bieler Jahrbuch 2000, S. 83ff; - 59) «Verleger Wilhelm Gassmann gestorben» in Bieler Tagblatt, Biel, 19. 3. 1992, S. 1; - 60) Fritz Probst, «Verleger Willy Gassmann feiert den 70. Geburtstag» in Bieler Tagblatt, Biel, 20. 9. 1991, S. 11; - 61) «Unsere Geschichte» in Gassmannmedia.ch, abgerufen 2025; - 62) Tobias Kästli, «Anarchosyndikalisten, Sozialdemokraten und Grütlianer» in Bieler Jahrbuch 1979, Druck: W. Gassmann AG, Biel, 1980, S. 23; - 63) Wilhelm Gassmann I, «Kreisschreiben des antretenden Central-Komites» in Grütlianer, Bern, 8. 8. 1866, S. 1; - 64) Werner Bourquin, «Biels politische Parteien» in Bieler Tagblatt, 18. 9. 1974, S. 3; - 65) A. T., «100 Jahre Grütlimännerchor Biel» in Bieler Tagblatt, Biel, 22. 9. 1949, S. 2; - 66) «Abgeordnetenversammlung der Grütlianer» in Der Grütlianer, Bern, 20. 6. 1866, S. 1
Postadresse: Altstadtleist Biel, Obergässli 11, 2502 Biel/Bienne. Lokal: Brunngasse 11, Tel. 032 323 42 84,
Öffnungszeiten auf Anfrage
Adresse postale: Guilde de la vieille ville, Ruelle du Haut 11, 2502 Biel/Bienne. Local: Rue des Fontaines 11, Tel: 032 323 42 84.
Heures d'ouverture sur demande.


























