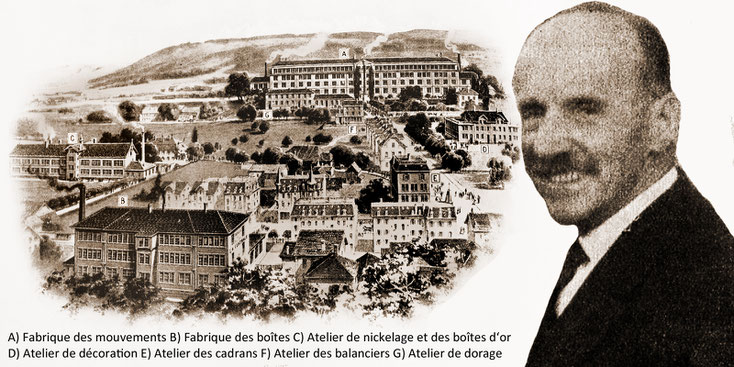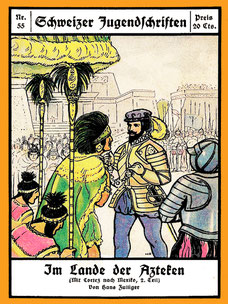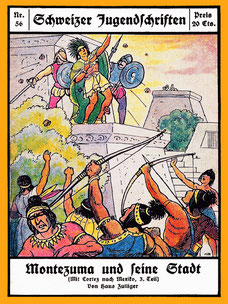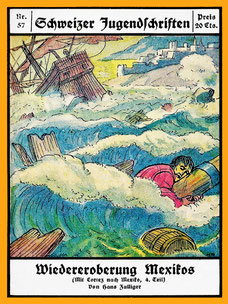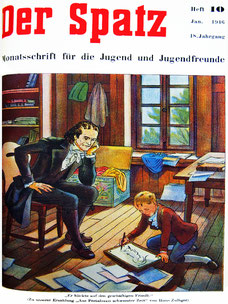- Brunngasse / Rue des Fontaines
- Burgplatz / Place du Bourg
- Burggasse / Rue du Bourg
- Jakob-Rosius-Strasse / Rue Jakob-Rosius
- Kanalgasse / Rue du Canal
- Kirchgässli / Ruelle de l'Eglise
- Obergasse / Rue Haute
- Obergässli / Ruelle du Haut
- Quellgasse / Rue de la Source
- Ring
- Römergässli / Rue des Romains
- Schmiedengasse / Rue des Maréchaux
- Untergasse / Rue Basse
- Untergässli / Ruelle du Bas
- Juravorstadt / Faubourg du Jura
- Mühlebrücke / Pont du Moulin
- General Dufour-Strasse / Rue du Général-Dufour
- Das Dufour Schulhaus - Überblick
- Das Dufour Schulhaus - Kloster und Spital
- Das Dufour Schulhaus 1818-1819
- Das Dufour Schulhaus - Abram-Emmanuel und Edouard Tièche
- Das Dufour Schulhaus 1818 - Louis Agassiz
- Das Dufour Schulhaus 1818 - Oberst Friedrich Schwab
- Das Dufour Schulhaus 1820-1827
- Das Dufour Schulhaus 1828-1835
- Das Dufour Schulhaus - Lehrer in geheimer Mission
- Das Dufour Schulhaus 1836-1838
- Das Dufour Schulhaus 1837 Jean Joseph Hisely
- Das Dufour Schulhaus 1839-1842
- Das Dufour Schulhaus 1843-1849
- Das Dufour Schulhaus 1845 Albert Friedrich Haller
- Das Dufour Schulhaus Kinder der Fabrik
- Das Dufour Schulhaus 1850-1869
- Das Dufour Schulhaus - Armin und Arnold Mueller
- Das Dufour Schulhaus 1870-1880
- Das Dufour Schulhaus 1881-1887
- Das Dufour Schulhaus - Die Buchdruckerfamilie Gassmann
- Das Dufour Schulhaus 1885 - Hermann Aegler
- Das Dufour Schulhaus - Die Bieler Bijouteriefamilie Weber
- Das Dufour Schulhaus 1887 - Karl Walser
- Das Dufour Schulhaus 1888 Robert Walser I
- Das Dufour Schulhaus 1888 Robert Walser II
- Das Dufour Schulhaus 1888-1891
- Das Dufour Schulhaus 1891 Grock
- Das Dufour Schulhaus 1892 - Gottlieb Hauser
- Das Dufour Schulhaus 1892-1895
- Das Dufour Schulhaus 1896-1898
- Das Dufour Schulhaus 1893 - Eduard Amsler
- Das Dufour Schulhaus 1896 - Hermann Hubacher
- Das Dufour Schulhaus 1897 - Emil Meyer
- Das Dufour Schulhaus - Die Familie Lanz
- Das Dufour Schulhaus 1897 - Fritz Antenen
- Das Dufour Schulhaus 1899-1903
- Das Dufour Schulhaus 1904-1905
- Das Dufour Schulhaus 1902 Werner Bourquin
- Das Dufour Schulhaus 1902 - MAURICE UND ANDRÉ VAUCHER
- Das Dufour Schulhaus 1903 - Hans Zulliger
- Das Dufour Schulhaus 1903 - Hans Zulliger II
- Das Dufour Schulhaus 1905 - Karl Schoechlin
- Das Dufour Schulhaus 1906-1908
- Das Dufour Schulhaus 1908 - Hans Schoechlin
- Das Dufour Schulhaus 1909-1910
- Das Dufour Schulhaus 1951-2011
Das Dufour-Schulhaus / L' école Dufour 1903


Dr. h. c. med. und phil. Hans Zulliger (1893-1965), Lehrer, Schriftsteller, Berner Mundart-Lyriker, Heilpädagoge, Pionier der
Kinder- und Jugendpsychologie
Schüler vom Progymnasium Biel von 1903 bis 1908
Die Eltern: Die Zulligers waren in Madiswil heimatsberechtig.[82] Vater Alfred Zulliger (9. 11. 1865-15.5.1939) wurde als ältester Sohn
einer Uhrmacherfamilie in Moutier im Berner Jura geboren. Von dort kam er als Schulkind nach Madretsch. Er erlernte den Beruf eines Remonteurs und arbeitete danach in der «Omega», wo ihm das
Zeugnis eines flinken, zuverlässigen und exakten Arbeiters ausgestellt wurde. Zeitlebens erzählte er gerne von den damaligen schönen Zeiten in der Uhrmacherei. Alfred: «In der Fabrik war man
nicht so angestellt, wie man heute angestellt ist. Es war noch nicht Pflicht, auf die Minute pünktlich zu erscheinen, die Kontrollmarke in die Kontrolluhr zu stecken und dann ebenfalls auf die
Minute pünktlich die Arbeit niederzulegen und zu gehen. Es konnte vorkommen, dass die Leute den ganzen Tag fischen gingen und erst am Abend, spät in der Nacht, ihre Arbeit
verrichteten.»[11]
Vater Alfred Zulliger war einer von 1500 Mitarbeiter der Uhrenmanufaktur Omega in Biel.

Alfred Zulliger heiratete am 29. 10. 1892 Klara Rosa De Simone (6. 10. 1868-14.2.1954) aus Balmuccia[82], die als Diamantschleiferin bei der Firma Samuel Fuchs & Louis Monney, Diamantenstrasse 9, angestellt war. Inzwischen hatte sich die Uhrenindustrie modernisiert. Spezielle Maschinen erledigten die Arbeit ebenso präzise, aber zwölfmal schneller als ein Handarbeiter. Trotzdem kam die Krise. Alfred wechselte den Beruf und fand in Biel Arbeit in der Reparaturwerkstatt der damaligen Jura-Simplon-Bahn. Seine Uhrmacherhände brauchte er nun für die Reparatur und Herstellung der Dampfheizungskupplungen, deren Konstruktion er übrigens zusammen mit Grossrat Kuenzi selbst erfunden oder zumindest wesentlich verbessert hatte. Da die Krise sämtliche Zweige der Uhrenindustrie betraf, musste auch Klaras Firma «Fuchs & Monney» vorübergehend schliessen. Um ein regelmässiges Einkommen zu erhalten, versuchte sie es mit Heimarbeit. Im Gedicht «My Muetter» erwähnt Hans Zulliger, dass sie oft bis spät in die Nacht arbeitete. Sie war trotz ihrem hohen Arbeitspensum von fröhlicher Natur, sang viel und brachte den Kindern Verse bei.[23] Ab 1892 [82] wohnte Alfred im Bauerndorf Mett und war im «Adressbuch von Biel und Umgebung» als «Werkstattarbeiter» geführt. Hier hatte er sich mit seinen Ersparnissen ein Stück Land erworben und darauf ein Haus gebaut. Um die steigenden Lebensmittelpreise zu umgehen, versorgten sich die Zulligers mit eigenem Gemüse und Kleintieren. Sie betrieben so etwas Landwirtschaft, wobei ihnen ihre vier Söhne halfen.[7] Hans Zulliger: «Das Haus hatte einen Stall- und Scheunentrakt. Wir züchteten, Ziegen, Schafe, Kaninchen, Hühner und pflegten einen grossen Gemüse- und Blumengarten.»[23] Im Männerchor Mett wurde Alfred Vizepräsident. 1899 wählte man ihn in die Schulkommission. Alfred Zulliger beeindruckte seine Mitmenschen mit zahlreichen einfachen, aber genialen Erfindungen, die ihm jedoch keine finanziellen Gewinne einbrachten. Sein grösster Wunsch, dass aus seinen vier Söhnen etwas Rechtes werden sollte, ging in Erfüllung:
- Hans Alfred (21.2.1893-18.10.1965) wurde Volksschullehrer, Dialektschriftsteller und Jugendpsychologe (siehe Hans Zulliger)
- Werner Hugo (13.07.1899-31.10.1966) arbeitete ab 1919 als Lehrer in Studen bei Biel. 1937 gab er die Lehrerstelle auf, um Wirtschaftswissenschaften zu studieren, welches er 1943 abschloss. Da er sich sehr für Radiotechnik interessierte, leitete er von 1933 bis 1957 sein Geschäft «Zulliger Radio» an der Dufourstrasse 44 in Biel. Später übernahm er eine Versicherungsagentur und wurde staatlich konzessionierter Immobilien-Treuhänder. Er wohnte im Elternhaus am Hubelweg 14 in Madretsch. Er war Mitglied der Bieler Technikumsverbindung «Kyburgia Biennensis» und mit der Lehrerin Emilie Ryser verheiratet. Sie veröffentlichte als Schriftstellerin Geschichten fürs Schultheater in der Jugendborn-Sammlung. Die Ehe blieb kinderlos.
- Albert Romuald (29.3.1904-8.3.1988) wurde Tarifbeamter bei der Bern-Lötschberg-Bahn-Verwaltung (BLS). Am 5. April 1934 heiratete er in Basel die Baslerin Rosa Glaser (1904-1991). [85] Zu ihren Kindern zählen Erika Alice (*22.2.1938) und Robert Albert (*11.8.1944). Er starb 1988 in Liebefeld, Gemeinde Köniz.
- Walter Robert (21.4.1910-30.10.1990) besuchte in Biel ebenfalls das Progymnasium, das sich allerdings nicht mehr im Dufourschulhaus befand. Er schloss sein Studium 1935 an der Universität Bern mit dem Staatsexamen für das höhere Lehramt in den Hauptfächern Mathematik und Physik sowie in den Nebenfächern Versicherungslehre und Pädagogik ab. Dann liess er sich von seinem Bruder Hans in die Psychologie, Erziehungsberatung und Testmethoden einführen. Er wurde Mathematiklehrer und Direktor des Unterseminars Küssnacht.

Alfred ging mit 67 Jahren in den Ruhestand. Als eifriger Bastler und Imker lebte Alfred seit 1902 [82] in seinem Haus in
Madretsch am Hubelweg/Chemin de la Colline 14, dessen Grundriss er übrigens selbst entworfen hatte (wie schon zwei frühere Häuser). Zum Haus gehörte ein grosser Gemüse- und Blumengarten. Noch
heute ist es durch den Gemeinschaftsgarten «Abre à palabres» und den Passarellen-Park mit der Natur verbunden. Mit Unterstützung von Ariane Tonon, ehemalige Lehrerin am Dufourschulhaus, konnte
sich das Quartier erfolgreich gegen eine künftige Überbauung wehren. Besondere Freude und Genugtuung bereiteten Alfred Zulliger die wissenschaftlichen und schriftstellerischen Erfolge seines
ältesten Sohnes Hans Zulliger.[11]
Hans Alfred Zulliger wurde am 21. Februar 1893 in Mett geboren. Das Bauerndorf wurde wie Madretsch 1920 nach Biel eingemeindet und gehörte vorher zum Amt Nidau. Die stetige Quartierentwicklung von Mett liess nur wenige Bauernhäuser stehen. Der Dorfkern zeigt noch heute ein schönes Ensemble mit Kirche, Pfarrhaus, Bauernhaus und dem ehemaligen Primarschulhaus von Hans Zulliger. Hier war sein Vater Alfred ab Januar 1900 Mitglied der Schulkommission. Der Gottfried-Ischer-Weg erinnert an Gottfried Ischer (1832-1896), der als Pfarrer von Mett möglicherweise Hans Zulliger getauft hatte.
Das ehemalige Bauerndorf Mett (links), altes Bauernhaus von 1827 (mitte) und Hans Zulligers ehemaliges Primarschulhaus von 1838 (rechts).
«Während meiner Progymnasialzeit fand mein Zeichnungslehrer,
ich hätte Talent für die bildenden Künste und müsse Maler werden.»
Hans Zulliger, Mein Curriculum vitae in Das magische Denken des Kindes, 2022 [87]
Strenger Unterricht im Progymnasium Biel
Von 1903 bis 1908 besuchte Hans Zulliger das Progymnasium Biel, das bis 1910 im Dufourschulhaus untergebracht war. Hier lernte er beim Volksdichter Arnold Heimann (1856-1916) im Deutschunterricht
die Behandlung ausgewählter prosaischer und poetischer Werke und das Auswendiglernen von Gedichten. Zu seinen Klassenkameraden gehörten Alfred Boll (1891-1960), Ehrenmitglied des
Bürgerturnvereins Biel, August Engel (1892-1994), Ehrenmitglied der Musik- und Feldschützengesellschaft Twann, Walter Janser (1892-1973), Ehrenmitglied des Fußballklubs USBB, sowie Ernst Wyss
(1893-1955), Direktor der Eidgenössischen Steuerverwaltung.
Er schloss Freundschaft mit Werner Kasser, der von 1903 bis 1906 die Parallelklasse besuchte und ihn 1963 in der Biographie «Hans Zulliger» verewigte. Kasser erwähnt
darin: «Im Progymnasium herrschte ein strenges Regiment, das sich, wenn es sein musste, mit dem Meerrohr, dem Arrest und mit dem Karzer durchsetzte. Dem Schulmeister oblag es, die Delinquenten
einzusperren und nach Ablauf der Strafe wieder freizulassen. Die Stimme des Schulleiters erreichte im Trubel des Pausenbeginns und -endes auch den hintersten Schüler, obwohl er dessen Namen nicht
kannte und ihn nur mit ‹Du Mensch› anredete. In verschiedenen Fächern wurden wir regelrecht gedrillt. Seine zeichnerischen Fähigkeiten verdankte er dem Zeichenlehrer und Kinderbuchautor
Alexis William Schneebeli (1874-1947). Zulliger
beherrschte das Kornett. Er wurde ins Kadettenkorps eingezogen und der Musik zugeteilt».[23] Als Hans Zulliger später Lehrer war, äusserte er sich darüber:
«Ich wünsche mir keine Klasse ohne Lausbuben, denn etwas Lebendiges und Antreibendes würde fehlen.» Vielleicht lag es daran, dass Hans im Dufourschulhaus selbst ein kleiner Lausbub war: «Es gab
einen Lehrer, der uns für jede Kleinigkeit nachsitzen liess. ‹Eine Stunde Arrest!› war sein geflügeltes Wort und wir grinsten darüber. Da wir sowieso nachsitzen mussten, erfanden wir Streiche. Es
war uns egal, dass wir in seinen Augen als Saubande galten, was er uns immer wieder zu verstehen gab. Beim Nachsitzen flog eine Knallerbse an die Tafel. Als sich der Lehrer, rot vor Wut, sich
darüber erkundigte, wusste niemand etwas davon. Er hatte auch keine Ahnung, wer ihm Leim auf den Sessel gestrichen und Löwezahnsamen in sein Gartenbeet gesät hatte. Keine Schlingelei war
uns zu klein, wenn wir ihn nur ärgern konnten. Der Frechste wurde einmal vor den Rektor zitiert und bekam zwei Stunden Karzer. Aber er galt unter uns als ein Held. Der bedauernswerte Lehrer
ändert daraufhin seine Strafen. Er liess uns 100 bis 500 Mal den gleichen Satz schreiben, und einer von uns musste das Strafregister führen. Wir entschädigten den Kameraden dafür, dass er das
Register zu unseren Gunsten falsch führte und die Strafaufgaben machten wir gemeinsam. Wir akzeptierten die Strafen weil sie uns Gerecht erschienen.»[52]
Wenn die Eltern abwesend waren, verbachte Hans seine Zeit in Orpund bei der Familie Ernst Kuhn, die mit seinen Eltern befreundet war. Die Kuhns lebten von der
Landwirtschaft und hatten auch eine Uhrmacherwerkstatt. Mit Grossvater Kuhn ging Hans regelmässig fischen.[7] Zulliger: «Auf meinem Strohhut trug ich als
leidenschaftlicher Fischer immer ein Stück Schnur, Köder und eine oder zwei Angeln. Mein Taschengeld von 50 Rappen war in einem Taschentuch eingewickelt. Um es aufzubessern, fischte ich ein paar
Barsche aus der Aare und verkaufte sie einem Stadtherrn für 80 Rappen. Dieses Geld gab ich dann für Karusselfahren aus. Als mein Vater fragte, wo ich war, sagte ich ‹Beim Rösslispiel!›. Wie hätte
er wohl reagiert, wenn er gehört hätte, dass ich 80 Rappen verjubelte. Als er mich fragte, wieviel Taschengeld ich noch übrig hatte, zog ich das Taschentuch hervor und zeigte das Geld mit den
Worten: ‹Noch die ganzen 50 Rappen!›.»[47] Mit der Zeit verdiente sich Hans durch das Fischen ein ansehnliches Taschengeld. Als er sich beim Fischen mit dem
Lehrer Lienhardt von Meienried anfreundete, besuchte er ihn in der Volksschule. Da entstand in ihm der Wunsch, auch Lehrer zu werden.[7]
Ausbildung am staatlichen Lehrersemnar Hofwil
Im Kanton Bern gab es damals fünf öffentliche Lehrerseminare, nämlich in Hofwil, Pruntrut, Hindelbank, Delsberg und die Seminarabteilung der städtischen Mädchensekundarschule in Bern. Das
Fellenberghaus in Hofwil diente von 1884 bis 1905 als staatliches Gesamt-Seminargebäude und danach als ländliches Unterseminar. Zusammen mit dem städtischen Oberseminar Bern bildete es das
«Seminar Hofwil-Bern». Die Ausbildung zum Primarlehrer erfolgte zwei Jahre im Unterseminar Hofwil und zwei Jahre im Oberseminar Bern. In das Seminar wurden Sekundarschüler und gute Primarschüler
aufgenommen. Als Mitglied der «Kommission der Lehrerbildungsanstalten» wirkte der Bieler Stadtpräsident Gottfried Reimann (1862-1909). Vorsteher des Unterseminars und Lehrer für Naturkunde und
Mathematik war Johann Josef Stauffer (1865-1936), ehemaliger Primarschulinspektor in Schüpfen.
Dr. Ernst Schneider (1878-1957) war vom 5. April 1905 bis 1916 Direktor des Lehrerseminars, Vorsteher des Oberseminars und Lehrer für Pädagogik. Erziehungsdirektor Gobat wählte ihn, da dieser unter allen Kandidaten der einzige mit einer pädagogischen Fachausbildung war. Zudem lehnte der strenge Bieler Progymnasiumsdirektor Jakob Wyss (1856-1931), die Stelle ab. Gobat zu Schneider: «Unsere Schule ist veraltet. Sie bedarf dringend einer Auffrischung im Sinne Pestalozzis. Wir erwarten von Ihnen einen neuen pädagogischen Ansatz für die Volksschule. Unsere Lehrer haben zu wenig Gemüt.» Die Aufnahmeprüfungen in Hofwil änderte er so ab, dass sie eine vorhandene Begabung statt möglicherweise eingedrilltes Wissen erfassten. So rückten die Fächer Sprachen und Mathematik in den Vordergrund.[97]
Ehemaliges Unterseminar Hofwil, Zustand 2025. Fotos: P. K.
Hans Zulliger bildete sich von 1908 bis 1910 am Unterseminar Hofwil und von 1910 bis 1912 im Oberseminar in Bern zum Primarlehrer aus. Kasser: «Dort tauschte er sein
Horn gegen eine Violine, verzichtete aber auf den Wunsch Musiker oder Kunstmaler zu werden, weil er möglichst schnell von der Hilfe seiner Eltern unabhängig werden wollte.»[23] Den Alltag der Seminaristen basierte auf der Schneiders Idee der sogenannten «Arbeiterschule» und wurde auf Fotos auf der Schweizerischen Landesausstellung 1914
festgehalten: «Die Seminaristen beschäftigen sich im Garten und auf der Wiese, graben Kartoffeln und sägen Holz. Klassen lernen im Park Hofwil Geschichte, Stillehre im Berner Münster oder
skizzieren im Freien ein stehendes Pferd. Sie absolvieren Samariterkurse, bauen physikalische Apparate, reisen ins Gebirge und überqueren Gletscher. Sie bilden sich vielseitig durch die Natur und
aus dem Leben aus und nicht bloss aus Büchern. Schulen, die diese Vielseitigkeit und Konsequenz der neueren pädagogischen Anschauungen umsetzen, gibt es wenige.»[91] Ernst Schneider: «Die Spannungen zwischen dem Schulinspektorat und dem Seminar hingen mit den allgemeinen pädagogischen Auseinandersetzungen zusammen, die
damals unter der Parole Arbeitsschule gegen Lernschule ausgefochten wurden. Es stand einer mechanistischen Lehr- und Erziehungsauffassung eine organisch-dynamische gegenüber.»[97]
1946 erschien das Erinnerungsbuch «100 Jahre Münchenbuchsee-Hofwil-Bern», in dem die Seminarzeit durch Beiträge von Ehemaligen fortlebt. Darin schrieb Zulliger: «1908 traf ich in Hofwil meinen
Bieler Kumpel Schörschel, der drei Jahre zuvor bei uns Kadetten Oberleutnant gewesen war. Er sagte ‹Ich habe in Hofwil schon in der ersten Woche insgesamt Fr. 2.50.- Busse zahlen müssen, weil wir
das Licht immer zu lange brennen lassen. Bei uns in Bern berechnet man keine Busse und man ist wegen des Direktors überhaupt viel freier.› Bald sah ich Schneider persönlich, als er beim
Mittagessen in Hofwil erschien. Er trug eine gestrichelte Hose und eine dünne Golduhrenkette an der Weste. Ab 1910 waren wir im Oberseminar Bern und hatten den Direktor Schneider als Lehrer. Es
vergingen keine zwei Wochen, da wäre jeder für ihn durchs Feuer gegangen. Er behandelte uns wie Erwachsene und nicht wie Kinder. Mit seinem feinen, kleinen Lächeln erreichte er mehr als jemand,
der eine Moralpredigt hielt oder einen Beschwerdebrief an den Vater schickte. Wenn man jung ist, hat man allerlei Zweifel. Man traut sich vieles nicht und in vier Jahren steht man vor einer
Klasse und muss zeigen, was man kann. Da braucht man jemanden, der an einen glaubt. So einer war Direktor Schneider.» [96] Nach seiner Ausbildung zum Primarschullehrer hätte Zulliger die
Möglichkeit gehabt, an der Universität Bern eine zweijährige Ausbildung zum Sekundarlehrer zu machen, was er jedoch nicht tat.
«Ich weiss nicht, ob es nur ein Scherz war, als man behauptete, durch Hans Zulliger
wisse man in vielen Ländern wohl von Ittigen, ohne eine Ahnung von Bern zu haben.
So ist die geografische Bezeichnung ‹Bern bei Ittigen› gar nicht so aussergewöhnlich!»
Erwin Heimann, Einwohnergemeinde Bolligen, Erinnerungsschrift 31. 12. 1982, S. 33
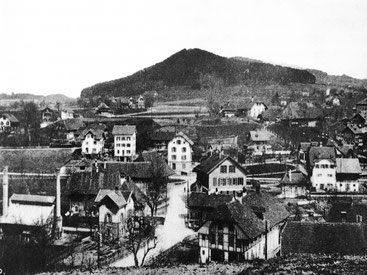
47 Jahre Lehrer in Ittigen
1912 erhielt er mit knapp 19 Jahren sein Lehrerpatent und war nun verpflichtet in der Gemeinde zu wohnen, in der er unterrichtete. Hans Zulliger: «Wir erbwarben unser Lehrerpatent und wurden an
Stellen in den Städten und vor allem in den Dörfern gewählt, bezogen bei Bauern und Handwerkerleuten ein Zimmer und assen an einem fremden Familientisch oder mit anderen Kostgängern zusammen in
einer Gastwirtschaft.»[76] 1912 wurde er Lehrer der Primarschule am Rain des Bauerndorfes Ittingen wo er bis 1959 unterrichtete. Sein Arbeitgeber war die
sogenannten «Viertelsgemeinde Ittigen»[115], zu der auch Kappelisacker, Worblaufen, Papiermühle, Schermen und Neuhaus gehörten. Mit einem Monatslohn von 135
Franken war Zulliger nicht auf Rosen gebettet. Als Deutschlehrer am Progymnasium in Biel hätte er mit einem Jahreseinkommen von mindestens 3600 Franken deutlich mehr verdient. Ein eigenes
Fahrzeug oder Auto besass er nicht.

Zulliger: «Wenn ich in der Schule mein Seeländer Berndeutsch sprach, erregte es bei den Kindern Heiterkeit, weil es anders klang als das Mittelländische. Ich nahm mir zuerst vor, es zu lernen, um vor meinen Schülern nicht komisch zu wirken. Dazu liess ich die Leute Bantiger Geschichten erzählen und prägte mir ihre Ausdrucksweise ein».[7] Später wurde er von den unteren in die oberen Schuljahre versetzt. Einen Unterbruch als Lehrer erlebte er im Ersten Weltkrieg, wo er als Soldat die Juragrenze bewachte und als Unteroffiziersschüler im Lehrbataillon der 3. Division nach Delsberg kam. 1953 wurde er als Offizier aus der Wehrpflicht entlassen.[7] Zugezogen von Brügg wohnte er vom 30. November 1913 im Ortsteil Papiermühle an der Asylstrasse 9.[115] Nachdem er genug Geld zusammengespart hatte, bezog er 1926 sein eigenes Haus an der Asylstrasse 19 (heute Zulligerstrasse), in dem er bis 1965 lebte.[76]
Hans Zulliger gibt Unterricht in Ittigen. Foto: Burgerbibliothek Bern, Sig. N Eugen Thierstein 343 14 / 16, CC BY 4.0
«Auf Spaziergängen führt Hans Zulliger mit seinen Schülern lebensnahe,
pädagogische Gespräche, die er Spaziergang-Behandlung nannte.»
Reinhard Fatke, Psychoanalytische Pädagogik in Romanform, 2021, S. 3 [86]
Für seine Schüler war Hans Zulliger nicht nur Lehrer, sondern auch Vertrauter und Berater. Auch seinen jüngeren Kollegen stand er mit Rat und Tat zur Seite. Ein
«Nein» oder «Keine Zeit» war von ihm nie zu hören. Wer sich verirrte oder in eine Sackgasse geriet, den führte Zulliger wieder auf den rechten Weg zurück.[17] Die folgende Anekdote zeigt den Zusammenhalt zwischen Lehrer und SchülerInnen. Hans Zulliger: «In den Herbstferien teilte mir ein Mädchen aus meiner Klasse mit,
dass eine meiner Schülerinnen im Spital gestorben sei. Sie bat mich, mit den Mitschülern ein Lied einzustudieren, das wir der Verstorbenen am Grab singen würden. Ich war einverstanden, wenn sie
die Mitschüler zusammenbrächte und am Abend genügend Stimmen vorhanden wären. Ich bezweifelte, dass das in den Ferien möglich sein würde. Am Abend fand ich die Klasse fast vollzählig vor. Wir
studierten ein Lied ein und gingen zwei Tage später zur Beerdigung, die in Bern stattfand. Die Klasse hatte einen Kranz mit weissem Band gekauft. Darauf stand in goldenen Lettern: Die Liebe hört
nie auf.»[58]
Im Bund (20. 2. 1993) berichtete seine ehemalige Schülerin Ruth Wolf: «Beeindruckend war Zulligers Gabe, jedem Schüler den für ihn richtigen Weg zu zeigen. Einfühlsam half er dem einzelnen, sich
zurechtzufinden und aufzubrechen - dann aber liess Zulliger gewissermassen los, gab dem Schüler Raum für Eigenverantwortung». Als am 28. Juni 1953 in Ittigen das neue Schulhaus eingeweiht wurde,
sang die ganze Schule ein Lied, dessen Text Zulliger geschrieben hatte. In Ittigen amtete der Sozialdemokrat auch als Gemeinderat und Mitglied der Geschäftsprüfungskommission.

Schriftdisziplin - Kriegserklärung an die Hulligerschrift
Die Handschriftenreform aus Deutschland und Österreich fand auch in der Schweiz Anklang. Hans Zulliger: «Das Verlangen nach einer neuen Schulschrift entstand aus dem Kreis um die Schulreform
(Berner Seminarblätter). In diesem Kreis zeigte der Schreib- und Zeichenlehrer Paul Hulliger (1887-1969) nach dem Ersten Weltkrieg seine neu entwickelte Schrift. Damit konnte man dem Vorwurf
entgehen, die Sudelschrift zu fördern, denn sie verlangte Klarheit und gute Lesbarkeit.»[104] Hulliger arbeitete in Basel von 1918 bis 1926 an einer Schrift,
die die Antiqua-Spitzfederschrift ersetzen sollte. 1926 wurde sie an den Schulen des Kantons Basel-Stadt eingeführt.[102] Zulliger: «Ich kannte Hulliger
persönlich. Seine Schrift spiegelte seine aussergewöhnliche Gewissenhaftigkeit, den Drang nach Klarheit, das Bestreben nach Ordnung, Sauberkeit und Form wieder. Das
demokratisch-individualistische Prinzip, für das die Schulreform einst stand, wich langsam dem Geist straffer Führung. Die neue Schrift entsprach dieser Tendenz. Es war viel einfacher, eine
uniforme Schrift durch Zwänge durchzusetzen, als die Schüler dazu zu bringen, ihre erlernte Handschrift aus eigenem Antrieb ‹schön› zu gestalten. Für die Schule übte ich die schräge
Hulligerschrift mit der Ly-Feder.[104] Die Vorschriften erinnern an die eines höfischen Zeremonienmeisters aus der Zeit des Louis XV.: Daumen und Mittelfinger fassen den Federhalter
zangenartig 0,5-1 cm hinter dem vorderen Ende. Um das Festhalten zu erleichtern werden die Finger selbst kräftig gebogen. Der Zeigefinger legt sich mit seiner Beere zwischen Daumen- und
Mittelfingerbeere lose oben auf den Halter. Dabei bleibt zwischen ihm und dem Mittelfinger eine schmale Spalte offen. Auf das Entscheidende zu bekämpfen ist bei der Ziehfeder das Unterlege des
Nagelliedes des Mittelfingers unter den Halter. welcher so gegen das harte Nagelgliedgelenk gedrückt wird. Der Halter ist sicher einzubetten zwischen dem Daumenbeerenpolster und Nagel und Beere
des Mittelfingers. Häufige Übungen im Beugen und Strecken der drei Fassfinger sind unerlässlich, usw. Es gibt Vorschriften über die Gestaltung und Grösse der Schreib- und Rechnungshefte,
Liniensysteme, Farbe der Linierung, Rand, Zeilenzahl, Heftumschlagfarbe, Gestalten des Heftschildchens, Schriftgrösse, Schriftwinkel, und Verhältnisse zwischen Ober-, Mittel- und
Unterlängen. Nur die Bleistifte sind vergessen geblieben.[113] Die Schüler schrieben danach zwar deutlicher und klarer, aber auch langsamer. Im
Durchschnitt brauchten sie etwa ein Drittel mehr Zeit als bei der vorherigen (Michel-)Schrift. Man zweifelte, ob die obligatorische Einführung dieser Schrift, wie sie in Aargau erfolgt war, einen
Vorteil für unsere Schule und unser Volk bedeutete.»[104] Die Schrift löste zahlreiche Debatten aus. Das Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel (8. 2.
1930) bemängelte: «Die Schweiz hat sich eine Schriftreform durch Hulliger besorgt. Seine lateinische Schrift zeigt eine Mischung aus eckigen und runden Schreibzügen, die mehr die Mängel unserer
beiden Schriftarten vereint als künstlerisch und methodisch überzeugt.» 1933 fragte sich ein bernischer Grossrat in seiner Lehrmittelmotion: «Ist die Zwangsjacke der Hulligerschrift
nötig?»
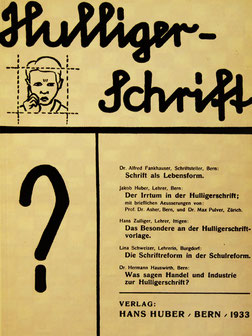
Gegner der Schrift hatten bis dahin nicht ausreichend begründete Argumente. Dies änderte sich 1933, als Zulliger zusammen mit einigen Autoren die Broschüre
«Hulligerschrift?» im Verlag Huber herausgab. Die Betonung lag auf dem Fragezeichen und bedeutete «Nein». Das Bugdorfer Tagblatt (3. 9. 1933) bezeichnete das Werk als «Kriegserklärung an die
Hulligerschrift». Darin untersuchte Hans Zulliger die Schrift mit den Mitteln der Psychologie und setzte sich mit der Frage auseinander: «Entspricht die Hulligerschrift als Lehrvorlage für die
Jugend den Tendenzen und den Anforderungen eines seelisch vollentwickelten Menschen?» In seinem Aufsatz «Das Besondere an der Hulligerschriftvorlage» kritisierte er das Werkzeug, die Breitfeder.
Die Schrift sei nicht an den menschlichen Geist angepasst, sondern der Mensch müsse sich dem Werkzeug anpassen. Sie diene nicht den Anforderungen eines seelisch vollentwickelten Menschen. Ihre
starren Vorschriften machten sie unlebendig und unflüssig.[103] Lehrerin Lina Schweizer, Mitautorin der Broschüre, schloss sich Zulligers Meinung an. Sie
begründete dies damit, dass die Schrift «jede persönliche Bewegungsfreiheit reglementiere und unterdrücke» und somit das Gegenteil dessen bewirke, was die Schulreform anstrebe, nämlich die
Anlagen jedes Menschen zu fördern.[105] Zulliger wies anhand einer Reihe von Beispielen nach, dass sich bei der Schrift von Hulliger-Schülern später
erschreckende Zerfallserscheinungen zeigten. Die Broschüre war einer der letzten Versuche, die Hulligerschrift aus den Schulklassen zu verbannen. Sie wirbelte in den Schulblättern viel Staub auf
und wurde teils ablehnend, teils zustimmend besprochen. Der Bund (21. 9. 1933): «Es wird für die Befürworter unumgänglich sein, sich gegen diese forsche Attacke zu wehren. Bevor weitere
Unterrichtskurse zu dieser neuen Schrift stattfinden, haben Eltern und Lehrer das Recht zu verlangen, dass die Einwände gewissenhaft geprüft werden. 1934 startete Paul Hulliger mit zwei
Veröffentlichungen den Gegenangriff: «Irrtum in der Hulligerschrift?», in dem er sich mit den Verfassern der Broschüre «Hulligerschrift?» auseinandersetzte, sowie «Die Methode der neuen Schrift»
mit 250 Abbildungen und einem Vorwort des Basler Erziehungsdirektors F. Hauser. Der Zürcher Erziehungsrat kam 1935 zu dem Schluss, dass die Hulligerschrift, wenn sie schnell geschrieben wurde,
ein «hässliches und unleserliches Schriftbild» ergebe, und schloss sie vom Unterricht aus.
1936 wurde die Hulligerschrift in den Kantonen Baselland, Bern, Solothurn, Aargau, Luzern, Zug, Thurgau und Schaffhausen zur obligatorischen Schulschrift. Zulliger: «Die stark zwanghafte Schrift
entsprach der gegenwärtigen Zeitströmung, die nach Reglementierung des Lebens, Unterordnung und Führung sowie der Aufgabe demokratischer Ideale tendierte.» Die Innerschweiz und St. Gallen
schafften die Schrift so schnell wie möglich wieder ab, Tessin und die welschen Kantone verzichteten ganz darauf. 1946 beklagten sich die Menschen darüber, dass die Jugend aufgrund der
Hulligerschrift die Briefe ihrer Väter und Grossväter nicht mehr lesen könne. Unter dem Druck der öffentlichen Meinung begannen die kantonalen Schulbehörden die Hulligerschrift abzuschaffen, in
Basel war es 1947. Im Frühjahr 1948 führte Basel an der Unterstufe eine neue Schrift ein. Deren Form, die aus der Schreibbewegung heraus gewonnen wurde, zeigte eine vereinfachte Antiqua. In den
anderen Kantonen wurde die Hulligerschrift durch die «Schweizer Schulschrift 1946» ersetzt.


Familie
Hans Zulliger hatte Ida Martha Urfer (1893-1973), Lehrerin in Riederbütschel, während seiner Seminarzeit kennengelernt. Er heiratete sie in Bern am 4. Dezember 1915.[115] Zum 70. Geburtstag widmete er ihr das Gedichtband «Es Büscheli Matte-Meie». Hans Zulliger: «Ohne meine Frau hätte ich meine vielfältige Arbeit nicht bewältigen können».[23] Als kritische Begleiterin redigierte Martha seine Manuskripte. Sie war auch in der Kindererziehung sehr aktiv und arbeitete als Psychoanalytikerin. Wie Hans war auch Martha Mitglied der Schweizerischen Gesellschaft für Psychoanalyse (SGPsa). Im Frauenkalender 1922 äusserte sie sich zur Stellung des Kindes in der Familie. In der Zeitschrift Die Garbe (1. 8. 1919) veröffentlichte sie «Die Spinne». Im Bund «Es Wiehnachtsliedli» (25. 12. 1925) und die Erzählungen «Die Treppe» (22. 5. 1921), «Ein Wiedersehen» (7. 2. 1926), «Ds Cheischtli» (1. 10. 1933) und «Der Tanndligoumer» (23. 12. 1935). Ihr Mundartstück «Ufs Härz muess me lose» wurde mehrmals aufgeführt. Aus der Ehe gingen der Münsinger Primarlehrer Peter (geb. 1916), Lehrerin Elisabeth (geb. 1918) und Anne-Maria (1921-1998) hervor.
Schriftstellerische Tätigkeiten
Um die Verbindung zu den ehemaligen Schülern aufrechtzuerhalten, gründete Dr. Ernst Schneider im Frühjahr 1907 die «Berner Seminarblätter», die 1910 zu einer pädagogischen Zeitschrift erweitert
wurden.[97] Zulliger veröffentlichte darin seine ersten literarischen Arbeiten. 1912 war es ein Bericht seiner Seminarreise 1911 nach München. Sein
Seminarkamerad Fred Stauffer versah die Zeichnungen dazu.[7] 1916 war er Mitautor von Schneiders Buch «Beiträge zum Geschichtsunterricht in der Volksschule».
Hans Zulliger führte stets ein Notizbuch bei sich, in dem er seine Erlebnisse in Versen festhielt.
Bärndütsch
«Dass me nid en allnen Orten exakt glych redt, däisch aber
grad ds schönschte. Üsi Spraach isch rych, rych!»
Hans Zulliger, Der Bund, 29. 12. 1920
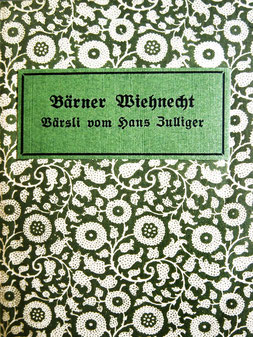
Mit Weihnachtsversen zu Erfolg
Martha Urfer bat Hans Zulliger im Winter 1915, ihr einige Weihnachtsverse für die Schule zu schicken. Ein Verzeichnis ihrer bereits verzeichneten Bändchen und Hefte legte sie bei. Er suchte in den Buchhandlungen nach etwas Brauchbarem, fand aber nur die Gedichte der Mundartschriftstellerin Sophie Hämmerli-Marti (1868-1942). Zulliger: «Aber eines Morgens fiel mir ein Rhythmus zu Weihnachtsversen im Dialekt ein. Bis dahin hatte ich noch nie etwas in Mundart geschrieben. Nachdem eine Handvoll mundartlicher Weihnachtsverse entstanden waren, las ich sie meinen eigenen Schülern vor, ohne ihnen zu sagen, wer sie geschrieben hatte: kleine Legenden aus der Kindheit von Jesus und einige lyrische Stücke. Sie wurden begeistert aufgenommen. In den folgenden Vorweihnachtszeiten schrieb ich neue Verse, bis ein ganzes Bündel entstanden war. Bei einem Schulbesuch fand sie mein damaliger Schulinspektor, als er mir das Pult durchwühlte. Er hielt mir eine kleine Strafpredigt, weil ich die Verse nicht veröffentlichen wollte. Ich bat Simon Gfeller, er möchte sich die Sache ansehen und mir seine Meinung mitteilen. Gfellers Antwort klang so begeistert, dass ich zum Verleger Alexander Francke (1853-1925) ging und 1918 kam die ‹Bärner Wiehnecht› heraus, die in der Folge viele Auflagen erlebte.»[39] So begann Zulligers schriftstellerische Laufbahn mit den Mundartversen «Bärner Wiehnecht».[1] Einige Kostproben daraus veröffentlichte das Berner Schulblatt bereits am Dezember 1917. Das Burgdorfer Tagblatt (21. 12. 1918) schrieb: «Zulliger ist ein echter Poet, auch wenn er nur Verslein für die Kleinen und Kleinsten schreibt, die sie mit Freuden auswendig aufsagen, wenn die Mutter oder die Lehrerin sie ein paarmal vorgelesen hat.» Seine Weihnachtsverse- und Gedichte wurden in den folgenden Jahren an den Bolliger Adventsfeiern zwischen Kerzenlicht und Tannenzweigen vorgelesen. Zwei Kostproben zeigen, wie gut Hans Zulliger den kindlichen Ton trifft:
Es Briefli
Ha geschter z'Nacht es Briefli
Uf d'Fäischtersimse gleit,
Wo druff em Wiehnechtchingli
Sy Name gschribe steit.
U wo-n-i hütt erwache,
Jsch d'Fäischtersimse läär . . .
Jetz wett i, ds Wiehnechtchingli
Chäm hinecht scho derhär
D’Mueter
D'Maria, uf de Zeie,
So lys, as wie sie cha,
Geit süferli zum Chrüpfli,
Luegt ihres Chingeli a.
Es lyt uf Streui bettet,
Das isch für ihns scho gnue.
Mit Josephs altem Mantel
Deckt's d'Mueter hübscheli zue.
Lyts scho nid i re Wiegle,
Es schläfelet ganz glychi guet!
d'Maria bückt sich zue-n-ihm
U lost, wies schnüfele tuet…[2]
Hans Zulliger über das Dichten: « Die schriftstellerische Arbeit wird im Allgemeinen schlecht bezahlt. Deshalb wird sie in der Regel als Nebenberuf ausgeübt. Diese
Doppelbeschäftigung führt aber oft zu Konflikten. Man kann nicht auf Befehl dichten. Der Dichter ist gezwungen, das eine zu tun und das andere nicht zu lassen. Die Nächte, die Sonntage müssen dem
Nebenberuf gewidmet werden, er lebt nicht mehr bei seiner Familie, er verzichtet auf Urlaubstage. Aber oft reicht die Zeit nicht aus: ein Werk bleibt Fragment oder wird gar nicht geschrieben. Der
Dichter fühlt sich dann wie ein Weinstock, an dem die Trauben vertrocknen müssen, weil sie während der Reife nicht gelesen werden konnten.»[35]
Hans Zulliger liebte den Reichtum der Berner Mundart. Er wünschte sich, dass man zur Mundart Sorge trage, da viele Ausdrücke langsam verschwänden. Mit den Mundartdichtern Simon Gfeller und Otto
von Greyerz hatte er zeitweise zwei Förderer und Begutachter seiner Werke. Bald umfasste seine schriftstellerische Tätigkeit in Mundart auch Kurzgeschichten, Theaterstücke, Balladen und
Festspiele, Artikel für Zeitungen und den Schweizerischen Schriftstellerverein. Viele seiner Werke eigneten sich besonders zum Vorlesen im Familienkreis.[1]
«Zulligers würzige und bildhafte Sprache brachte Werke hervor, die an Gotthelf und an Tavel erinnern.
Es sind Bekenntnisse, getragen von einem tiefen Verständnis für die kindliche Seele.»
Kinderanalytiker Jacques Berna (1911-2000), NZZ, 20. 10. 1965

1920 hielt Zulliger in Bern für die Bärndütsch-Gesellschaft im Grossratssaal einen Vortrag, der im Bund (29.12.1920) abgedruckt wurde. 1921 folgten Beiträge in der Zeitschrift «Heimatschutz», im «Schweizer Heimatkalender», im Novemberheft der «Schweiz» und ein heiterer Leseabend im Schulhaus Ittigen.
In seiner Freizeit liess er sich von den Dorfbewohnern der Umgebung Gespenstergeschichten erzählen. Bald hatte er eine Sammlung zusammen. Hans Zulliger: «Als ich seinerzeit den Gespenstergeschichten in meiner Umgebung nachging, fand sich für manche eine ganz natürliche Erklärung. In einem Haus hörte man unter dem Dach merkwürdige Geräusche. Die abergläubischen Bewohner glaubten an ein Gespenst. Eine genauere Untersuchung ergab jedoch, dass auf dem Firstbalken eine leere Konservenbüchse stand, in die sich eine Fledermaus verirrt hatte. Sie gab sich jeweils bei Einbruch der Dämmerung alle Mühe, aus ihrem Gefängnis herauszukommen. Ein Licht, das über einen Hügel wanderte, gehörte einem Fuchs mit schimmerndem Schwanz. Es war ein sogenannter Scheinschwanzfuchs. Auf dem Land glaubt man besonders an das Gespenst Toggeli, das die Schlafenden heimsucht, ihnen auf die Brust kriecht und sie würgt. Als Gegenmassnahme zeichnen unsere Bäuerinnen ein Kreuz an die Tür der Schlafstube, sie stecken ein Messer zum Kartoffelschälen in die Türschwelle und legen die Bibel unters Kissen.» [93] Zulliger brachte 1923 eine Auswahl dieser Gespenstergeschichten unter dem Titel «Unghüürig, Allti Gschichte us em Bantigergebiet» heraus.

Die Stimmung der Geschichten wurde durch die Illustrationen des Malers Rudolf Münger (1862-1929) noch verstärkt. Münger hatte 1907 das Titelblatt-Logo für Dr. Ernst Schneiders «Seminarblättern» entworfen und bei der Renovation der Stadtkirche Biel im Fresko «Schweisstuch der heiligen Veronika» zwei Köpfe hinzugefügt. Die Berner Tagwacht (8. 11. 1923): «Jeder, der die Gegend zwischen Bantiger und Grauholz kennt, weiss, welche alten Geschichten hier umgehen und wird das Büchlein mit Eifer lesen.» Eine davon, «Der letscht Ritter vom Geristei», spielt auf der Geristeinburg in der Gemeinde Bolligen. Nachdem der Ritter vom Geristein erfahren hatte, dass sich seine Tochter verliebt hatte, bestrafte er das Liebespaar: «Er packt nen u gheit ne zum höche Bogefäischter us i Burggraben ache. Druf speert er ds Töchterli, won ihm het welle where, in nes Chämmerli. Numen es einzigs chlys Loch isch ir Muur gsi. Ir Wiehnechtnacht druf ache chunnt e glänzig Ritter vüre, won es Chrütz gäge d’Burg ufe streckt. Ds Töchterli het nen as sy Schatz erkennt. Mängs Jahr druf het e Waldbrueder dä Ritter, wo ds Chrütz ufhet, i d‘ Flue uf der angere Syte vom Geristeiturm ygmeisslet.» Zulligers Erzählungen inspirierten 1997 den Regisseur Armin Fankhauser zu seinem Kurzfilm «Geristein». Als Drehort wählte er die Burgruine Geristein und siedelte den Film im Zwischenbereich des Realen und Irrealen an.[92]
Buchlocation von «Unghüürig»: Burgruine Geristein, Zustand 2025. Foto: S. V.
1924 entstand unter der Mitwirkung von Simon Gfeller und Otto von Greyerz das Bändchen «Albes, wo mer jung sy gsy», mit Kindheitserinnerungen der Autoren. Mit seinem 1925 erschienenen Buch «Bi üs daheime» reihte sich Zolliger in die erste Reihe der Dialektschriftsteller ein. Die Neue Berner Zeitung (12. 12. 1925): «Zulliger ist ein Meister der berndeutschen Plauderei und Skizze. ‹Blüemli› ist eine der schönsten berndeutschen Erzählungen.»
Eine weitere Bereicherung der Berner Mundartdichtungen gelangte Zulliger 1932 mit dem Bändchen «Bärner Marsch». Den Hauptteil (Us alte Tage) füllten historische Szenen und balladenartige Verserzählungen aus der bernischen Geschichte von der Laupenschlacht bis zu den Erlebnissen der Grenzbesetzung. Eine Anekdote erzählt vom armen Ritter von Egerdon, als 1349 die Pest in Bern wütete. Eine andere die seltsame Begebenheit der Käfer vor Gericht. 1934 unterhielt er den Ortsverein Aarberg im Rathaussaal zwei Stunden lang mit «Gedrucktes und Ungedrucktes».
Beitrag der heimatlichen Dichter zur geistigen Landesverteidigung
Als die Nationalsozialisten in Deutschland nach den Bücherverbrennungen von 1933 die Reichsschrifttumskammer (RSK) gründeten, schlossen sich ihr auch einige Schweizer Schriftsteller an und
unterwarfen sich der deutschen Zensur. Dies ermöglichte bessere Verkaufszahlen. Hans Zulliger lancierte im Rahmen der «Geistigen Landesverteidigung» eine Initiative, um gemeinsam mit Berner
Autoren das Bärndütsch als Kulturgut zu fördern. Daraus entstand der Berner Schriftsteller-Verein, dem Zulliger als aktives Mitglied angehörte. Er organisierte 1938 im Kursaal Schänzli Bern einen
Dichterabend, an dem er und acht weitere Berner Schriftsteller und Dichter teilnahmen. An diesem Anlass begrüsste Zulliger als eigentlicher «Spiritus rector» die Gemeind. Drei Lieder des Berner
Männerchors gaben dem Abend einen festlichen Auftakt. Zulliger gab dann drei Balladen zum Besten. Neben Zulliger lasen vor: der Lyriker Walker Dietiker, der Balladendichter Hans Rhyn, die
Schriftsteller Erwin Heimann, Emil Schibli, Ernst Balzli, Emil Balmer, Karl Grunder, und der Jurassier Joseph Beuret in französischer Sprache. Die Idee fand offenbar Anklang, denn der Anlass war
gut besucht. 1939 sprach Hans Zulliger an der Volksschule Zürich in der Vortragsreihe «Schwizer Dichtig» über das Problem der dichterischen Gestaltung in der Mundart.
Hans Zulliger: «1939 hatte ich dem Leiter des Francke-Verlags, Carl Emil Lang (1876-1963), ein Mundart-Manuskript versprochen. Wie das Buch heissen sollte, wussten
wir noch nicht. Einzelne Teile davon waren noch gar nicht fertig und ins Reine geschrieben. Da brach der Weltkrieg aus und ich musste als Soldat an die Grenze. Aus dem Buch wird nichts, sagte ich
mir. Welcher Verleger dürfte den Druck wagen? Lang war jedoch anderer Meinung und heraus kam ein Buch, das wir gemeinsam unter dem Titel ‹Flüehlikofer Härd› tauften.»[79] Darin schildert Zulliger die Dorfbewohner im Berner Mittelland. 1941 erschienen nach seinen Texten «Berner Mundartliedli» für eine Singstimme und Klavier. 1941
stellte er im Interesse der geistigen Landesverteidigung den Berner Schultheiss und Feldherrn Adrian von Bubenberg (1424-1479) in den Mittelpunkt eines Mundartballadenzyklus. 1942 fand unter dem
Patronat von Stadtpräsident Guido Müller der «Bieler Dichterabend» statt. Zulliger gab dem Publikum Kostproben aus «Buebebärg» und einer Mundarterzählung.
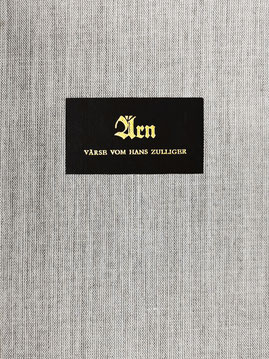
Zur Erntezeit 1943 erschien das Berner Mundart-Versbuch «Aern». Auzüge davon wurden bereits 1942 vom «Schweizerischen Schriftstellerverein» in den «Lyrischen Blättern» publiziert. Der Bieler Pädagoge Heinrich Kleinert (1895-1954): „Es ist erfreulich, dass mitten in der Kriegszeit Zulligers poetische Verse erscheinen, die noch dazu eine zweite Auflage erleben. Sie bieten sich uns wie in Marmor gemeisselt dar. Oft bergen seine scheinbar gewichtlosen, nur flüchtig hingeworfenen Zeilen einen umso gewichtigeren Inhalt: Läb uf rächte Wäge, dass de frank u froh, we de stirbsch, chasch säge, miesch’s no einischt so!»[74]
Am Jahrestreffen der Berner Schriftsteller in Aarberg am 12. November 1950 trug Zulliger die humorvolle Geschichte einer Flühlikoferin vor, die den Teufel überlistete. Als im Dezember 1950 im Encyclios-Verlag Zürich das 1920 Seiten umfassende «Schweizer Lexikon in 2 Bänden» erschien, bedauerte der Bund (21.12.1950), dass man darin «namhafte Berner Heimatdichter wie Hans Zulliger vergeblich sucht.» Im Winter 1950/1951 las Zulliger für den «Verein für deutsche Sprache, Bern» drei berndeutsche Geschichten vor.
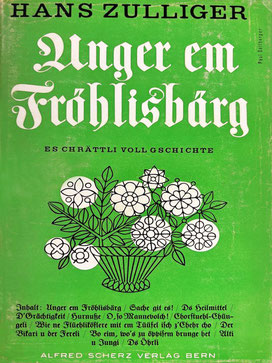
1954 erschien «Unger em Fröhlisberg», in dem Zulliger auf 222 Seiten es Chrättli voll Gschichte präsentiert. Der Leser lernt verschiedene Menschen aus einem Bauerdorf kennen. Wieder wurden einige bereits vergessene berndeutsche Ausdrücke zu neuem Leben erweckt. Das Buch schliesst mit den Worten: «Me muess halt chönne innertsi luege, därt isch o öppis. E mänge hingäge luegt nume ussertsi u meint, sälb syg aleini wichtig, was me dört gseht.» Der Name Fröhlisberg scheint Zulliger der gleichnamigen sozialen Bieler Baugenossenschaft entnommen zu haben. Mit «Es Büscheli Matte-Meie» kehrte der 70-jährige Hans Zulliger 1963 zu seinen landberndeutschen Versen zurück. 1964 trug er in der Stadtbibliothek Burgdorf berndeutsche Balladen vor. 1964 in der Stadtbibliothek Burgdorf berndeutsche Balladen. 1997 rezitierte der Schauspieler und Erzähler Paul Niederhauser im Glockenturm des Schulhauses Uttigen Zulligers Mundartgedichte.
Erinnerung von Dr. Gerhart Wagner
Ein Zeitzeuge, den Hans Zulliger persönlich kannte, ist der 1920 in Bolligen geborene Dr. Gerhart Wagner. 2025 feierte er seinen 105. Geburtstag. Als Lehrer am Gymnasium Kirchfeld und Direktor des Realgymnasiums Bern-Neufeld hatte er immer ein offenes Ohr für die Anliegen seiner Schüler. Darum überreichten sie ihm anlässlich seiner Pensionierung 1983 ein «Goldenes Ohr». Als Botaniker ist er Namensgeber des Findlings Wagnerstein im Äschiwald oberhalb Stettlen. Wagner: « In meiner Jugend lernte ich Hans Zulliger als Gastredner im Sekundarschulhaus Bolligen kennen. Wir waren eine Gruppe interessierter Jugendlicher, alles Knaben, und diskutierten verschiedene Themen, von politisch bis religiös. Zulliger war damals ein Begriff, weil man ihn regelmässig im Berner Radio hörte. Jede Woche gab es eine Stunde Zulliger, in der er eine neue Geschichte erzählte.»

Hans Zulliger im Radio
1926 führte das Heimatschutztheater Zulligers Gespenstergeschichte «Unghüürig» im Radio auf, die mehrmals wiederholt wurde. Zulligers Anliegen, das Bärndütsch einem möglichst breiten
volkssprachigen Publikum vorzustellen, wurde mit dem Medium Radio verwirklicht. Es folgten Lesungen aus «Chüehni Hännelis Bihs», «Gespenstergeschichten aus der Umgebung Bern», «Der Rothebüeler
Niggel, Lesungen aus der Schriftstellermappe (1928), Ds Zälgacherli», Ds Blüemli» (1931), «Buebebärg» (1942).
Die Gründung des Berner Schriftsteller-Vereins (BSV) führte zu verschiedenen Kommissionen, die ein gemeinschaftlich interessiertes Arbeitsprogramm umsetzen sollten. So übernahm Hans Zulliger die Leitung der BSV-Radiokommission. 1950 sendete Radio Beromünster das Hörspiel «Löhre-Haness». Die Neuen Zürcher Nachrichten (18. 9. 1950): «Die Geschichte schildert einen Bauern, der sein drittes Kind verstösst, nach vielen Schicksalsschlägen seinen Stolz und Eigenwillen verliert und im Studium der Bibel die Deutung des Lebens findet, die mit der Rückkehr des Verstossenen endet. Eine geschickte Mischung aus König Lear, Heimatschutztheater und geistlichem Spiel.» 1950 feierte das Radiostudio Bern sein 25-jähriges Bestehen. Anstatt eine Festschrift herauszugeben, beschloss man, Hörspielaufträge an Autoren zu vergeben. Das Ergebnis war die Geschichte «Der Waisenvogt». Seine stimmungsvollen Gedichte wurden alljährlich zu Weihnachten übertragen.

Theater- und Festspiele
Unghüürig - Ein Mundartlustspiel in zwei Akten: Die Gespenster- und Liebesgeschichte wurde am 25. 10. 1921 im Stadttheater Bern unter grossem Beifall uraufgeführt.
Ausschlaggebend dafür war der am 17. November 1915 von Otto von Greyerz gegründete Berner Heimatschutztheater-Spielverein Bern, der sich die Förderung des Mundartschauspiels zum Ziel gesetzt
hatte. Die Spieler wurden in den Programmen nicht namentlich aufgeführt. Die Einnahmen flossen ausschliesslich in die Vereinskasse. Die Geschichte dreht sich um einen Schelm, der sich sein
Geschäft erleichtern will und lieber keinen Pächter auf dem «Rosindli» sehen möchte. Er verbreitet das Gerücht, dass dort oben ein Gespenst sein Unwesen treibe. Zwei Buben und zwei Mädchen
versuchen, es zu fangen. Als sie die Angst packte, kamen sie sich näher und im Nu waren sie zwei Paare. Auch das Gespenst konnte gefangen werden.[4]
«Unghüürig» war Zulligers erfolgreichstes Stück.
Aufführungen (Auswahl): 1921: Bern, Lützelflüh (Heimatschutztheater Bern). 1922: Biel (Heimatschutztheater Bern). 1923: Neuchâtel
(Heimatschutztheater Bern). 1926: Bern (Zytglogge-Gesellschaft). 1933: Thierachern (Gemischter Chor). 1939: Thun (Pontonierfahrverein). 1941:
Mett (Frauen- und Töchterchor). 1942: Bern (Gemischter Chor Holligen-Fischermätteli). 1945: Biel (Gesellschaft der Militär-Motorradfahrer vom
Landesteil Seeland-Jura), Cordast (Kichenchor). 1950: Burgdorf (Arbeiterfrauen- und Töchterchor), Uebeschi (Frauen- und Töchterchor). 1951:
Steffisburg (Männergesangsverein). 1952: Zäziwil (Musikgesellschaft Eintracht). 1954: Burgistein (Gemischter Chor Burgiwil),
Burgdorf (Trachtengruppe Burgdorf und Umgebung), Wynigen (Jodlerklub und Trachtengruppe). 1957: Hindelbank (Turnverein der Damen- und
Jugendriege). 1960: Gurzelen (Frauenchor), Bargen (Frauen- und Töchterchor). 1961: Kandersteg (Trachtengruppe), Steffisburg
(Gemischter Chor), Münchenbuchsee (Trachtengruppe Grauholz). 1962: Villeret (Männerchor Frohsinn), Trub (Frauen- und Töchterchor). 1963:
Blumenstein (Damenriege und Turnverein). 1964: Heimberg (Arbeiter-Männerchor), Rüti bei Büren (Gemischtenchor). 1965:
Hilterfingen (Heimatschutztheater Bern), Renan (Landfrauenverein St. Immertal). 1966: Albligen (Gemischter Chor). 1969: Biel
(Blaukreuz-Musik). 1971: Wahlendorf (Trachtengruppe Meikirch). 1972: Krauchthal (Damenturnverein und Mädchenriege). 1974: Wangen (Trachtengruppe
Wangen und Umgebung). 1982: Wattenwil (Trachtengruppe), Uettligen (Trachtengruppe Wohlen). 1983: Düdingen (Männerchor),
Tramelan (Chœur mixte Anémone). 1984: Blumenstein (Trachtengruppe). 1988 Thun (Jodlerklub Blüemlisalp). 1989: Thun (Oberländer
Liebhaberbühne). 1990: Bösingen (Gemischer Chor Fendringen). 1992: Sigriswil (Männerchor). 2001: Überstorf (Gemischter Chor
Kessibrunnholz).
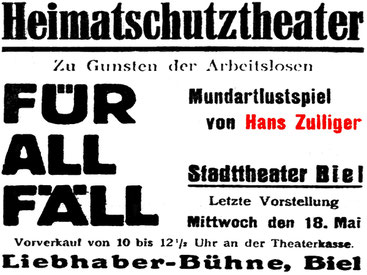
Für all Fäll: Zulligers Mundartlustspiel in vier Aufzügen erschien 1925 im Verlag A. Francke in Bern. Die Handlung dreht sich um den Feldmauser
Niggel Nothenbühler, Vater und Berufsmann, der merkt, dass seine beiden Kinder Chrigi und Rösi sich verloben wollen. Er fürchtet, in seinem Alter einsam zu sein. Schliesslich ist er das erste und
einzige Familienmitglied, das sich verlobt. Der Humor des Stücks liegt in den verschiedenen, scharf gezeichneten Charakteren und dem Mauser- und Kleinleutemilieu, in das die Stadtleute mit ihrer
feinen Sprache hineinplatzen. Das Stück wurde von der literarischen Kommission des Heimatschutztheaters empfohlen, um dem Mangel an guten Mundartspielen abzuhelfen. Am 23. März 1926 wurde es
erstmals im Schänzlitheater Bern vom Heimatschutztheater gezeigt. 1932 führte die neu gegründete Liebhaberbühne Biel zur Unterstützung der Arbeitslosenkasse das Stück gemeinnützig auf. Die
Liebhaberbühne, die auf finanzielle Gewinne verzichtete, zeigte an anderen Aufführungen auch Zulligers Werke «Het en Yscher» und «Unghüürig».
Aufführungen (Auwahl): 1926: Bern (Heimatschutztheater). 1928: Dotzigen (Männerchor). 1931: Busswil (Männerchor), Büren an der
Aare (Turnverein und Damenriege). 1932: Biel (Liebhaberbühne). 1938: Goldbach (Männerchor Schafhausen). 1947: Studen (Landfrauenverein)

Het en Yscher: Als Zulliger 1932 das Lustspiel schrieb, rätselte man, was dieses Wort wohl bedeuten könnte. Es stellte sich dann heraus, dass der
Yscher ein kleiner Fisch ist, ein Riesling, den man in Twann und am Bielersee als Köder an die Angel hängt. Der Ausdruck «Het en Yscher» sagt man auch, wenn jemand in die Falle gegangen ist. In
der am Bielersee angelegten Seebutzekomödie wird viel Französisch gesprochen. Das Stück wurde durch die Spielgruppe des Heimatschutztheaters am 17. Januar 1933 in Burgdorf uraufgeführt. Das
Bieler Tagblatt (10. 10. 1933) überzeugte die «psychologisch scharf umrissenen Charakter».
Aufführungen (Auswahl): 1933: Burgdorf (Heimatschutz-Theater Bern), Merzligen (Männerchor), Biel (Liebhaberbühne),
Erlach (Männerchor Echo). 1934: Gunten (Musikgesellschaft). 1956: Radelfingen. 1960: Vinelz bei Biel (Turnverein und
Damenriege)
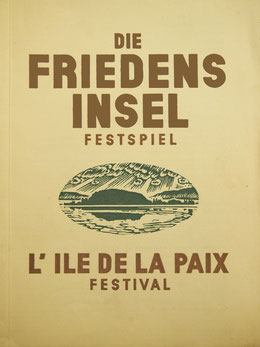
Die Friedensinsel / L’Ile de la Paix: Für das Berner Kantonalgesangsfest, das 1934 in Biel stattfand, schrieb Zulliger die deutschen Texte des
zweisprachigen Festspiels. Das dazu erschienene Textbuch wurde von der Druckerei der Schreibbücherfabrik Biel hergestellt. Den französischen Text schrieb Richard Walter in Biel, die Brüder Emil
und Joseph Lauber komponierten die Musik dazu. Diese wurde erstmals an einem Festspiel von Fanfaren ausgeführt. Zu diesem Zweck schlossen sich die Stadtmusik Biel und die Union Instrumentale zu
einem Klangkörper zusammen. Die Uraufführung fand am 25. Mai 1934 auf der Wildermethmatte statt, wo 1902 das Kantonalgesangfest stattgefunden hatte. Ein Grossaufgebot von 1500 Mitwirkenden
sorgte in der riesigen Festhalle, die 4000 Zuschauern Platz bot, für unvergessliche Momente.
Der pädagogische Grundgedanke des Stückes zeigte die Möglichkeit auf, dass Menschen mit unterschiedlichen Lebensauffassungen zu einer friedlichen Gemeinschaft
zusammenfinden können. Die Handlung spielte auf der St. Petersinsel, dargestellt in prächtigen Bühnenbildern von A. Bütschi, auf der sich wegen der Liebe Rivalitäten zwischen deutschen und
welschen Bauern, Fischern und Winzern entwickeln. Der plötzlich auftauchende Jean-Jacques Rousseau verkörperte den Friedensgedanken und schnell war der Zwist vergessen. Die Geschichte endete mit
der Einheit von Deutsch und Welsch für die Stadt, für das Vaterland und für den Frieden der ganzen Menschheit.[43] Dass Rousseau in der «Friedensinsel» eine
entscheidende Rolle spielte, war wohl kein Zufall, verdanken wir ihm doch sein Eintreten für die natürliche Entwicklung des Kindes. Die Festbesucher erkannten auch, wie sehr Zulliger das
bäuerliche Leben schätzte:
Ich lobe mir den Bauernstand,
Das freie Leben auf dem Land.
Des Sommers Arbeit, Müh und Schweiss,
Die Erde lohnet unseren Fleiss.
Ich lobe mir des Dorfes Ruh,
Die gute, reine Luft dazu,
Das stolze Haus, den vollen Stall,
Die grünen Wiesen überall.
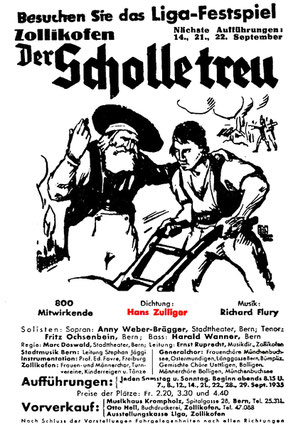
Der Scholle treu: Zulligers Festspiel war das Highlight der Landwirtschafts-, Industrie- und Gewerbeausstellung 1935 in Zullikon. Die Musik schrieb Richard Flury, Musikdirektor in Solothurn. Regie führte Marc Doswald, Regisseur am Stadttheater Bern. Zu den 800 Mitwirkenden gehörten die Stadtmusik Bern, die Schulkinder von Zollikofen, die Gesangsvereine von Zollikofen, Münchenbuchsee, Uetligen, Bolligen, Muri, Ostermundigen, mehrere Chöre, die Künstlerin Annie Weber und der Tenor Erwin Tüller. Das dreiteilige Stück schildert in bunten Bildern die Situation der Berner Bauern zur Zeit der Französischen Revolution und feiert die Arbeit und die Liebe zur Scholle. Die Aufführung war ein grosser Erfolg. Besonders beliebt war Zulligers verfasstes Lied «Mareili soll ga diene!», das eigens für das Festspiel geschrieben wurde. Stimmungsvoll war das Lied einer alten Bäuerin zu Füssen eines Sterbenden.
Das tapfere Schneiderlein: Im Dezember 1935 brachte das Stadttheater Schaffhausen unter der Regie von Marc Doswald das Märchen als Spieloper auf die Bühne. Zulliger schrieb den Text, der Berner Kapellmeister Fritz Neumann komponierte dazu eine prächtige Musik. Die Berner Tagwacht (3. 1. 1936): «Die Bearbeitung des Grimmschen Märchens durch Zulliger lässt den heutigen Grundgedanken recht deutlich hervortreten: Im Märchen siegt der Verstand über die Gewalt der Riesen und Ungeheuer. Daraus erwächst der optimistische Glaube an den Sieg über die Gewaltmenschen, der in unserer Zeit dringend nötig ist. Auch wir sind von ihnen bedroht, und unser einziger Trost ist, dass am Ende der Verstand über die Faust siegt. Zulliger hielt sich streng an die Grimmsche Fassung und vermied es, den Kindern eine Mischung verschiedenster Märchenmotive vorzusetzen, wie man es auf der Bühne so oft sieht. So kommt die wunderbare Grundidee des Märchens umso besser zur Geltung, und das Kind sieht auf der Bühne genau das, was es von Müttern, Grossmüttern und Lehrerinnen über das tapfere Schneiderlein gehört hat.»
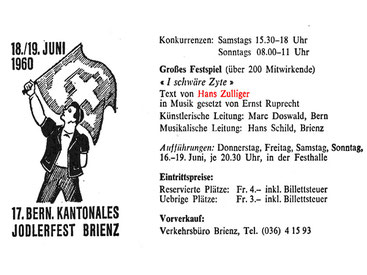
I schwäre Zyte - Ein schweizerisches Volksliederspiel aus der Grenzbesetzungszeit 1914. Das Stück, das Hans Zulliger zusammen mit dem Komponisten
Ernst Ruprecht schrieb, wurde 1938 in Zollikofen, Langenthal und Kirchberg aufgeführt. 1939 stellte der Lehrer Hans Aeschlimann in Uetendorf einen Chor von 70 Sängerinnen und Sänger zusammen.
1960 bildete das Stück den Höhepunkt des kantonalen Jodlerfestes in Brienz mit über 200 Mitwirkenden: Drei Jodlerklubs, drei Frauen-, Männer- und gemischte Chöre, eine Trachtengruppe, der
Damenturnverein, der Dramatische Verein, Laienschauspieler, Schüler und Musiker. Künstlerischer Leiter war Marc Doswald, Komponist wiederum Ernst Ruprecht. Weitläufige und farbenprächtige
Bühnenbilder zeigten die bäuerliche Welt der Nordalpen. Das Soldatenleben der Berner im Tessin wurde mit Temperament, schauspielerischem Ausdrucksvermögen und vor allem mit musikalischem und
gesanglichem Können dargestellt.[27]
Aufführungen (Auswahl): 1942: Lengnau bei Biel. 1943: Tossen. 1949: Hindelbank. 1950: Uetendorf (Männerchor,
Frauenchor und Dramatischer Verein). 1957: Köniz. 1976: Hindelbank (Gemischter Chor und Männerchor). 1990: Rubigen (Schüleraufführung)
Schultheater: Über das Schultheater erzählte Zulliger: «Um den Gemeinschaftssinn einer Klasse zu wecken, zu pflegen und zu fördern, empfiehlt sich die Aufführung von Schultheaterstücken. Bei den Leseproben kann man beobachten, wie viel Feingefühl die Klasse bei der Rollenverteilung entwickelt. Ebenso erstaunlich ist der Einfallsreichtum, wenn Requisiten, Kostüme usw. beschafft oder erfunden werden müssen. Man braucht keine richtige Bühne. Wir bauten eine aus den Schränken der Schule, zwei langen Bänken, einigen Schubladen und Holzleisten. Kisten dienten als Bänke, die Umgebung wurde mit Farbkreide auf die Tafel gemalt.» [20] Nach erfolgreichen Bühnenproben erschien 1951 Zulligers «Schul-Theater» für Kinder von 13 bis 16 Jahren im Sauerländer Verlag, Aarau. Die 5 Stücke sind in Berner Mundart und teilweise in Versen verfasst. «Chönnen aafüüre» führt 4 Mädchen aus der Stadt auf eine verlassene Alp. Das Wetter ist schlecht, die kleine Reisegesellschaft ist durchnässt und sehnt sich nach einem Schluck warmen Tee. Doch niemand weiss, wie man in der Sennhütte Feuer macht. «Hans im Glück» verarbeitet die Idee des Grimmschen Märchens, endet aber damit, dass die Betrüger die Betrogenen sind und Hans, der nichts mehr hat, wirklich der Glückliche ist. «Spörteler» wendet sich gegen die übertriebene Sportbegeisterung der Jugend. «Ds Päckli für d’Frou Biederma» zeigt, was zwei Klatschbasen anrichten. Die «Förchtchatze» besteht aus ein paar Schulfreundinnen, die einen Aabesitz feiern. Dabei erzählen sie sich Gespenstergeschichten, bis fast alle so erschrocken sind, dass sie überall Gespenster wittern. Die Stücke konnten von Schulen und Kindergruppen ohne grossen Aufwand für Bühnenbild und Kostüme aufgeführt werden.[48]
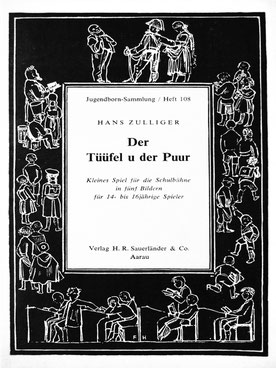
Aufführungen (Auswahl): Ds Päckli für d’Frou Biederma: Oberklasse Höfen (1956). Spörteler: Oberschule Höfen (1958), Chönne afüüre: Oberschule Blumenstein (1959). Förchtchatze: Oberschule Blumenstein (1959), Oberklasse Höfen (1964), Primarschule Rapperswil Seeland (1982). Hans im Glück: Oberschule Höfen (1965).
Der Tüüfel u der Puur (Der Teufel und der Bauer): Zulligers Werk wurde 1958 im Mädchenheim Schloss Köniz als bemerkenswert gekonntes Theaterstück aufgeführt. Es eignet sich hervorragend für Schulaufführungen. Lehrerinnen und
Schülerinnen führten das Stück 1959 in der Oberschule Wiler zugunsten des Behindertenheims im Rossfeld auf.
Weitere Schulaufführungen (Auswahl): 1961: Oberhofen-Hilterfingen (Oberstufe), Uetendorf (9. Primarklasse). 1963: Zimmerwald (9.
Primarklasse) 1964: Uetendorf (Oberstufe). 1965: Oberburg (Primarklasse).
Mundartlieder nach Texten von Hans Zulliger
Hans Zulliger steuerte Liedertexte für mehrere bekannte Komponisten bei. 1922 war es Gustav Fontanellaz, der eine Reihe von Dialektliedern herausbrachte. Die grösste Zusammenarbeit waren
sicherlich die Festspiele Die Friedensinsel (1934) mit Emile und Joseph Lauber, Der Scholle treu (1935) mit Richard Fluy und I Schwäre Zyte
(1938/1960) mit Ernst Ruprecht. Neben den Festspielen gab es auch Lieder, die in kleinem Rahmen vorgetragen werden konnten. So sang der Frauenchor von Muntelier 1934 das Lied
Hochsigzyt. Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums von Radio Bern vertonte Willy Burkhard (1900-1955) Zulligers Gedicht Bärnerlüt (1935) ein Lied für vierstimmigen
Männerchor.
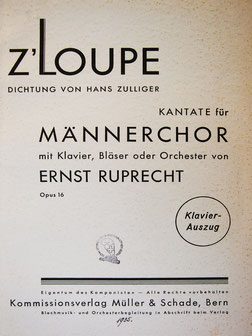
Z’Loupe ist eine Kantate für Männerchor mit Klavier-, Bläser- und Orchesterbegleitung, komponiert von Ernst Ruprecht. Für das Burgdorfer Tagblatt (22. 6. 1935) war es «eine interessante musikalische Neuerscheinung. Zulliger schildert darin im Berndialekt den Auszug aus Schloss Nidau, das bedrängte Laupen und den um seine Freiheit ringenden Harst der Berner. Das Werk kann auch von kleineren Vereinen aufgeführt werden. Die bernische Mundartdichtung, die im musikalischen Teil trefflich untermalt ist, eignet sich vorzüglich für berndeutsche Anlässe und Konzertzwecke. Die Kantate kann a cappella oder mit Begleitung einer Blech- oder Harmonimusik aufgeführt werden.» Die Uraufführung fand am 1. September 1935 im Rahmen des Sängertags des Kreisgesangsverbandes Bern-Land statt.
1939 trug ein Schülerchor die Verse von Z’Loupe an der grossen Laupenfeier in Bremgarten vor. 1941 erschienen im Verlag Gebr. Hug & Co. neun «Berner
Mundartliedli» von Paul Schmalz, gedacht für eine Stimme und Klavier: Summernacht, Liedli, Troscht, Dublete, Frag, Bim Gloggelütte, Vome stille Huus, Früehligstag und Vor
der Wienecht. Von Richard Flury entstand Du liebes, schönes Schweizerland (1948) für den gemischten Chor. Auch in verschiedenen Singbüchern tauchen Hans Zulligers Lieder
auf.
«Für die Kompositionen gemischter Chöre schrieb mir Hans Zulliger hauptsächlich die Texte.»
Max Huggler, Thuner Tagblatt, 21. 4. 1983, S. 2
Das Team Zulliger/Hugger
Hans Zulliger war der bevorzugte Liedlieferant des Komponisten Max Huggler (1913-2015), der das Jodeln liebte. In der Serie «Klänge und Heimat» des Verlags der Gesellschaft volkstümlicher
Autoren, Komponisten und Verleger erschien 1955 das Dängeler-Lied. Es wurde in einem «fröhlichen, aber gemächlichen Tempo» für einen gemischten Chor mit Jodel komponiert. Dank
Huggler wurde Zulliger auf den Langspielplatten der Schweizer Volksmusik bekannt: Sichlete, vom Bärner Heimatchörli, erschien auf der LP «Mir Bärner Jutze» (1977); Dört
Oben Uf Em Bärgli vom Jodlerklub Brienz, auf der LP «Mys Brienz» (1977) sowie auf der LP «Alphorn, singe u
jodle» von Vreni und Rita Schmidlin; Dr Gwugerig vom Jodelduett Amata & Hansruedi Schütz auf der LP «Stockereflühehjutz» (1979). Weitere Lieder waren D’s
Heidi (für gemischte Duette) und Aabelied (für den Männerchor mit Jodel).
Songtexte für Komponistin Heidi Stucki-Kasser
Heidi Stucki (1915-2012) war Musikerin, Komponistin und Gesangsleiterin der Trachtengruppe Spiez und Riggisberg. Sie lebte in Spiez. Mit Zulligers Texten entstanden die
Frauenchorlieder E Stall un es Chrüpfli (1947), Märzlicht (1948), Chilter-Liedli (1955), Stygüüferli (1956),
Bscheid (1957), Laus Rägeli (1965) und für den Kinderchor Aldergatti Sprüchli (1968), Oschtere-Sprüchli (1968), Zu
Muetis Geburtstag (1968). Das populärste Lied Du fragsch mi wär i bi ist Teil der Schweizer Volksmusiktradition und wird noch heute in verschiedenen Interpretationen
regelmässig gesungen. 2009 entstand eine chinesische Version vom Chian-Ai-Chor.[81]
Du fragsch mi, wär i bi,
du fragsch mi, was i cha,
wotsch wüsse, gäll,
werum i di nid us den Ouge lah.
I weiss nid, wär i bi,
i weiss nid, was i cha,
weiss nume, s’zieht mi zue dir hi,
i cha nid vo dir la.
Ha di vo Härze gärn,
du bisch mi guete Schtärn.
Chönnti di einisch nümme gseh,
wärs um mi Friede gscheh.
Jitz weiss i, wär i bi
jitz weiss i, was i cha,
i gib mi ganz so, wieni bi,
i gloub, du nimmsch mi a.
«Die Poeten halten mich für einen guten Wissenschaftler,
die Wissenschaftler für einen mittelmässigen Schriftsteller.»
Brief von H. Zulliger an Simon Gfeller, 20. 11. 1940, Burgerbibliothek Bern, N Simon Gfeller
Literatur für Jugendliche
Hans Zulliger: «Wenn ich für die Jugend schreibe, so will ich eine Literatur schaffen, die den Kindern in ihren verschiedenen Entwicklungsphasen entspricht, die die Klippen des Kitsches, der
Sentimentalität und des Schundhaften meidet und die Jugend nicht so bewertet, wie es die Wunschphantasie der Erwachsenen tut.»[39] 1928 wurde in Zürich eine
Untersuchung über die Verbreitung von sogenannter Schundliteratur bei 3500 Schülern des 6. bis 9. Schuljahrs durchgeführt. Das erschreckende Ergebnis führte zur Gründung der «Arbeitsgemeinschaft
zum Schutz der Jugend vor Schund und Schutz in Wort und Bild.» Was aber ist Schundliteratur? Zulliger: «Es gab eine Zeit, kurz vor dem Ersten Weltkrieg, in der die Romane von Karl May heftig
bekämpft wurden, weil man damit der Verrohung und den kriminellen Instinkten der Kinder Einhalt gebieten wollte. Diese Bewegung ebbte bald ab und die Jugend las die Bücher von Karl May mit der
gleichen Freude wie zuvor. Man verzichtete darauf, in Gerichtsgutachten die Lektüre minderwertigen Lesestoffs als ausschlaggebend für eine kriminelle Laufbahn zu bezeichnen, da die meisten Kinder
z. B. Karl-May-Romane ohne Schaden lasen.» [61] Zulliger lehnte «vom erzieherischen Standpunkt aus alle Comics ab. Auch die, die moralisch nicht schädlich sind, weil sie keinen Nutzen haben. Sie
dienen der Verflachung und sind insofern eine Gefahr».[54]
1931 wurde das Schweizerische Jugendschriftenwerk (SJW) gegründet, um die Jugend mit gutem Lesestoff zu versorgen und sie vor Schundliteratur zu schützen. Die kleinen Hefte erschienen in den vier
Landessprachen mit vierfarbigem Umschlag und wurden zu einem günstigen Preis von 30 Rappen verkauft. Behörden, gemeinnützige Vereine, Erziehungsvereine und viele andere beteiligten sich daran.
Finanzielle Gewinne waren kaum möglich, weshalb die SJW auf öffentliche und private Unterstützung angewiesen war. 1938 lancierte die SJW zusammen mit Bundesrat Philipp Etter (1891-1977)
erfolgreich eine Spendenaktion, um das «wertvolle Kulturwerk zu erweitern und zu erhalten». Die SJW war eng mit der Stiftung «Pro Juventute» verbunden, welche die Hefte vertrieb und 1954 im Kampf
gegen die Schundliteratur die Figur «Papa Moll» ins Leben rief. Zulliger würdigte die Auswahl der SJW-Geschichten. Sie waren ideal für Kinder, die sich mit den voluminösen Originalbänden schwer
taten. 1944 wurde Zulliger Vorstandsmitglied des SJW.

Zulligers Pfahlbauer werden Klassenlektüre
Prähistorische Siedlungsreste wurden beim Moossee bereits in der Pionierzeit entdeckt. Gerhard Wagner: «Unterhalb des ehemaligen Lehrerseminars Hofwil befindet sich der Moossee. An der Mündung
des Urtenerbachs in den Grossen Moossee ragten Jahrtausende alte Pfähle aus dem Wasser, die ich noch gesehen hatte.» Das traf auch auf Hans Zulliger zu, der während seiner Seminarzeit diese
Pfähle wohl auch gekannt haben musste und so wahrscheinlich zu seiner Pfahlbaugeschichte inspiriert wurde.
Der Moossee, Buchlocation von «Die Pfahlbauer vom Moossee». Foto: Kleiner und Grosser Mossee mit Verbindungskanal, Benjamin Müller, ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv, BY-SA 4.0, ehemaliges Lehrerseminar Hofwil und Einbaum, S.V./P.K.
Barbara Helbling-Gloor stellte in den «Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft Zürich» fest: «1919 brachte Ernst Schneider das Buch ‹Vom
Geschichtsunterricht in der Volksschule› heraus. Für ihn waren die Pfahlbauer ein besonders ergiebiges Unterrichtsthema, da in der Jungsteinzeit viele Fertigkeiten und Erfindungen entwickelt
wurden, die sich mit den Schülern nachspielen liessen. Im selben Buch setzte Hans Zulliger dieses Thema mit einer Unterrichtsskizze praktisch um.» Zum Studium der Pfahlbauer orientiere sich
Zulliger an Aepplis «Die Entdeckung der Pfahlbauten in Obermeilen» (1870), Uhlmanns «Die Pfahlbaualtertümer von Moosseedorf» (1857), Gross‘ «Les Prohelvêtes ou les premiers colons sur les bords
des lacs de Bienne et Neuchâtel» (1883), Messikomers «Die Pfahlbauten von Robenhausen» (1913) und bei der Prähistorische Sammlung im historischen Museum Bern. Zur Einführung der Schüler in die
Kultur dieses Volkes stellte er das Leben eines Dorfes auf dem Moosseedorf dar, den seine Schulkinder von einem Ausflug her kannten.» (114) Helbling-Gloor: «Zulliger erfand Gestalten, die jeweils
eine besondere Aufgabe hatten. Mit ihnen gelang es Zulliger, mehr Gewicht auf die Erfindungen und neuen Fertigkeiten der Jungsteinzeit und beginnenden Bronzezeit zu legen, das Kind in der
Erzählung seine eigenen Beobachtungen machen zu lassen und die eigenen Schüler zur Nachahmung zu animieren. Aus der Unterrichtsskizze entwickelte Zulliger später die Erzählung ‹Die Pfahlbauer am
Moossee›, deren Protagonisten als Individuen gezeichnet sind.»[101]
1921 war im Berner Unterrichtsplan für den Heimatunterricht auch die Behandlung der populären Pfahlbauer vorgeschrieben. Die Behandlung der Urgeschichte setzte ein eingehendes Studium des
Lehrerpersonals voraus. Wagner: «Zulliger schmückte diese Geschichten dann auf erfinderische Weise aus.» Hans Zulliger: «Mir fiel auf, dass Geschichten, die ich und andere Erwachsene für
spannend, interessant und literarisch wertvoll hielten, bei den Kindern keinen besonderen Eindruck machten, während andere, die nach dem Urteil der Erwachsenen ‹nicht so gut› waren, von den
Jugendlichen mit Begeisterung aufgenommen wurden. Mit meinen 12-jährigen Schülern erarbeitete ich die Geschichte von den ‹Pfahlbauern am Moossee›. Der Redakteur der Schweizer Jugendschriften
hörte zufällig von meiner Arbeit und liess sie drucken.»[39]

Mit den Worten «Die Geschichte, die ich euch erzählen will, ereignete sich vor vielen tausend Jahren» begann Zulliger seine Geschichte «Die Pfahlbauer» (SJW-Heft Nr.
26). Es war der gleiche Wortlaut seiner 1919 geschriebenen Unterrichtsskizze. Die Handlung dreht sich um eine Schar von Pfahlbauern, die die Ufer des Moossees besiedeln, allerlei Erfindungen
machen und schliesslich von einem Nachbarvolk, das bessere Werkzeuge aus Bronze besitzt, vertrieben werden. Besonders reizvoll sind die sprechenden Tiere, die erst am Ende verstummen, als sie die
brennenden Hütten der Pfahlbauer betrachten. Das Werk wurde mit prächtigen Zeichnungen ausgestattet, u.a. mit dem Bild «Pfahlbauerin» nach einem Gemälde von Albert Anker oder die 1854 gezeichnete
Rekonstruktion eines Pfahlbau-Dorfs von Ferdinand Keller. Bei dieser Geschichte, so der Schriftsteller Alfred Fankhauser (1890-1973), «kam Zulligers Charakter als fröhlicher Fabulierer zum
Vorschein. Einer, der leidenschaftlich in der Bewegtheit, im abenteuerlichen Geschehen lebt.»[90]
Zulliger: «Die Beurteilung meiner Jugendschriften durch die Kinder stand nicht überall im Einklang mit den Kritiken erwachsener ‹Sachverständiger› überein. So wurde zum Beispiel bei den
‹Pfahlbauern› die für die Kinder sehr spannende Szene, in der der Urochs erlegt wird, als ‹zu roh› empfunden.» [39] Das Lehrpersonal machte im Berner Schulblatt auf «Die Pfahlbauer»
aufmerksam. Eine Lehrerin sprach 1928 begeistert. «Für die Pfahlbauperiode benutze ich seit drei Jahren Zulligers Büchlein als Klassenlektüre. Weil es eine spannende Erzählung in einfacher
Sprache, sind die Schüler mit Leib und Seele dabei.» [88] Am «Internationalen Tag der Güte 1929» behandelte der Lehrer Werner Schmid das Leben der Pfahlbauer und las mit seinen Schülern aus
Zulligers Erzählung: «Meine Schüler fanden es dumm, dass sich die Leute gegenseitig bekämpften, statt in der Wildnis gemeinsame Jagdgefährten zu werden und sich gemeinsam gegen die Unbilden der
Natur zu wehren. Ein Schüler fand heraus, dass wir uns eigentlich schämen müssten, wenn heute ein Pfahlbauer zurückkäme und wir ihm gestehen müssten, dass wir in einem vierjährigen Krieg
Millionen von Franken ausgegeben haben um zehn Millionen Menschenleben zu vernichten.»[89] 1933 schlug die Kommission zur Förderung der Zusammenarbeit der
Primar- und Mittelschulen von Baselland vor, die «Herausgabe literarischer Begleitstoffe für den Geschichtsunterricht mit Arbeiten von Zulliger (Pfahlbauer) zu fördern.» In der Zwischenzeit
erschien vom Berner Gymnasiallehrer Theophil Ischer (1885-1954) «Die Pfahlbauten des Bielersees», die den Leser mit dem neuesten Stand der Pfahlbauforschung vertraut machte. Eine zweiteilige
Buchbesprechung durch Hans Zulliger erfolgte 1929 in der Berner Woche (6. 4. /13. 4. 1929).

1934 beschloss die SJW ihre Hefte als Klassenserien mit verbesserter Papierqualität in Schulbibliotheken zu etablieren. Zu dieser Serie gehörte Zulligers «Die Pfahlbauer am Moossee» (SJW-Heft, Nr. 18, 1934). Es ist eine alternative Version von «Die Pfahlbauer», die die gleiche Geschichte anders erzählt. Der Inhalt war nun, wie der neue Anfang bereits zeigt, wissenschaftlicher gestaltet, der Name Moossee hinzugefügt und wegen Kritiken durch die Lehrerschaft, sprechen die Tiere nicht mehr. Ebenso weggelassen wurden die Zeichnungen. Sie wurden in einer anderen Auflage durch Hans Witzig wieder hinzugefügt, reichten aber nicht mehr an die prächtigen Bilder von «Die Pfahlbauer» heran. Als schultaugliche Version erwies sich «Die Pfahlbauer vom Moossee» als Hit.[39] Nachdem es in bernischen Schulen fleissig gelesen wurde, war es bereits 1935 vergriffen und wurde schnellstmöglich neu aufgelegt. 1941 stellte die Monatszeitschrift «Die neue Schulpraxis» fest, dass «Die Pfahlbauer am Moossee» als Klassenlektüre im heimatkundlichen Unterricht der 4. Klasse diente. Das Blatt «Die Schweizer Schule» (1. 5. 1950): «Hans Zulligers Sprache ist lebendiger Geschichtsunterricht. Hier werden die Schüler mit Spannung dabei sein und die vorgeschichtliche Zeit erleben.» Das Heft wurde in mehreren Auflagen bis 1980 über 600'000-mal verkauft.[42]
2011 fand der Archäologische Dienst Reste einer Siedlung aus der Zeit um 3800 vor Christus. Dabei wurde ein noch älterer 6'500-jähriger Einbaum aus Lindenholz freigelegt. Seine verschiedenen verkohlten Stellen könnten auf ein Aushöhlen mithilfe von Feuer zurückgehen. Das älteste Wasserfahrzeug der Schweiz wird in einer Spezialvitrine ausgestellt. Das Innere zeigt eine Panoramazeichnung aus der Jungsteinzeit von Javier Alberich, Basel. Archäologe Adriano Boschetti: «Gäbe es eine Guide Michelin über Archäologie, wäre Moosseedorf auf einem vorderen Rang.»[42]
Zulliger erwähnt in seiner Pfahlbauergesichte die Einbäume, die zum Häuserbauen und Fischen benutzt werden: «Eine Schar Krähen flog auf einen Einbaum und begann laut zu reden. Einige Männer höhlten mit Feuer und Steinaxt einen mächtigen Baumstumpf aus. Einer stiess den Kahn ab und ruderte unter dem Gejubel der Kinder gegen das Ufer, wo das Schilf hoch und gelb über dem blauen Wasser ragte und rauschend hin und her wogte. In seinem Einbaum schaute er ins Wasser. Da lagen lauter Karpfen, grosse, schöne Tiere, wie eine Herde Schafe beieinander. Eine lange Reihe von Einbäumen kam dahergeschwommen, beladen mit Menschen und Vorräten.»
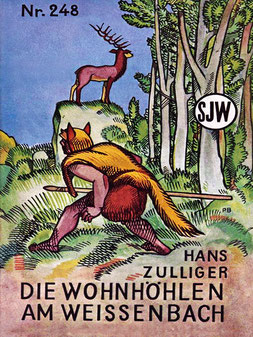
Hans Zulliger: «Der Erfolg bei den Kindern ermutigte mich, mehr in dieser Art zu schreiben.»[39] In «Die Wohnhöhlen am
Weissenbach» ist die dritte Eiszeit angebrochen. Eine Sippe alpiner Höhlenbewohner, deren Arbeit, Leben und Abenteuer dargestellt werden, wandert aus, um im Jura eine neue Bleibe zu suchen. Ein
unternehmungslustiger Knabe steht im Mittelpunkt der Geschichte, die auf den damals neuesten Erkenntnissen der Höhlenforschung beruht. Die Kritik im Berner Schulblatt war vernichtend: «Tiere
‹wissen›, ‹frohlocken›, ‹vermuten› und ‹sinnen› nicht. Der Leser erhält durch diese freie Schreibweise ein falsches Bild von der Natur. Wenn der Verfasser bestrebt ist, ein wahres Bild der Kultur
und der Höhlenbewohner zu zeichnen, so verpflichtet ihn dies, auch der Natur gegenüber wahrhaftig zu bleiben. Nur der Fabel- und Tiererzähler darf sich erlauben, die Tiere zu vermenschlichen.
‹Die Wohnhöhlen am Weissenbach› müssen wir leider als Jugendschrift ablehnen.»[40] Eine andere Meinung vertrat die Lehrerin Emma Eichenberger in der
Schweizerischen Lehrerinnenzeitung: «Für die Behandlung der Urgeschichte brauche ich die beiden Zulligerschen SJW-Hefte ‹Die Wohnhöhlen am Weissenbach› und ‹Die Pfahlbauer am Moossee›. Alles, was
der Schüler über die Urgeschichte wissen muss, ergibt sich aus diesen Erzählungen und ihren Besprechungen.»[41] Das Buch erlebte mehrere Auflagen.
«Türlü und die Kameraden» ist die Gechichte wahrer Freundschaft. Ein paar Jungen wollen ihrem Kameraden Türlü, einem armen Verdingbuben, helfen und verhindern, dass er wegen eines Diebstahls, den
er nicht begangen hat, ins Erziehungsheim kommt.
Der machthungrige spanische Konquistador Hernán Cortés (1485-1547) eroberte 1519 das Aztekenreich. Hans Zulliger schilderte 1927 seine Geschichte unter dem Titel «Mit Cortez nach Mexiko» als SJW-Abenteuervierteiler: Der 19-jährige Schweizer Lateinschüler Peter Brügger entscheidet sich, statt die Schulbank zu drücken, auf Abenteuersuche zu gehen. Zusammen mit den Mailändern reist er im Jahr 1514 in die Lombardei, wird in Pietro del Ponte getauft und fährt anschliessend nach Kuba. 1519 landet er zusammen mit Ferdinand Cortez an der Küste von Mexiko. Pietro, der nun zur Leibwache des Feldherrn gehört, sieht sich die Wunder der Stadt an, gelangt in den königlichen Privatpalast und wird Zeuge der Gefangennahme Montezumas. Pietro wird in allerlei Kämpfe verwickelt …
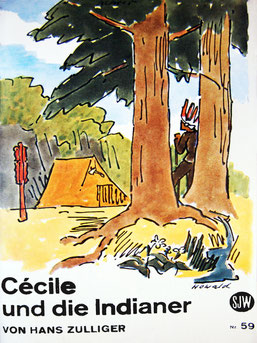
In «Die Verschwörung der Scherbenfischer von Hirzenbrünnen» verletzt sich ein Mädchen im Strandbad Hirzenbrünnen an einer Glasscherbe, die von einem Unbekannten absichtlich verstreut wurde. Fünf Kinder spielen Detektiv und überführen den Täter.
In «Cécile und die Indianer» hat Zulliger die Umgebung von Biel poetisch verewigt. Zu den Schauplätzen gehören der «rebenbewachsene Strandboden am See» und der Aussichtspavillon Felseck. Der Weg dorthin ist als Federzeichnung von Herold Howard zu sehen. Das von Zulliger beschriebene «runde Kuppeldach, das sich zu einer hohen Fahnenstange zuspitzt», musste später wegen Baufälligkeit abgebrochen werden. Erwähnt wird auch der grosse Findling Graustein oder Kindlistein: «Ein mächtiger Felsblock, so gross wie ein halbes Zimmer, sperrt den Weg.» Die Geschichte erzählt von einem Indianerkrieg zwischen einer Bande von Jungen. Der Kampf wird durch den Hilferuf eines von einer Viper gebissenen Mädchens beendet. Die Indianer welscher und deutscher Sprache helfen gemeinsam. Nach der Rettung des Mädchens wird das Kriegsbeil begraben. An die Stelle der Indianerbande tritt eine fröhliche Wandergruppe.
Bieler Buchlocation von Cécile und die Indianer. Klicken Sie auf die Bilder , um sie zu vergrössern.

Auch ausserhalb der SJW-Buchreihe schrieb Zulliger unterhaltsame Kindergeschichten. Hans Zulliger: «Das Büchlein ‹Die Leute im Fluhbodenhüsli› entstand in engem Kontakt mit meinen Zwölfjährigen und wurde dann mit Dreizehn- bis Fünfzehnjährigen besprochen. Es wurde eines der meistgelesenen in der Reihe der Jugendschriften des Schweizerischen Abstinenten Lehrervereins. Allerdings wurde es von den Erwachsenen manchmal als ‹zu wenig literarisch› abgelehnt.»[39] Im November 1926 beschloss der Regierungsrat Zulligers Jungbrunnenheft «Von den Leuten im Fluhbodenhüsli» als Klassenlektüre für das 7. Schuljahr der Primar-, Sekundar- und Bezirksschulen zu verwenden.[8] Die Leute im Fluhbodenhüsli» fand einen derart guten Absatz, das bereits am Dezember 1926 eine zweite, grosse Auflage mit neuem Umschlag und für 20 statt 30 Rappen erschien.
Hans Zulliger: «Eine Erzählung, die ich speziell für ältere Jugendliche (Fortbildungsschüler) schrieb, hiess ‹Der Besondere› und erschien 1932 als Berner Heft im Verlag des Vereins zur Verbreitung guter Schriften (VGS). Obwohl sie von den Jugendlichen gerne gelesen wurde, erntete die Geschichte in einer Rezension einer Lehrerin in einem Schulblatt nur Kopfschütteln».[39] Diese Bauerngeschichte aus dem bernischen Seeland schildert, wie ein Bauernsohn Handwerker statt Bauer werden will, den Konflikt mit seinem Vater und die Liebe zu einem armen Mädchen. Das Büchlein kostete 50 Rappen.

Für die 10- bis 14-Jährigen erschien 1957 in der Stern-Reihe des Evangelischen Verlags Zollikon das Kinderbuch «Mützel - die Geschichte eines Knaben». Der Kunstpädagoge Alfred Kobel (1925–2011) zeichnete das farbige Titelbild. Zum Inhalt: Wird er es schaffen? Diese bange Frage lastet auf Mützel und seinen Eltern, als er in die Sekundarschule kommt. Diese Frage erdrückt ihn beinahe. Erst als er die Sekundarschule verlässt und aufs Land geht, kann er wieder aufatmen. Die Geschichte zeigt, dass man auch ohne «höhere» Schule etwas erreichen kann.
«Joachim bei den Schmugglern» (225 Seiten) und die Fortsetzung «Joachim als Grenzwächter» (290 Seiten) gehören zu Zulligers besten Jugendbücher, Im wilden Simplongebiet gerät der Bergbauernsohn Joachim in das dunkle Milieu der Schmuggler, die ihn in ihre Geheimnisse einweihen. Eines Tages lernt er einen sympathischen Grenzwächter kennen und freundet sich mit ihm an. Schliesslich wird er selbst Zöllner. Wird Joachim nun seine alten Freunde verraten? Die Neue Schulpraxis (März 1937) lobte: «Die Verhältnisse an der Südgrenze werden scharf beleuchtet, die Romantik des Schmugglerlebens nimmt uns gefangen. Das Simplongebiet wird in allen Einzelheiten geschildert. Viele alte Sagen, Jagd- und Schmugglergeschichten sind in die Handlung eingeflochten. Zulliger gelingt es, von Anfang bis Ende spannend zu erzählen. Die Dialoge sind stellenweise äusserst schlagfertig».
«Joachim als Grenzwächter war der wichtige Impuls für die Berufswahl eines ehemaligen Grenzwächters.»
Mirella Carbone / Joachim Jung, Grenz-Erfahrungen, V: Hier und Jetzt, 2024
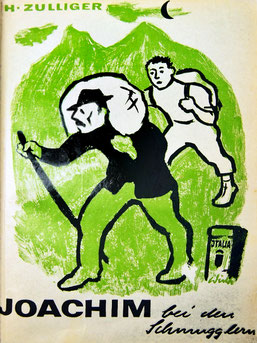
Im zweiten, ebenso spannenden Teil muss Joachim an der Grenze zwischen Graubünden und Italien eine gefährliche Schmugglerbande aufspüren und entlarven. Dem Buch liegt eine Karte der Gegend bei, in der die Geschichte von Joachim und seinen Kameraden spielt.
Hans Zulliger veröffentlichte weitere Beiträge in verschiedenen Jugendzeitschriften, darunter die 1926 von evangelisch-reformierten Pfarrern in Zürich gegründete illustrierte Wochenzeitschrift «Leben und Glauben». Die in Solothurn gedruckte Jugendzeitschrift «Der Schweizer Schüler» bot kürzere und längere Geschichten, Reisebeschreibungen sowie Spezialseiten zu verschiedenen Schulfächern. Für 40 Rappen pro Woche fanden Lehrer und Erzieher darin wertvolle Tipps zur Unterrichtsgestaltung. Die «Schweizer Jugend» war eine konfessionell neutrale Wochenschrift für Buben und Mädchen der Oberstufe, die vom Schweizer Jugend Verlag in Solothurn herausgegeben wurde. «Jugendborn» war eine konfessionell neutrale Monatsschrift für Buben und Mädchen der Oberstufe, herausgegeben von der Jugendschriftenkommission des Schweizerischen Lehrervereins im Verlag H. R. Sauerländer & Co., Aarau. Die Familienzeitschrift «Die Garbe» hatte der Berner Dichter und Schriftsteller Rudolf von Travel (1866-1934) in Basel gegründet und wurde später vom Bolliger Mundartdichter Ernst Balzli (1902-1959) geleitet. Sie erschien im Verlag Friedrich Reinhardt in Basel und zeigte ausschliesslich Originalarbeiten. An der Spitze jeder Ausgabe stand ein Roman oder eine Erzählung, gefolgt von einem illustrierten Artikel mit historischen, kunstgeschichtlichen, naturwissenschaftlichen oder biographischen Inhalten. Diesem schlossen sich Novellen, Skizzen und Reisebeschreibungen an. In jeder Nummer fand sich eine Kunstbeilage, die sich als Wandschmuck in einem Wechselrahmen präsentieren liess.
1961 erschien im Verlag Gute Schriften das Jugendbuch «Röbi und die Mäuse». Es handelt von einem Findelkind, das gegen allerlei Verführung ankämpft und sich schliesslich den richtigen Weg erkämpft. Elisabeth Bühler empfahl das Buch im Berner Schulblatt (28. 10. 1961): «Es ist eine alltägliche, sympathische Kindergeschichte, schlicht und wahrheitsgetreu erzählt. Die meisten Kinder werden sich an der Schuldverstrickung Röbis und in seiner Sorge um Entlastung eigener Nöte und Probleme wiederfinden.» Das Oberländer Tagblatt (7. 6. 1961) schreibt: «Die erzieherische Absicht, die hinter der Geschichte steckt, tritt hinter dem flüssigen Verlauf der Erzählung und der Menge echter Charakterfiguren, die diese präsentiert, klug zurück.» 1962 überreichte Hans Zulliger an der Generalversammlung des Vereins Guter Schriften jedem Mitglied ein persönlich signiertes Exemplar. Professor Reinhard Fatke gelang 2021 eine ausführliche psychologische Literaturinterpretation von «Röbi und die Mäuse».[86]
Aus Pestalozzis schwerster Zeit. Szene: Pestalozzi blickt auf den beschäftigten Friedli. (Der Spatz, Jan. 1946); Der Fluhbodenpeekli. Szene: Bänz, Lisbeth und Jakob machen zusammen ein Spielchen. (Der Spatz, April 1947), Der Weisse Bär auf dem Roda-Pass (Schweizer Jugend, 10. 4. 1948)
Redakteur vom «Spatz»
Hans Zulliger war auch Redakteur vom «Spatz», einer konfessionell neutralen Monatsschrift für Buben und Mädchen der Mittel- und Oberstufe, die im Verlag Orell Füssli
erschien. Unter der Mitwirkung von seinem Bruder, dem Primarlehrer Peter Zulliger enthalten die Hefte neben dem literarischen Teil auch technische und naturkundliche Beiträge, Bastelanleitungen,
Wettbewerbe und Rätsel. «Der Spatz» suchte sich aus den verschiedenen Autorenbeiträgen eine spezielle Szene aus und brachte diese als hübsche Zeichnung auf dem Titelblatt. Auf der Rückseite gibt
es eine Bildergeschichte. Das Buchbesprechungs-Jugendbuch, herausgegeben von der Jugendschriftenkommission des Schweiz. Lehrervereins, hielt den «Spatz» für empfehlenswert, auch wenn «die
in reichlich knalligen Farben gehaltenen Titelblattbilder im Blick auf die Konkurrenz der Schundhefte bewusst ausgesprochen reisserisch gestaltet sind. Dafür gibt es Texte auf hohem
Niveau.»[62]
An der Eröffnung der Zürcher Jugendbuchwoche 1961 hielt Hans Zulliger einen Vortrag über die Lieblingslektüre von Kindern. Dies war für die anwesenden Eltern sowie für die Autoren von Kinder- und Jugendbüchern gleichermassen aufschlussreich.
Eindrücke während des Zweiten Weltkriegs
Am 20. November 1940 schrieb Hans Zulliger Simon Gfeller: «Innerlich drückt mich dieser verfluchte Krieg. Wenn ich daran denke, dass irgendwo auf der Welt Bomben auf Städte fallen und jemand im Drahtverhau hängt und schreit, dann bin ich gelähmt. Wenn ich dann bei Festen mithelfe und dabei gut esse, bin ich nur dabei, wie einer, der nicht Spielverderber sein mag. Mir ist, als würde ich auf gebrochenem Eis Schlittschuh laufen.»[80] Während des Zweiten Weltkriegs leistete Zulliger Militärdienst an der Grenze. Als er im September 1940 in einer dienstfreien Woche den kinderpsychologischen Kongress in Wien besuchte, prägten ihn diese neuen Eindrücke nachhaltig: «Ich ging nicht nur des Kongresses wegen hin, sondern auch, um mich ein wenig umzusehen. Ich war erstaunt zu sehen, wie sehr alles zu Hitler hält und von ihm das Heil erwartet. Ich hörte von meinen Bekannten nur eine kritische Stimme. Ausserdem war vieles anders, als wir es uns hier gestützt auf – wohl tendenziöse – Presseberichte vorgestellt hatten.»[80] Zunächst schilderte er seinen Besuch im Bund (2. 10. 1940) unter dem Titel «Streiflichter aus Wien im September 1940». Wenn man diesen Beitrag heute liest, ist man über den oberflächlichen Bericht, in dem die Wiener in Kriegszeiten immer freundlich lächelnd beschrieben werden, doch sehr überrascht. Zulliger sagte dazu: «Man hat mir über meinen zensurierten Artikel im ‹Bund› allerlei Vorwürfe gemacht. Ich sei umgefallen etc. Das ist natürlich Kabis. Daraufhin veröffentlichte Zulliger einen weit aufschlussreicheren Bericht in der Berner Woche (9. 11. 1940) mit dem Titel «Wien-Fahrt im September 1940». Beide Berichte sind wichtige Zeitdokumente zu einem Thema, zu dem damals nur wenige Schweizer Prominente Stellung nahmen.
Hans Zulliger: «Im Zug fragte mich ein Soldat ‹Sind Sie Schweizer? Da leben Sie ja im Schlaraffenland!›. Als ich ihm erklärte, dass in der Schweiz vieles rationiert
sei, reagierte er erstaunt: ‹Sie wollen mich doch zum Narren halten!›. Plötzlich blitzt ein rotes Licht durch den Vorhang. In etwa einem Kilometer Entfernung lodern gewaltige Brände. In Wien
angekommen hingen an den Häusern statt des Bildes des österreichischen Staatspräsidenten das des Führers und die Fahnen mit dem Hakenkreuz und den italienischen Farben. Die Tatsache, dass es
keine Arbeitslosigkeit mehr gibt, scheint besonders bei der Arbeiterschaft alle Sympathien für das Dritte Reich erworben zu haben. Der Kleiderkauf ist rationiert: mehr als ein Kleid pro Jahr ist
kaum möglich. ‹Volksgenosse, punkte richtig!› ist zu lesen. ‹Richtig punkten› bedeutet, sich seine Einkäufe mit der Kleiderkarte genau zu überlegen. Hundert Punkte stehen einem zur Verfügung. Ein
Herrenanzug wird mit 60, eine Hose mit 20, eine Krawatte mit 3, ein Paar Socken mit 5, ein Taschentuch mit 2 und eine Windjacke mit 25 Punkten berechnet. Auch die Lebensmittel sind teilweise
rationiert. Man hat den Eindruck, dass kaum jemand hungern muss. Das Essen beim Militär sei ‹tadellos›, und die Urlauber erhalten besonders reichlich dotierte ‹Urlauber-Lebensmittelkarten›.
Zeitungsverkäufer rufen Morgenblätter aus. Oben springt mir eine rote, dicke Aufschrift ins Auge: ‹Deutsches U-Boot versenkt 64 BR!›. Aufschriften und Sentenzen sind zahlreich an Häuserwänden, in
Schaufenstern usw. angeschlagen: ‹Früher gab es Fürsorge, jetzt gibt es nur noch Vorsorge!›, ‹Hier treten Juden nur auf eigene Verantwortung hin ein!›, ‹Schweige, der Feind horcht! ›. Da und dort
sind besondere Aussprüche von Mussolini, in grossen Lettern Sätze von dem Führer hingemalt, die jedermann die Tendenzen des neuen Staates einprägen. Was ‹der Führer› anordnet, gilt als das Beste.
Das ‹Wien ist bei Nacht erst schön!› gibt es kaum noch. Wieder Zuhause fühlt man: Man würde unser kleines Land mit Krallen und Zähnen verteidigen, wenn uns jemand angreifen würde. Dieses Gefühl
bewegt einen noch zehnmal stärker, wenn man im Ausland gewesen ist!». Im Januar 1942 rief Zulliger in der Schweizer Presse mit Gedichten zur «Metallspende für Arbeit und Brot» auf:
Bürger, es droht uns die Rohstoffnot!
Spendet Metalle für Arbeit und Brot! [34]
Altmetall verschwende nie:
Es gibt Rohstoff für die Industrie. [44]

Hans Zulliger erinnert sich in der Elternzeitschrift vom Januar 1950 an den Zweiten Weltkrieg: «Während der Grenzbesetzung leisteten viele Mütter schier Unmögliches
und verrichteten Arbeiten, die sonst den Männern vorbehalten waren. So manche Frau hatte sich zu Hause überanstrengt, während der Mann im Militärdienst ‹Urlaub› machte. In vielen Familien waren
die Kinder nicht nur vater-, sondern auch elternlos. Meine Nachbarn, einfache Bauern, nahmen im Frühjahr 1945 einen kleinen französischen Jungen bei sich auf. Er stahl alles, was ihm in die Hände
fiel: Lebensmittel, Werkzeuge, Spielzeug, sogar Gerümpel und Unrat, und legte damit ein Lager hinter dem Heuboden an. Erst nach Monaten, als er merkte, dass ihm niemand etwas wegnahm und er immer
genug zu essen hatte, wurde er ehrlich. Die Nachbarn bestraften ihn nicht, sondern lächelten nur. Die Liebe und Achtung seiner Pflegeeltern hatten ihn geheilt.»[46]
Hans Zulliger als Jurymitglied
1945 lancierte die Arbeitsgemeinschaft Pro Helvetia einen Wettbewerb für künstlerisch wertvolle Romane, die sich mit Sinn und Wert der Familie für den Einzelnen und die Gemeinschaft
auseinandersetzen. Hans Zulliger war Mitglied der Jury.
Die Bieler Jungbürgerfeier
1959 wurden die Zwanzigjährigen an der Jungbürgerfeier in Biel feierlich als stimm- und wahlberechtigt aufgenommen. Hans Zulliger sprach auf der Kanzel der Stadtkirche. Die Bieler
Sekundarlehrerin Barbara Ryffel erinnerte daran, dass die Jungbürgerinnen wegen des fehlenden Frauenstimmrechts leider immer noch nicht politisch mündig seien. Zulliger appellierte an den
Gemeinschaftsgedanken: «Wir leben nicht einzeln, sondern miteinander. Diese Generation wird es wohl endlich erleben, dass die Frau an die Urne geht und gleichberechtigt mit dem Mann unser
öffentliches und staatliches Leben mitgestaltet».[31] 1969, also erst zehn Jahre später, wurde in Biel das Frauenstimmrecht angenommen und Claire-Lise Renggli zur ersten Stadträtin gewählt.
Literarische Veröffentlichungen (Auswahl):
1913:
München-Reise des Oberseminars
Zeichnen und Handarbeit, Nr. 4, S. 61-64
1916:
Alemannen - Franken
Beiträge z. Geschichtsunterricht in der Volksschule, Bern, V: Suter, 126 S.
Bestimmung. Gedicht.
Die Berner Woche, 7. 10.
Der Fischer von Vira
Die Berner Woche, 4. 11., S. 535
Die Schweizerische Liebestätigkeit im Weltkrieg
Die Berner Woche, 4. 11 (S. 531-534), 11. 11. (S. 544-546), 18. 11. (S.556-559)
Drei Weihnachtsgedichte
Die Berner Woche, 23. 12., S. 616
1917:
Wunsch. Gedicht.
Die Berner Woche, 10. 2., S. 61
Das war… Gedicht.
Die Berner Woche, 10. 2., S. 61
Das Tier
Die Berner Woche, 8. 9., S. 426-428
Dämmerstunde
Berner Woche, 22. 9. S. 452
Am helig Abe. Gedicht.
Berner Schulblatt, 1. 12., S. 589
Är Wiehnacht. Gedicht.
Berner Schulblatt, 1. 12., S. 589
Ergötzliches Vieh. Kleine Satiren
Der Bund, 2. 12., S. 766-67
Schneeschtärndli. Gedicht.
Berner Schulblatt, 8. 12., S. 601
Samichlaus. Gedicht.
Berner Schulblatt, 8. 12., S. 601
Bim Gloggelütte. Gedicht.
Berner Schulblatt, 15. 12., S. 613
Es Tanndli. Gedicht.
Berner Schulblatt, 15. 12., S. 613
1918:
Bärner Wiehnecht: Värsli
Bern, V: Francke, 72 S.
Gerechtigkeit. Fabel.
Die Schweiz, Bd. 22, S. 169
Gottesurteil. Fabel.
Die Schweiz, Bd. 22, S. 169
Der Pöbel. Fabel.
Die Schweiz, Bd. 22, S. 169
Der Apostel. Fabel.
Die Schweiz, Bd. 22, S. 169
Der Geehrte. Fabel.
Die Schweiz, Bd. 22, S. 169
Das Urteil der Krähe. Fabel.
Die Schweiz, Bd. 22, S. 170
Unterbrochene Laufbahn. Fabel.
Die Schweiz, Bd. 22, S. 646
Selbsterkenntnis. Fabel.
Die Schweiz, Bd. 22, S. 646
Wenn zwei dasselbe tun. Fabel.
Die Schweiz, Bd. 22, S. 646
Kritik. Fabel.
Die Schweiz, Bd. 22, S. 646
Zweierlei Feinde. Fabel.
Die Schweiz, Bd. 22, S. 646
Wertbewusstsein. Fabel
Die Schweiz, Bd. 22, S. 647
Opfer der Konfession. Fabel.
Die Schweiz, Bd. 22, S. 647
Der Ausreisser
Die Berner Woche, 5. 1. (S. 7-8), 12. 1. (S. 19-20)
Zwischberger Sagen: Der falsche Priester
Die Berner Woche, 19. 1., S. 31-32
Zwischberger Sagen: Der Jäger auf der Fluh
Die Berner Woche, 19. 1., S. 32
Zwischberger Sagen: Die römischen Münzen
Die Berner Woche, 26. 1., S. 48
Zwischberger Sagen: Der Jäger und sein Schatten
Die Berner Woche, 26. 1., S. 48
Zwischberger Sagen: Der glückhafte Terbiner Schuster
Die Berner Woche, 26. 1., S. 48
Drei Sagen aus Zwischbergen: Der unselige Knecht
Der Bund, 6. 2., S. 2
Drei Sagen aus Zwischbergen: Die beiden Brüder
Der Bund, 6. 2., S. 2
Drei Sagen aus Zwischbergen: Die goldene Kugel
Der Bund, 6. 2., S. 2
Minister Alfred Ilg - Ein Lebensbild
Die Berner Woche, 23. 3. S. 169-171
Friedhofkunst
Die Berner Woche, 25. 5., S. 276-278
Bildnis. Gedicht
Die Berner Woche, 26. 10., S. 544
Auf Beobachtungsposten
Die Berner Woche, 16. 11., S. 578-80
Ds Buebi sait. Gedicht.
Zur Praxis der Volksschule, Nov. / Dez. 1918, S. 31
Ds Meiti sait. Gedicht.
Zur Praxis der Volksschule, Nov. / Dez. 1918, S. 31
S’Bäumli. Gedicht.
Die Berner Woche, 21. 12., S. 638
Bim Vernachte. Gedicht.
Berner Schulblatt, 21. 12., S. 561
Zwinglis Wirken in Zürich
Die Berner Woche, 28. 12., S. 649-651
1919:
Sagen aus Zwischbergen: Das Tschuggen-Mannji
Die Schweiz, Band 23, S. 211-212
Sagen aus Zwischbergen: Die Heidentaufe
Die Schweiz, Band 23, S. 212
Sagen aus Zwischbergen: Der verborgene Schatz
Die Schweiz, Band 23, S. 212-214
Die Bedingung. Fabel.
Die Schweiz, Bd. 23, S. 308
Der Prophet. Fabel.
Die Schweiz, Bd. 23, S. 308
Kriterium. Fabel.
Die Schweiz, Bd. 23, S. 308
Der Exot. Fabel.
Die Schweiz, Bd. 23, S. 308
Selbstbewusstsein. Fabel.
Die Schweiz, Bd. 23, S. 308
Trost. Fabel.
Die Schweiz, Bd. 23, S. 308
Der Bildungsphilister. Fabel.
Die Schweiz, Bd. 23, S. 308
Das Über-Blatt. Fabel.
Die Schweiz, Bd. 23, S. 308
J-A-ismus. Fabel.
Die Schweiz, Bd. 23, S. 308
Der Märtyrer. Fabel.
Die Schweiz, Bd. 23, S. 309
Das ersehnte Neue. Fabel.
Die Schweiz, Bd. 23, S. 309
Em Tanndlis Traum. Gedicht.
Schulpraxis, Nr. 6, S. 49
I’r heilige Nacht. Gedicht.
Schulpraxis Nr. 6, S. 50
Was ächt? Gedicht.
Schulpraxis Nr. 6, S. 49
Wiehnechts-Aengeli. Gedicht.
Schulpraxis Nr. 6, S. 49
Die Kerze. Gedicht.
Die Garbe, 1. 7., S. 590
Gräberschmuck
Berner Woche, 27. 12., S. 619-621
1920:
Entweder - oder… Fabel.
Die Schweiz, Bd. 24, S. 188
Hilfe in der Not. Fabel.
Die Schweiz, Bd. 24, S. 188
Die Autorität. Fabel.
Die Schweiz, Bd. 24, S. 188
Vox populi. Fabel.
Die Schweiz, Bd. 24, S. 188
Gegensätze. Fabel.
Die Schweiz, Bd. 24, S. 188
Philosophie. Fabel.
Die Schweiz, Bd. 24, S. 188
Daseinsberechtigung. Fabel.
Die Schweiz, Bd. 24, S. 188
Psychologie der Massen. Fabel.
Die Schweiz, Bd. 24, S. 188
Charakter. Fabel.
Die Schweiz, Bd. 24, S. 188-189
Schein und Sein. Fabeln.
Die Schweiz, Bd. 24, S. 189
Vor en arme Seel: en alti Gschicht
Der kleine Bund, 25. 1., S. 30
Der Geiger
Die Garbe, 1. 2., S. 283-284
Kleine Satiren
O mein Heimatland, S. 78-79, S. 216-17
Vom Botti u syr Schwester
Der kleine Bund, 16. 5., S. 158
Die Naselumpe
Die Berner Woche, 29. 5., S. 260-261
Wüeschtwätter-Musig
Der kleine Bund, 18. 7., S. 228-29
Der Chugelfescht
Die Berner Woche, 9. 10. (S. 488), 16. 10. (S. 500)
Bärndütsch
Der Bund, 29. 10., S. 3
1798. Seeländerdütsches Gedicht
Bieler Tagblatt, 30. 10., S. 175
Psychologie eines Pechvogels
Berner Schulblatt, 11. 12., S. 575-577
Das Krönlein - Aus dem Leben eines Kindes
Die Berner Woche, 25. 12., S. 633-634
Wie schön. Vers.
Die Berner Woche, 25. 12. S. 641
An der Grenze
Lesebuch für das 6. Schuljahr der Primarschulen des Kantons Bern, S. 171-174
1921:
Der Muni
Der kleine Bund, 13. 2., S. 42-43
Vom Geristeizwärgli
Der kleine Bund, 10. 4., S. 111-112
Eduard Huber - Ein schweizerischer Indochinaforscher
Berner Woche, 9. 4. (S. 162-64), 16. 4. (S. 174-176)
Venedig
Die Garbe, 1. 5., S. 477-478
Kleine Satiren
O mein Heimatland, S. 15-19
Ds Unghüür im Bode
Berner Woche, 14. 5., S. 224-225
Emanuel Friedli’s «Bärndütsch»
Die Garbe, 15. 5., S. 493-496
Lehrer, sie rauchen
Berner Woche, 27. 8., S. 404-405
Der Tabak und das Rauchen
Berner Woche, 26. 11. 1921, S. 568-569
Der letscht Ritter vom Geristei
Die Schweiz, Band 25, S. 657-660
Mein Freund Wendelin, eine Charakterstudie
Die Schweiz, Band 25, S. 90-92
Ds Wingeli. Gedicht.
Heimatschutz, Jan. / Feb.
1922:
Unghüürig, Alti Gschichte us em Batigergebiet
Bern, V: Francke, 72 S.
aka: Palantöz: cumedia in duos acts, La Scena, Nr. 24, 1960
Philister. Vers.
Nebelspalter, 4. 1., S. 7
Scheussliche Rache des Fabeldichters
NZZ, 15. 1.
Wasserleitung am Lötschberg
Die Berner Woche, 28. 1., S. 46-49
Parteigeist
Nebelspalter, 1. 2., S. 5
Glossen: Auf eine Autorität
Nebelspalter: 28. 3., S. 9
Glossen: Urteil des Alters
Nebelspalter: 28. 3., S. 9
Glossen: Mensch - noblesse oblige
Nebelspalter: 28. 3., S. 9
Ausgestossene
Die Berner Woche, 22. 4., S. 208-209
Der Jeger u sy Bläss
Der kleine Bund, 23. 4., S. 123-124
Summernacht. Gedicht.
Der Bund, 30. 7., S. 4
Vo men alte Lidige
Der kleine Bund, 24. 9., S. 298-299
Der Tod
Der kleine Bund, 29. 10., S. 338
Vo me ne Sonderbundsveteran
Berner Woche, 16. 12. (S. 680-81), 23. 12. (S. 692-93)
1923:
Es Roseblettli
Berner Woche, 10. 3. (S. 124-125), 17. 3. (S. 136-137)
Völkerpsychologisches zur Frauenbewegung
Die Berner Woche, 28. 4., S. 209-210
Lebenserinnerungen von Professor A. Tschirch, Bern
Die Berner Woche, 9. 6., S. 278-280
Schlüüftübeli
Der kleine Bund, 17. 6. S. 185-186
Das verräterische Löschblatt
Die Berner Woche, 3. 11., S. 561-562
Chnüderlis Wiehnechtsbäumli
Die Berner Woche, 29. 12., S. 672-673
Wäge me Wiehnechtsbäumli
Neue Berner Zeitung, 22. 12.
1924:
Die Pfahlbauer
Bern, V: SJW, Nr. 26, 48 S.
Myner chlyne Habche
Albes, wo mer jung sy gsi. Kindheitserinnerungen, Zürich, V: Orell Füssli, 45 S.
Der Tuefel bim Chartespiele
The Swiss Observer, 12. 1., S. 839
Bleisoldaten
Der Bund, 16. 3., S. 5
Der Rothebüeler Niggel
Der kleine Bund, 30. 3., S. 99-102
Ein Matriarchat
Die Berner Woche, 22. 3., S. 160-162
Die Couvade
Die Berner Woche, 29. 3., S. 175-177
Über Gespensterfurcht
Die Berner Woche, 3. 5., S. 244-246
Kleines Frühlingslied. Gedicht.
Der kleine Bund, 11. 5., S. 145
Die Linden. Gedicht.
Der kleine Bund, 11. 5., S. 145
Blühender Birnbaum. Gedicht.
Der kleine Bund, 11. 5., S. 145
Tutanchamon
Berner Woche, 31. 5. (S. 300-202), 7. 6. (S. 314-216)
Zum Bärndütsch-Fescht
Der Bund, 8. 6., S. 2-3
Trutzliedli
Neue Berner Zeitung, 21. 6., S. 97
Vereine, Theater und Schriftsteller
Der Bund, 26. 6., S. 1-2
Auf der Plattform
Der Bund, 18. 7., S. 1-3
Henry Ford
Berner Woche, 16. 8., S. 456-458
Nach dem Gewitter. Gedicht.
Neue Berner Zeitung, 20. 9., S. 149
Gugutzli
Der kleine Bund, 19. 10., S. 330-334
Coués Lehre
Die Berner Woche, 1. 11., S. 612-13
Ds Oepfelbrötli
Der kleine Bund, 2. 11., S. 345-47
Huebacher-Ruedelis Wiehnechtsbaum
Die Berner Woche, 20. 12. (S. 714-715), 27. 12. (S. 730-731)
1925:
Bi üs deheime - Erzählungen aus dem Bernbiet
Basel, V: Reinhardt, 133 S.
Von den Leuten im Fluhbodenhüsli
Bern, V: Alkoholgegnerverlag, 24 S.
Für all Fäll! - Mundartlustspiel in 4 Aufzügen
Bern, V: Francke, 112 S.
Klassenlektüre
Schulpraxis, Nr. 2/3, S. 38-42
Meinrad Lienert
Die Berner Woche, 16. 5., S. 314-315
Frauenleben in Afrika
Berner Woche, 4. 7., S. 422-424
Kindergärten
Die Berner Woche, 22. 8., S. 537-540
Der Trachtenumzug
Berner Woche, 19. 9., S. 599-602
Schweizerische landwirtschaftliche Ausstellung in Bern
De Berner Woche, 26. 9., S. 618-620
1926:
Fasnachtsgebräuche im Kanton Bern
Berner Tagblatt, 13. 2. 1926, S. 5
Mittelholzers Persienflug
Berner Woche, 6. 3., S. 148-151
Hilfe für Lambarene
Der Aufstieg, März
Karfreitags- und Ostergebräuche im Kanton Bern
Der Bund, 2. 4., S. 1-2
Reise nach Zentralbrasilien
Die Berner Woche, 10. 4. 1926, S. 228-231
Rychebüehl
Der kleine Bund, 27. 6., S. 205-206
Schüleraufsätze zu Georg Küffers Bildermappe «Leben und Tod»
Schulpraxis Nr. 6, S. 97-105
Ds Zälgacherli
Die Berner Woche, 11. 9 (S. 586-587), 18. 9. (S. 603-604), 25. 9. (S. 619-621), 2. 10. (S. 636-637)
1927:
Mit Cortez nach Mexiko 1: Nach dem Wunderland El Dorado
Bern, V: SJW, Nr. 54, 31 S.
Mit Cortez nach Mexiko 2: Im Land der Azteken
Bern, V: SJW, Nr. 55, 29 S.
Mit Cortez nach Mexiko 3: Montezuma und seine Stadt
Bern, V: SJW, Nr. 56, 28 S.
Mit Cortez nach Mexiko 4: Wiedereroberung Mexikos
Bern, V: SJW, Nr. 57, 30 S.
Pestalozzi - Bilder und Gedanken
Die Berner Woche, 12. 2., S. 94-98
Nordamerikanische Eskimos
Die Berner Woche, 12. 3., S. 154-156
Rings um Niederkalifornien
Berner Woche, 2. 4., S. 200-202
Der Verbouscht
Die Garbe, 31. 7., S. 655-660
Lou nach zehn Jahren
Der kleine Bund, 30. 10., S. 347-349
Nume kener Eier
Berner Woche, 17. 12., S. 757-759
1928:
Masken
Bern, V: Haupt, 20 S.
Die Lebenden und die Toten
Bern, V: Haupt, 20 S.
Es Näbeverdienschtli
Die Garbe, 15. 2., S. 301-307
Auf den Spuren der Konkuistadoren
Die Berner Woche, 3. 3. (S. 124-26), 10. 3. (S. 138-139)
Die Nacht in Zwischbergen
Der kleine Bund, 8. 7., S. 217-219
Admundsens Nordpolfahrt mit der Norge
Berner Woche, 30. 11., S. 708-711
1929:
Der Anfang - Eine Dorfgeschichte aus dem Bernbiet
Bern, V: Gotthelf, 32 S.
Pfahlbauten am Bieler See
Die Berner Woche, 6. 4. (S. 202-04), 13. 4. (S. 217-19)
1930:
Buebebärg. Gedicht.
Der kleine Bund, 20. 4., S. 125
Der sträng Richter - Zu Niklaus Manuels 400. Todestag
Der Bund, 30. 4., S. 1
A der Gränze. Gedicht.
Der kleine Bund, 5. 5., S. 166-167
A der Sänse. Gedicht.
Der kleine Bund, 25. 5., S. 166
Leuebärger Chlaus. Gedicht.
Der kleine Bund, 25. 5., S. 166
Opfer: am 31. Meje 1508. Gedicht.
Der kleine Bund, 25. 5., S. 165
Reisläuffer. Mundartgedicht.
Der kleine Bund, 25. 5., S. 165
Rousseau : 1765. Gedicht.
Der kleine Bund, 25. 5., S. 165-166
Treui: Anno 1425. Gedicht.
Der kleine Bund, 25. 5., S. 165
Uehli Ochsebei. Gedicht.
Der kleine Bund, 25. 5., S. 166
Z’ Loupe. Gedicht.
Der kleine Bund, 25. 5., S. 165
Diabolo
Die Garbe, 15. 9., S. 737-746
1931:
Ausserberg, ein Walliser Gemeindewesen
Bern, V: Haupt, 24 S.
Das Goldfischlein
Die Garbe, 15. 11. (S. 109-114) / 1. 12. (S. 143-149)
1932:
Der Besondere: Bauerngeschichte aus dem bernischen Seeland
Bern, V: Gute Schriften, 88 S.
Bärner Marsch - Gedichte in Mundart
Bern, V: Francke, 94 S.
Het en Yscher - e Seebutzekumedi i dreinen Ufzüg
Bern, V: Francke, 93 S.
Die Nussackerleute
Die Ernte, S. 73-95
1933:
Läbe. Gedicht.
Schweizerische Lehrerinnenzeitung, 5. 1., S. 118
Der Diré Schnyder
Erinnerungsbuch Münchenbuchsee - Hofwil - Bern: 100 Jahre, Bern, V: Vereinigung ehem. Schüler des bernischen Staatsseminars, S. 169-173
1934:
Die Pfahlbauer am Moossee
Zürich, V: SJW, Nr. 18, 31 S.
Aka: Tribu sur le lac (Zürich, 1963)
Die Friedensinsel. Festspiel in 2 Teilen
Biel, V: Buchdruckerei der Schreibbücherfabrik
Türlü und die Kameraden
Zürich, V: SJW, 31 S.
Züri u Bärn
Zürcher Illustrierte, 10. 8., S. 1005
Tarragona
Nationalzeitung, 22. 8.
Nebelmeer
Der Bund, 12. 10., S. 4
Hilfsmittel für den Rechenunterricht im 3. - 6. Schuljahr
Schweizer Schule, 15. 11., S. 1038-1039
1935:
Der Scholle treu. Festspiel in 3 Aufzügen
Zollikofen, V: Buchdruckerei Hell, 36 S.
Z’Loupe: Kantate für Männerchor mit Klavier, Bläser, Orchester
Bern, V: Müller & Schade
Blüemli
Der Schweizer Schüler, Nr. 25, S. 489-492
Wildwasser
Nationalzeitung, 17. 6.
1936:
Cécile und die Indianer
Zürich, V: SJW, Nr. 59, 32 S.
Joachim bei den Schmugglern
Bern, V: Francke, 225 S.
Der Apfel
Der Schweizer Schüler, Nr. 10, S. 186
Scho z’wyt: eine Süssmostgeschichte
Der Schweizer Schüler, Nr. 42, S. 840-841
Schüler-Ferienlager
Der Schweizer Schüler, Nr. 20 (S. 398-400), Nr. 21, (S. 417-419)
Der Senn von La Costa
Der Bund, 8. 3., S. 3-4
1937:
Reichenbühl
Der Schweizer Schüler, Nr. 4
Dienst als Feldtelegraphenpionier
Der Schweizer Schüler, Nr. 45, S. 892-893
1938:
Ergötzliches Vieh - Fabeln und Satiren
Zürich/New York, V: Oprecht, 80 S.
I schwäre Zyte. Volksliederspiel aus der Grenzbesetzung 1914
Aarau, V: Sauerländer, 41 S.
Die Schweizerischen Schriftsteller und der Film
Der Bund, 2. 3., S. 3
Augustfeier: eine Bubengeschichte
Berner Woche, 30. 7., S. 754-56
Erinnerung an einen Bettag
Der Schweizer Schüler, Nr. 38, S. 742-744
Der Wimpel mit dem Schweizerkreuz
Der Schweizer Schüler, Nr. 30, S. 581-582
Racaca Sidibombola aus Amerika
Der Spatz, Okt. (S. 105-108), Nov. S. 114-120)
Passion in Bern
Der Bund, 2. 12., S. 1
1939:
Flüehlikofer Härd
Bern, V: Francke, 256 S.
Wappe-Spruch. Gedicht.
Berner Zeitschrift für Geschichte und Heimatkunde, Nr. 4, S. 192
Warum erobert John Kling die Herzen unserer Buben?
Die Berner Woche, 21. 1., S. 59-62
Trotzdäm? Gedicht.
Die Berner Woche, 11. 2., S. 143
Ds Hüetli
Die Berner Woche, 18. 2., S. 170-174
1939 (Fortsetzung):
Der Prophet
Die Berner Woche, 25. 2., S. 219
Vorfrüehligsnacht. Gedicht.
Die Berner Woche, 3. 3., S. 243
Murtechrieg: Mischtelacher Chutzewach. Gedicht.
Der kleine Bund, 2. 4., S. 110
Murtechrieg: Murtener Stadtwach. Gedicht.
Der kleine Bund, 2. 4., S. 111
Chönnen afüüre!
Die Berner Woche, 8. 4., S. 378-381
Schultheater
Die Berner Woche, 8. 4., S. 379
Die hohe Kunst der Politik. Diplomaten. Fabeln.
Die Berner Woche, 15. 4., S. 409
Die hohe Kunst der Politik. Taktisches Genie. Fabeln.
Die Berner Woche, 15. 4., S. 409
Die hohe Kunst der Politik. Dynamische Sprache. Fabeln.
Die Berner Woche, 15. 4., S. 409
Die hohe Kunst der Politik. Klassenhass. Fabeln.
Die Berner Woche, 15. 4., S. 409
Die hohe Kunst der Politik. Parteien. Fabeln.
Die Berner Woche, 15. 4., S. 409
Die hohe Kunst der Politik. Terror. Fabeln.
Die Berner Woche, 15. 4., S. 409
Die hohe Kunst der Politik. Kriegs-Ursache. Fabeln.
Die Berner Woche, 15. 4., S. 409
Die hohe Kunst der Politik. Rassendünkel. Fabeln.
Die Berner Woche, 15. 4., S. 409
Die hohe Kunst der Politik. Der schlimmere Feind. Fabeln.
Die Berner Woche, 15. 4., S. 409
Murtechrieg: Der Züri-Löi. Vers.
Der Bund, 6. 5., S. 1
Jungi Fabriggler-Frau. Gedicht.
Berner Woche Art und Kunst, 15. 7.
Augustfeuer an der Grenze
Der Schweizer Schüler, Nr. 30, S. 594-597
Ds Füürwejer-Förndli
Der Schweizer Schüler, Nr. 26, S. 509-511 / 514-515
D’Tante Garolyn schmugglet en Elsässer Hamme: es Müschterli
Der Schweizer Schüler, Nr. 38, S. 753
1940:
Bärnburger. Gedicht.
Berner Woche, 16. 3., S. 293
D’Grächtigkeit
Der kleine Bund, 9. 6., S. 180-183
Streiflichter aus Wien im September 1940
Der Bund, 2. 10., S. 2
Wien-Fahrt im September 1940
Die Berner Woche, 9. 11., S. 1110-1112
Grunder Kari zum 60. Geburtstag! Mundart.
Die Berner Woche, 16. 11., S. 1140
1941:
Berner Mundartliedli
Basel, V: Hug
Buebebärg. um Murte 1476
Bern, V: Aare
Zum neue Jahr
Elternzeitung, Jan., S. 1
Dört obe uf em Bärgli. Lied.
Der Spatz, April 1941, S. 9
Karl der Grosse und die Musen
Nationalzeitung, 17. 4., S. 2
Mischler Bärtel lehrt sy Houpme kenne
Der kleine Bund, 20. 4., S. 121-124
Ds Opfer (1798). Gedicht.
Schwyzerlüt, 1. 8., S. 44
Lade (Ougschte 1914). Vers.
Schwyzerlüt, 1. 8., S. 50
Ursli u sy Blätz
Die Berner Woche, 20. 12., S. 150-152
Schweizer Nagelschmiede
Der Schweizer Schüler, Nr. 50, S. 150-155
Vier Wiehnachtsgedichte vom Hans Zulliger
Schwyzerlüt, Dez. 1941/Jan. 1942, S. 4
Wiehnechts-Stärndli
Schwyzerlüt, Dez. 1941/Jan. 1942, S. 26
1942:
Giduldt ha!: es nöis Flüehlikofer Gschichtli
Die Garbe, 1. 1., S. 205-209
Die Berner Schriftsteller in Aarberg
Der Bund, 18. 1., S. 5
Metallspende. Aufruf.
Der Bund, 26.1., S. 6
Kleine Diskussion über Mundartschriftstellerei
Der Bund, 31. 5., S. 5
Tag im Brachet. Gedicht.
Der kleine Bund, 28. 6., S. 208
Muetterglück. Gedicht.
Elternzeitschrift, Aug., S. 173
Die Halbwüchsigen
Die Garbe, 15. 8. (S. 673-681) / 1. 9. (S. 705-711)
Es Wätter. Gedicht.
Leben und Glauben, 26. 9, S. 21
Nid wärche dörfe! Gedicht.
Berner Woche, 10. 10., S. 1025
Herbscht. Gedicht.
Der Bund, 11. 10., S. 5
Aaben im Herbst (Ds Stedtli Burdlef). Gedicht.
Die Berner Woche, 17. 10., S. 1057
Der Ritter Adrian. Gedicht.
Bieler Tagblatt, 29. 10., S. 176
Über Buch-Besprechungen
Der Bund, 8. 11., S. 5
Winterfreude
Berner Woche, 19. 12., S. 1361
Der Dichter und die Gemeinschaft
Bund, 27. 12., S. 409-410
Gödeli erlebt seinen Aufsatz
Der Schweizer Schüler, Nr. 48
1943:
Aern: Värse
Bern, V: Aare, 119 S.
Sonne über Flüehlikofen
Basel, V: Reinhard, 136 S.
Der Houpme
Der Schweizer Schüler, Nr. 20
Was i am Gfeller Simon z'verdanke ha!
Schwyzerlüt, Frühling, S. 12-14
Waadtländer Wy. Gedicht.
Schwyzerlüt, Herbst. S. 41
Verse aus Aern: Du
Der Bund, 25. 8., S. 1
Verse aus Aern: Mejeräge
Der Bund, 25. 8., S. 1-2
Verse aus Aern: Meitschi-Lünn
Der Bund, 25. 8., S. 2
Verse aus Aern: Bscheid
Der Bund, 25. 8., S. 2
Verse aus Aern: Stimme i der Nacht
Der Bund, 25. 8., S. 2
Gott. Gedicht.
Bieler Tagblatt, 20. 9., S. 7
Chilterliedli.
Bieler Tagblatt, 20. 9., S. 7
We me folge muess. Gedicht.
Bieler Tagblatt, 20. 9., S. 7
Ds Radio. Gedicht.
Leben und Glauben, 23. 10., S. 19
Fili im Schafspelz - Preisgekrönte Kurgeschichte
NZZ, 16. 11. 1943, S. 1
E Soldate-Wiehnacht
Der kleine Bund, 25. 12., S. 412-416
1944:
Erfahrig. Gedicht.
Die Ernte, Jahrbuch 1944, S. 16
Im Winter. Gedicht
Leben und Glauben, 22. 1., S. 5
Um d’Wahrheit. Gedicht.
Leben und Glauben, 17.6., S. 19
Dengeler-Lied. Gedicht.
Der Spatz, Juli, S. 60
D’ Liebi. Gedicht
Leben und Glauben, 8. 7., S. 17
Der Tribut an die Freiheit
NZZ, 13. 7., S. 5-6
Rüttiwiler Fisch
Berner Woche, 6. 10., S. 1187
Der «Kodaak»
Leben und Glauben, 21. 10., S. 8-9
Genutzte Bubenkraft
Der Bund, 26. 10., S. 3-4
Hypnose
Nationalzeitung, 28. 10., S. 2
Es Briefli. Gedicht
Leben und Glauben, 2. 12., S. 23
1945:
Mundart und alte Versformen
Der Bund, 7. 3., S. 3-4
Kinder, das ist gefährlich
Der Spatz, Mai, S. 39-40
Sommerliche Flussfahrt
NZZ, 12. 7., S. 1-2
Einfühlung. Tierfabel.
Der Bund, 12. 8., S. 201
Königliche Geste. Tierfabel.
Der Bund, 12. 8., S. 201
Materialismus. Tierfabel.
Der Bund, 12. 8., S. 201
Aufgeschobene Heroik. Tierfabel.
Der Bund, 12. 8., S. 201
Die Mängel des andern… Tierfabel.
Der Bund, 12. 8., S. 201
Das angestänkerte Angestunkene. Tierfabel.
Der Bund, 12. 8., S. 201
Akademische Gepflogenheit. Tierfabel.
Der Bund, 12. 8., S. 201
Die grössere Einheit. Tierfabel.
Der Bund, 12. 8., S. 201
Lokale Grösse. Tierfabel.
Der Bund, 12. 8., S. 201
Gemeinnutz geht vor Eigennutz! Tierfabel.
Der Bund, 12. 8., S. 202
Machtfragen. Tierfabel.
Der Bund, 12. 8., S. 202
Nächtlicher Spuk
Der Spatz, Sept., S. 88-90
Gemäss Sektor & Co.: ein Nekrolog
Nationalzeitung, 21. 9., S. 2
Die eingebutterte Zirbeldrüse
Der Bund, 22. 10., S. 2-3
Bubenkrieg
Der Schweizer Schüler, Nr. 8, S. 180-181
Üsem Volksdichter Kari Grunder
Schwyzerlüt, Dez. 1945/Jan. 1946, S. 30-33
Da isch Kari d’schuld
Schwyzerlüt, Dez. 1945/Jan. 1946, S. 79-81
1946:
Sichlete: gemischter Chor und Jodel
Bern, V: Schweizer. Gesellschaft volkstümlicher Autoren…
Die sieben Geschichten vom schlauen Balz
Bern, V: Francke, 143 S.
Die Wohnhöhlen am Weissenbach
Zürich, SJW, Nr. 248, 32 S.
Aus Pestalozzis schwerster Zeit
Der Spatz, Januar, S. 146-50
Der Glaube - Eine Pestalozzi-Geschichte
Der Bund, 6. 1., S. 7
Das Mütterliche
Die Berner Woche, 11. 1., S. 27
Bieg-Eis
Leben und Glauben, 16.2., S. 12-13
Morge-Lied
Schwyzerlüt, Mai, S. 7
Neue Mundart-Lyrik. Verleger und Leser.
Der Bund, 6. 6., S. 5
Ums Lehrerwort
NZZ, 27. 7., S. 14-15
Die Asthma-Tropfen
Leben und Glauben, 3. 8., S. 12
Wunder im Wallis
Der Bund, 4. 8., S. 7
Sommerabend in Sitten
Nationalzeitung, 9. 8., S .1-2
Der Amateur-Uhrmacher
Berner Woche, 6. 9. S. 1135
Die Asthma-Tropfen
Berner Woche, 4. 10., S. 1258
Als ich Wunder-Kirschen stahl
Leben und Glauben, 12. 10., S. 14-15
Der Herr Vikar und das Luziferchen
Die Garbe, 15. 10., S. 47-51
Der harte Stoffel
Der Schweizer Schüler, Nr. 25, S. 579-581
Verlütte. Gedicht
Der Schweizer Schüler, Nr. 51, S. 1230
Der Erzähler und der Redner
Volksrecht, 30. 11.
Ums Lehrerwort
Leben und Glauben, 28. 12.
1947:
Abenteuer in Ascona
Leben und Glauben, 11. 1., S. 12-13
Der Mensch ist nicht nur schlecht
Leben und Glauben, 25. 1., S. 10-12
Villa di Lei: eine Sage
Leben und Glauben, 19. 4., S. 12-13
Der Fluhbodenpeekli
Der Spatz, April (S. 2-8), Mai S. (24-26), Juni (S. 39-43)
Flussfahrt
Berner Woche, 29. 8., S. 1130
Ufem Todbett. Gedicht.
Am häuslichen Herd, 15. 10., S. 30
Wymonet i de Bärge. Gedicht.
Der Bund, 19. 10., S. 5
Mareili. Gedicht.
Der Spatz, Nov., S. 123
Sylveschter. Gedicht.
Der Spatz, Dez., S. 147
Trotzdäm! Gedicht.
Leben und Glauben, 6. 12., S. 23
DS Wingeli. Gedicht.
Der Schweizer Schüler, Nr. 51, S. 1213
Die Eisenbahn soll kommen
Der Schweizer Schüler, Nr. 16, S. 364-365
Die Flinte und die Sense
Der Schweizer Schüler, Nr. 18, S. 412-413
Kläy
Der Schweizer Schüler, Nr. 1, S. 3-5
Nic, der Legionär
Der Schweizer Schüler, Nr. 30, S. 699-701
Es Päckli für d’Frou Biderma
Der Schweizer Schüler, Nr. 12, S. 278-279
Das Wunder: aus Pestalozzis Burgdorfer Zeit
Der Schweizer Schüler, Nr. 43, S. 1011-1013
1948:
Joachim als Grenzwächter
Bern, V: Francke, 290 S.
Du liebes, schönes Schweizerland. Gemischter Chor mit Klavier
Zürich, V: Hug, 3 S.
Die Verschwörung der Scherbenfischer von Hirzenbrünnen
Zürich, SJW, Nr. 316, 31 S.
Ds Buuchi-Manndli
Der kleine Bund, 25. 1., S. 13-15
Dünkel der Talentlosen. Fabeln.
Elternzeitschrift, Feb., S. 40
Nützlichkeit. Fabeln.
Elternzeitschrift, Feb., S. 40-41
Das betrogene Käs-Teufelchen
Der Spatz, März, S. 193-194
Der weisse Bär auf dem Roda-Pass: eine Sage aus dem Avers
Schweizer Jugend, 10. 4., S. 341
Schmuggler-Latein
Die Berner Woche, 16. 4., S. 434-435
Der Muttertag
Schweizer Jugend, 8. 5., S. 425-436
Die Schweizerfahne
Schweizer Jugend, 31. 7., S. 728-730
Herrn Ludwig Alioths Nachtwächter: eine wahre Geschichte
Schweizer Jugend, 2. 10., S. 939-41
1949:
Vorfrühlings-Nacht. Gedicht.
Elternzeitschrift, März, S. 49
Altgriechische Versformen in der berndeutschen Umgangssprache
Der Bund, 10. 3., S. 2
Romünzel und die grossen Fische
Schweizer Jugend, 26. 3, S. 291-293
Ame Möntscheching uf sy Läbeswäg. Mundartspruch.
Elternzeitschrift, Mai
Mutterliebe und Vatertrost
Schweizer Jugend, 6. 8., S. 747-749
Von Schmugglern und Zöllner im Val di Lei
Leben und Glauben, 27. 8., S. 12 - 14
Spruch: ame junge Ma uf sy Läbeswäg. Gedicht.
Der Hochwächter, Nr. 1, S. 9
Der Glücksbringer
Schweizer Jugend, 10. 10., S. 868-869
Nimm di zäme. Gedicht.
Schweizer Jugend, 26. 10., S. 1135
D’Mueter. Gedicht.
Neue Berner Zeitung, 25. 12., S. 11
1950:
Die drei Franken
Gütersloh, V: Rufer, 16 S.
Schultheater für Kinder von 13 bis 16 Jahren
Aarau, V: Sauerländer, 56 S.
Wie ne Flüehlikofer mit em Tüfel isch z’cher cho
Schweizer Jugend, 19. 8., S. 771-773
Im Scheseli. Gedicht.
Schweizer Jugend, 2. 12., S. 1134
Wohnen auf anderen Sternen auch Menschen?
Der Spatz, Dez., S. 139-140
Morgen im Christmonet. Gedicht
Südkurier, Oberläder Chronik, 9. 12., S. 2
My Wunsch. Gedicht.
Schweizer Jugend, 23. 12, S. 1216
1951:
Der «Unhund»
Gütersloh, V: Rufer
E Muetter. Gedicht.
Elternzeitschrift, Feb., S. 36
Im Märzen-Frost. Gedicht.
Elternzeitschrift, März. S. 49
Die verkaufte Braut
Schweizer Jugend, 14. 4., S. 339-341
Das Geschenk zum Muttertag
Schweizer Jugend, 12. 5., S. 435-437
Die Erfindung
Schweizer Jugend, 2. 6., S. 507-508
Was da so isch… Gedicht.
Der kleine Bund, 5. 10., S. 6
Das Oehrlein
Leben und Glauben, 22. 12., S. 22-23
1952:
Es Hämpfeli Gschichte von Chüehni Hälm
Bärnergschichte, Bern, V. Scherz, S. 256
Der Verbannte
Gütersloh, V: Rufer, 16 S.
Lob des Lausbuben
Elternzeitschrift, Jan. 1952, S. 13-18
Bitte… Gedicht.
Leben und Glauben, 9. 2., S. 7
Früech im Merze. Gedicht.
Elternzeitschrift, März, S. 45
Oschtere-Värsli. Gedicht
Elternzeitschrift, März, S. 63
Meie-Räge
Elternzeitschrift, Mai, S. 93
Der Mano: es Flüehlikofer-Gschichtli
Schweizer Jugend, 5. 7., S. 627-629
Früech im Herbscht. Gedicht.
Der kleine Bund, 5. 9., S. 6
Es schneierlet… Gedicht.
Elternzeitschrift, Dez., S. 253
1953:
Die Brautnelke
Nationalzeitung, 1. 2.
Nacht im Wintermonet. Gedicht.
Elternzeitschrift, Nov., S. 209
Der Waisenvogt. Hörspiel.
Radio Bern
1954:
Unger em Fröhlisbärg - Es Chrättli voll Gschichte
Bern, V: Scherz, 235 S.
Botti hilft einem Bauern
Der Spatz, Nr. 1, S. 13-16
Z’mitts ir Wäldt
Zürich, V: Büchergilde Gutenberg, 75 S.
My Muetter. Gedicht.
Elternzeitschrift, Mai, S. 81
Chlaus-Liedli. Gedicht.
Schweizer Jugend, 27. 11.
1955:
Der Tüüfel u der Puur. Kleines Spiel für die Schulbühne
Aarau, V: Sauerländer, 30 S.
1956:
Horner. Gedicht.
Elternzeitschrift, Feb., S. 25
Der Oschterhas. Gedicht.
Elternzeitschrift, Feb., S. 54
Das Reitpferd, das ein Zugpferd wurde
Schweizer Jugend, 17. 3., S. 247-249
Herbstmorgen. Gedicht.
Elternzeitschrift, Sep., S. 177
Baschi, das Rabenkind
Schweizer Jugend, 29. 9., S. 937-938
1957:
Mützel: Geschichte eines Knaben
Zollikon, V: Evangelischer Verlag, 80 S.
Der Osterhase
Schweizer Jugend, 20. 4. S. 368-369
Meje-Lied. Gedicht.
Elternzeitschrift, Mai, S. 81
Wymonet. Gedicht.
Elternzeitschrift, Okt., S. 181
Ds Tandli. Gedicht.
Schweizerische Lehrerinnenzeitung, 20. 11., S. 49
Heini: eine Bubengeschichte / auch Heini und seine Mutter
Schweizer Jugend, 23. 11. S. 1127-29 / Der kleine Bund, 27. 10., S. 9
1958:
I wett…! Gedicht.
Schweizer Jugend, 6. 12., S. 1183
1959:
Schwänke im Vivarium
Bern, Stuttgart, V: Huber, 51 S.
Geleitwort
Erlebt und empfunden, Fredy Mayer, Basel, Selbstverlag, 1959, S. 5-6
Geleitwort
Der andere Weg, Hans Fürst, Bern / Stuttgart, V: Huber, 1959, S. 8
Wiehnechtswünsch. Gedicht.
Elternzeitschrift, Nov., S. 212
1960:
Wie der Münzel zu einer Fischrute kam
Der Spatz, Aug., S. 69-75
Freunde
Schweizer Jugend, 15. 10. (S. 1016-17), 22. 10 (S. 1040-41)
Ungerem Sänfbaum. Gedicht.
Leben und Glauben, 26. 11., S. 20
1961:
Röbi und die Mäuse
Bern, V: Gute Schriften, 80 S.
Frag. Gedicht.
Elternzeitschrift, Feb., S. 21
Der Wigwam des Roten Wolfes
Der Spatz, Sept., S. 81-87
1962:
Mutterglaube
Schweizer Jugend, 12. 5., S. 466
1963:
Es Büscheli Matte-Meie. Landbärndütschi Värsli
Bern, V: Francke, 79 S.
Das Giftfass
Zürich, V: SJW, Nr. 819, 32 S.
Im Merze. Gedicht.
Elternzeitschrift, Feb., S. 41
Nächtwermi
Radio Beromünster, 12. 5.
Im Herbstmonet. Gedicht.
Thuner Tagblatt, 19. 9., S. 10
1964:
Erschts Biecht. Gedicht.
Der kleine Bund, 23. 10., S. 2
D'Pescht: 1349. Gedicht.
Schwyzerlüt, Nov., S. 35
Totentanz. Gedicht.
Schwyzerlüt, Nov., S. 36-37
Morgen im Wald. Gedicht.
Schwyzerlüt, Nov., S. 39
Frag. Gedicht.
Schwyzerlüt, Nov., S. 40
Horner. Gedicht.
Schwyzerlüt, Nov., S. 42
Laus Rägeli. Gedicht.
Schwyzerlüt, Nov., S. 43
Braachetsunne. Gedicht.
Schwyzerlüt, Nov., S. 44.
E mängi Wälle. Gedicht.
Schwyzerlüt, Nov., S. 45
D’Stubyner-Frou
Schwyzerlüt, Nov., S. 25-31
Wie eine Seeländer-Ballade entstand
Schwyzerlüt, Nov., S. 11-16
Es Buebemüschterli - Hans Zulliger verzellt us sym Läbe
Schwyzerlüt, Nov., S. 5-10
Grösse der Kleinen - Von Bernhardiner und Pekineserhündchen
Der kleine Bund, 11. 12., S. 2
Erleben Sie im Teil II Hans Zulliger als Wegbereiter der psychoanalytischen Kinderpsychologie und
Erziehungsberatung.
Quellen/Sources: 1) «Hans Zulliger» in Die Berner Woche, Bern, 18. Juli 1942, S. 713; - 2) Hans Zulliger, «Bärner Wiehnecht» in
Burgdorfer Tagblatt, 21. 12. 1918, S. 5; - 3) Zuger Volksblatt, Zug, 27. 8. 1921, S. 6; - 4) kh, «Unghüürig vom Heimatschutztheater» in Berner Tagwacht, Bern, 22. 10. 1921, S. 2: - 5)
«Buchbesprechung Gelöste Fessel» in SMUV-Zeitung, Bern, 16. 7. 1927, S. 4: - 6) Th., «Hulligerschrift - Zur Frage einer Schriftreform» in NZZ, Zürich, 10. 9. 1933, S. 13; - 7) Beat Jäggi, «Der
Bärner Dichter Hans Zulliger» in Schwyzerlüt, Nr. 2, Bern, 1964, S. 2ff; - 8) «Von den Leuten im Fluhbodenhüsli» in Schweizerische Lehrerzeitung, 20. 1.. 1926, S. 390; - 9) «Ferienkurs der SPG»
in Schweizerische Lehrerinnenzeitung, 15. Juli 1921, S. 214; - 10) Erwin Allemann, «Hans Zulliger zu seinem 50. Geburtstag - Zulliger als Wissenschaftler» in Die Berner Woche, Bern, 20. 2.
1943, S. 207ff; - 11) H. W. «Alfred Zulliger, Madretsch», Die Berner Woche,17. 6. 1939, S. 664; - 12) Hans Zulliger, «Sigmund Freud» in Der Bund, Bern, 6. 5. 1926, S. 1 - 13) Max Abt, «Bande oder
Gemeinschaft» in Fachblatt für schweizerisches Anstaltswesen, Februar 1962, S. 37; - 14) Peter Rinderknecht, «Erziehungshilfen» in Fachblatt für schweizerische Anstaltswesen, Wädenswil, Dezember
1962, S. 402; - 15) «Buchbesprechung der Biographie Hans Zulliger von Werner Kasser» in Fachblatt für schweizerisches Anstaltswesen, S. 156; - 16) Dr. Ursula Müller, «Zum Tode von Hans Zulliger»
in Schweizerische Lehrerzeitung, Zürich, 5. 11. 1965, S. 1331; - 17) Paul Marti, Rudolf Ryser «Zur Erinnerung an Hans Zulliger» in Berner Schulblatt - L’Ecole Bernoise, Bern, 13. 11. 1965, S.
595ff; - 18) di, «Die Angst unserer Kinder - Buchbesprechung» in Schweizerische Lehrerzeitung, 5. 8. 1966, S. 889; - 19) «Einführung in die Kinderseelenkunde - Buchbesprechung» in Schweizerische
Lehrerinnenzeitung, Chur, 10. 2. 1968, S. 26; - 20) Hans Zulliger, «Schultheater» in Die Berner Woche, Bern, 8. 4. 1939, S. 379; - 21) «Verdiente Ehrung» in Bieler Tagblatt, Biel, 1. 12. 1952, S.
3; - 22) «Aus den Verhandlungen des Regierungsrats» in Bieler Tagblatt, Biel, 27. 8. 1956, S. 3; - 23) Werner Kasser / Wolfgang Zierl, Hans Zulliger, Eine Biographie und Würdigung seines Wesens,
Verlag Huber, Bern / Stuttgart 1963, S. 23; - 24) Hans Zulliger, Heilende Kräfte im kindlichen Spiel, Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 1952, Vorwort; - 25) Erich Kobel, «Hans Zulliger: Ittiger
Dorfschulmeister mit Doktorhüten» in Der Bund, Bern, 20. 2. 1993, S. 25; - 26) «Berner Psychologe in Österreich» in Oberländer Tagblatt, Thun, 6. 5. 1960, S. 3; - 27) If., «Volksliederspiel I
schwäre Zyte» in Der Bund, Bern, 18. 6. 1960, S. 3; - 28) «Vorträge in Deutschland» in Freiburger Nachrichten, Freiburg, 22. 10. 1960, S. 11; - 29) M. N., «Führen und Einordnen» in Neue Zürcher
Zeitung, Zürich, 7. 11. 1960, S. 21; - 30) «Gespräche über Erziehung - Buchtipp der Weltwoche» in Der Bund, Bern, 16. 2. 1961, S. 6; - 31) Gs, «Jungbürgerfeier in der Stadtkirche» in Bieler
Tagblatt, Biel, 3. 12. 1959, S. 3; - 32) W. B., «Kinder denken anders als Erwachsene» in SMUV-Zeitung, Bern, 29. 7. 1964, S. 3;- 33) «Verdiente Anerkennung» in Berner Tagwacht, Bern, 8. 2. 1949,
S. 2; - 34) Hans Zulliger, «Metallspende für Arbeit und Brot!» in Oberländer Tagblatt, Thun, 17. 1. 1942, S. 5 ; - 35) Hans Zulliger, «Der Dichter und die Gemeinschaft» in Der Bund, 27. 12. 1942,
S. 409f: - 36) wj., «Ein Hans-Zulliger-Preis» in Der Bund, Bern, 22. 11. 1970, S. 27; - 37) Christine Schilt, Biographie der Veröffentlichungen von Hans Zulliger, Bern, 1983, S. 109); - 38)
«Imago (Zeitschrift)» in de.Wikipedie.org, abgerufen 2025; - 39) Hans Zulliger, «Wie ich dazu kam, für die Jugend zu schreiben», in Schweizerische Erziehungsrundschau, Schweiz. Erz.-Rundschau,
Dez. 1934, S. 227; - 40) F. Moser, «Die Wohnhöhlen am Weissenbach - Buchbesprechung» in Berner Schulblatt, Bern, 1. 5. 1948, S. 73; - 41) Emma Eichenberger, «Versuche im Geschichtsunterricht» in
Schweizerische Lehrerinnenzeitung, Zürich, 20. 1. 1951, S. 128; - 42) Claire Hauser Pult, «Das Stiefkind der Archäologie» in Jahrbuch der Archäologischen Schweiz, S. 160; - 43) di, «Bieler
Festspiel» in Der Bund, Bern, 27. 5. 1934, S. 2; 44) Hans Zulliger, «Metallspende - Das Dichterwort im Dienste der Volkswirtschaft» in Die Berner Woche, Bern, 24. 1. 1942, S. 93; - 45) Hans
Zulliger, «Radiozyklus Nöte der Jugend - Fehler der Eltern» in Elternzeitschrift, Zürich, Oktober 1948, S. 224; - 46) Hans Zulliger: «Wie steuern wir der zunehmenden Jugend-Verwahrlosung» in
Elternzeitschrift, Zürich, Jan. 1950, S. 9ff; - 47) Hans Zulliger, «Es gibt…», Elternzeitschrift, Zürich, Dez. 1944, S. 284f; - 48) «Schul-Theater - Buchbesprechung» in Elternzeitschrift, Zürich,
Oktober 1951: - 49) «Festsitzung der Schweizerischen Gesellschaft für Psychoanalyse» in Der Bund, Bern, 25. 2. 1963, S. 15 - 50) Michael Kuhn, Verbrannte Bücher, Digitale Bibliothek Braunschweig,
Braunschweig 1993, S. 77; - 51) Hans Zulliger, «Achter psychologischer Kongress» in Der Bund, Bern, 7. 5. 1924, S. 2f; - 52) Hans Zulliger, Ein besondere kindliche Reaktion auf Strafen,
Elternzeitschrift, Zürich, August 1953, S. 161; - 53) Hans Zulliger über den Z-Test in Elternzeitschrift, Okt. 1953: - 54) Hans Zulliger, «Sind die Comic-Strips eine Gefahr» in Elternzeitschrift,
Nov. 1954, S. 214; - 55) Bruno Maurer, Persönlichkeiten der Einwohnergemeinde Bolligen, Bern/Wabern, 2017, S. 177-182; - 56) Hans Zulliger, Freud in der Gegenwart - Ein Vortragszyklus der
Universität Frankfurt und Heidelberg zum 100. Geburtstag, Mannheim, 1957, S. 364f; - 57) «Tagung für fortschrittlichen Strafvollzug» in NZZ, Zürich, 24. 5. 1945, S. 5 : - 58) Hans Zulliger,
«Beiträge zur Psychologie der Trauer- und Bestattungsbräuche» in Imago, Nr. 2 u. 3., Wien, 1924, S. 178; - 59) hst., «Einführung in den Z-Test» in Schweizer Erziehungs-Rundschau, Febr., St.
Gallen, 1956, S. 235; - 60) Hans Zulliger, «Psychoanalytische Hilfe bei Erziehungsschwierigkeiten» in Fachblatt für Heimerziehung und Anstaltsleitung, Thun, Jan. 1934, S. 7f; - 61) Hans Zulliger,
«Karl May» in Der Bund, 16. 3. 1924, S. 5; - 62) H. A., «Der Spatz» in Das Jugendbuch - Mitteilungen über Jugend- und Volksschriften, Aug. 1958, Bern, S. 914; - 63) Barbara Handwerker Küchenhoff,
«100 Jahre Psychoanalyse in Zürich, ein Überblick» in Schweizer Monatsheft, Jan. / Feb. 2007, S. 43; - 64) Hans Zulliger, «Der Psychologe im Dienste der Mediziner» in Berner Schulblatt, Bern, 12.
6. 1943, S. 171; - 65) Protokoll der Schweizerischen Gesellschaft für Psychoanalyse 1928 bis 1934, Archiv SGPsa, Bern; - 66) Hans Zulliger, «Sigmund Freuds Bedeutung für die Pädagogik» in
Schweizer Erziehungsrundschau, St. Gallen, Mai 1956, S. 27ff; - 67) Hans Zulliger, «Zu Sigmund Freuds achtzigstem Geburtstag» in Berner Tagwacht, Bern, 6. 5. 1936, S. 6; - 68) Jacques Berna,
Buchbesprechung «Heilende Kräfte im kindlichen Spiel» in Die Tat, Zürich, 10. 4. 1954, S. 20; - 69) Michael Schröter, Auf eigenem Weg - Geschichte der Psychoanalyse in Deutschland bis 1945,
Vandenhoeck & Ruprecht, 2023, S. 425; - 70) Ws., «Das Aktionskomitee für Mittelschulfragen» in Schweizerische Lehrerzeitung, Zürich, 3. 6. 1955, S. 717f; - 71) A. Furrer, Buchbesprechung:
Psychoanalytische Streiflichter aus der Volksschulpraxis, Imago, VIII. 2., Wien, 1922, S. 251; - 72) «Internationale Rorschach-Tagung» in Der Bund, Bern, 25. 8. 1949, S. 3; - 73) Hans Zulliger,
Der Z-Test - Ein Formdeut-Verfahren zur psychologischen Untersuchungen von Gruppen, Bern, 1948, S. 6; - 74) Heinrich Kleinert, «Buchbesprechung Aern» in Die Berner Woche, S. 1065; - 75) Peter
Schmid, Schweizer Schule, 15. 3. 1979, S. 173; - 76) Hans Zulliger, «Aus der Geschichte der Psychoanalytischen Bewegung in der Schweiz», Vortrag in der Schweizerischen Gesellschaft für
Psychoanalyse anlässlich der Festsitzung zum 70. Geburtstag des Verfassers, Bern, 23. 2. 1963; - 77) R. A., «Feier zum zehnjährigen Bestehen des Institutes für Psychohygiene Biel» in Bieler
Tagblatt, Biel 15. 9. 1959, S. 3; - 78) Hü., «Ein Institut für Psychohygiene in Biel» in Schweizer Erziehungs-Rundschau, St. Gallen, Dez. 1957, S. 193; - 79) Gratulation von Hans Zulliger an Carl
Emil Lang, 1951, Burgerbibliothek Bern, AS 4 (14); - 80) Brief von Hans Zulliger (Ittigen) an Simon Gfeller, 20. 11. 1940, Burgerbibliothek Bern, N Simon Gfeller 121; - 81) Schweizer
Chor-Komponisten, Hug & Co. Musikverlage, Zürich, 1999, S. 178ff; - 82) Wohnsitz-Register der Einwohner-Gemeinde Mett, Band III, Nr. 501, Stadtarchiv Biel, Signatur B. II. A - 83)
«Diskussions- und Beratungsreihe mit Laure Wyss» in Info SRF Schweizer Fernsehen, 9. 10. 1961, PDF; - 84) Christian Müller, «Herrmann Rorschach wirbt für die Psychoanayse» in Gesnerus - Swiss
Journal of the history of medicine and sciences, Nr. 3/4, Basel, 1996, S. 244; - 85) «Trauung von Albert Zulliger» in Der Bund, 21. 4. 1934, S. 5; - 86) Reinhard Fatke, Psychoanalytische
Pädagogik in Romanform – Hans Zulliger als Volksschriftsteller. Unveröffentlichtes Manuskript Zürich, 2021; - 87) Hans Zulliger, «Mein Curriculum vitae» in H. Zulliger: Das magische Denken des
Kindes. Beiträge zur Psychoanalytischen Pädagogik und Kinderpsychotherapie, Giessen 2022 (Psychosozial-Verlag), S. 29-33; - 88) S-r, «Gedanken über das Lesebuch des 3. Schuljahres» in Berner
Schulblatt, Bern, 9. 6. 1928, S. 157; - 89) Werner Schmid, «Der internationale Tag der Güte» in Schweizerische Lehrerzeitung, Zürich, 1. 6. 1929, S. 191; - 90) Alfred Frankhauser, «Hans Zulliger
als Dichter» in Die Berner Woche, Bern, 20. 2. 1942, S. 214; - 91) Ernst Schneider, «Zur Seminarfrage» in Der Bund, 11. 2. 1916, S. 3; - 92) Paul Antener, «Was es mit den unheimlichen Sagen
auf sich hat» in Burgdorfer Tagblatt, 3. 6. 1997, S. 4; - 93) Hans Zulliger, «Über Gespensterfurcht» in Die Berner Woche, Bern, 3. 5. 1924, S. 244f; - 94) Hans Zulliger, Bausteine zur
Kinderpsychotherapie und Kindertiefenpsychologie, Bern / Stuttgart 1957, S. 7/247; - 95) Hans Zulliger, Bausteine zur Kinderpsychologie, 2. erweiterte Auflage, Bern / Stuttgart, Okt. 1965, S. 8;
- 96) Hans Zulliger, «Der Diré Schneider» in Erinnerungsbuch Münchenbuchsee - Hofwil-Bern - 100 Jahre des deutsch-bernischen Seminars Hofwil-Bern, Bern, 1933, S. 169-173; - 97) Ernst Schneider,
Aus meinen Lern- und Lehrjahren, Bern, V: Pestalozzi-Fellenberg-Haus Bern, 1956, S. 42ff; - 98) Christian Müller und Rita Signer, Hermann Rorschach (1884-1922) Briefwechsel, V: Hans Huber, Bern,
2004, S. 401; - 99) Brief von Hans Behn-Eschenburg an Hans Zulliger (15. 6, 1923), Archiv für Medizingeschichte der Uni Bern, Rorschach-Archiv, Fonds Hans Behn-Eschenburg, Sign: Rorsch BE 1:36; -
100) Briefkorrespondenz von Hans Zulliger an Emil Oberholzer (5. 6. 1933) mit Inhaltsangabe Rorschach-Buchplan (20. 5. 1933), Oberholzer an Hans Zulliger (8. 6. 1933), Archiv für
Medizingeschichte der Uni Bern, Archiv Rorschach, WM 1:8; - 101) Barbara Helbling-Gloor, «Die Pfahlbauer in Schulbuch und Jugendliteratur» in Pfahlbaufieber - Mitteilungen der Antiquarischen
Gesellschaft Zürich, Band 71, V. Chronos, Zürich, 2004, S. 194f; - 102) Luzina Knobel, «Paul Hulliger» in lexikon-riehen.ch, aufgerufen 2025; - 103) Hans Zulliger, «Hulligerschrift als
Reformbeitrag» in Schweizer Schule, Olten, 1. 4. 1934, S. 328; - 104) Hans Zulliger, «Glossen zum Thema Schriftreform und Schulreform» in Berner Schulblatt, Bern, 6. 8. 1932, S. 237f; - 105)
«Hulligerschrift?» in Bieler Tagblatt, Biel, 11. 11. 1933, S. 4; - 106) W., «Eine Kriegserklärung an die Hulligerschrift» in Burgdorfer Tagblatt, Burgdorf, 3. 9. 1933, S. 2
UBA FFM Na 1, 134. Nachlass Max Horkheimer- Briefkorrespondenz im Zusammenhang der Sigmund-Freud-Gedächtnis-Vorlesung 1956. Institut für Sozialforschung der Goethe-Universität,
Digitalisiert durch die Universitätsbibliothek J.C. Senckenberg Frankfurt am Main, 2011: 107) Max Horkheimer an Hans Zulliger, 24.12.1955, 238r; - 108) Hans Zulliger an Max Horkheimer,
24.12.1955, 237r; 109) Philosophisches Seminar Frankfurt am Main an Hans Zulliger, 2.6.1956, 236r;- 110) Philosophisches Seminar Frankfurt am Main an Hans Zulliger, 30.8.1956, 235r; - 111) Max
Horkheimer an Hans Zulliger, 5.1.1957, 234r; - 112) Hans Zulliger an Max Horkheimer, 13.1.1957, 233r
113) Hans Zulliger, in «Das Besondere an der Hulligerschriftvorlage» in Hulligerschrift, V: H. Huber, Bern, 1933, S.60ff; - 114) Hans Zuliger, «Die Pfahlbauer - Lektionsskizzen zur Behandlung
ihrer Kultur» in Ernst Schneiders Vom Geschichtsunterricht in der Volksschule und von historischer Bildung, Berlin, 1919, S. 31ff; - 115) Kontrollblatt der Einwohnergemeinde Bolligen
Postadresse: Altstadtleist Biel, Obergässli 11, 2502 Biel/Bienne. Lokal: Brunngasse 11, Tel. 032 323 42 84,
Öffnungszeiten auf Anfrage
Adresse postale: Guilde de la vieille ville, Ruelle du Haut 11, 2502 Biel/Bienne. Local: Rue des Fontaines 11, Tel: 032 323 42 84.
Heures d'ouverture sur demande.