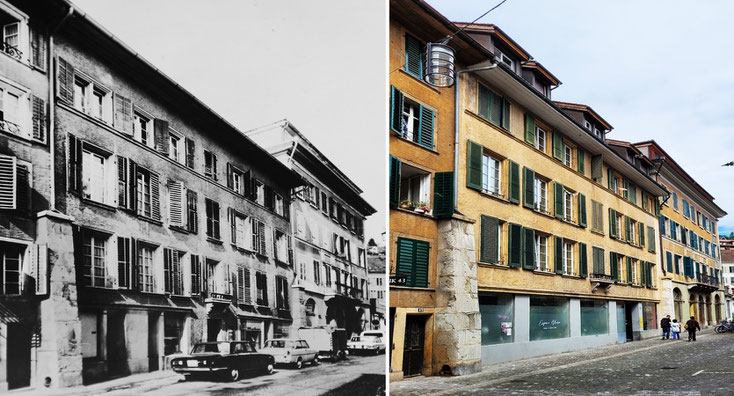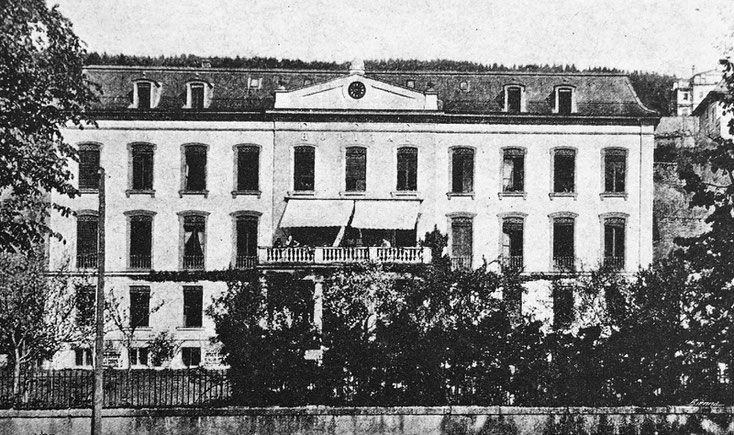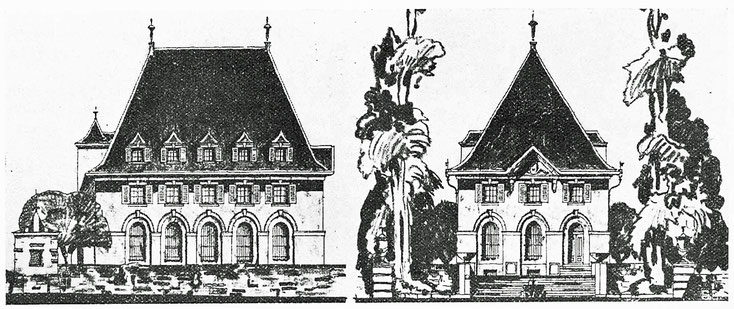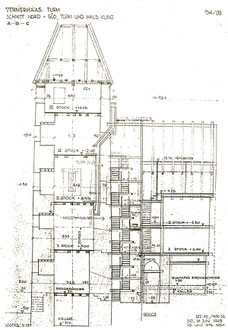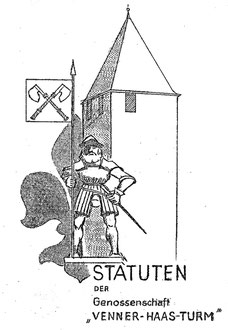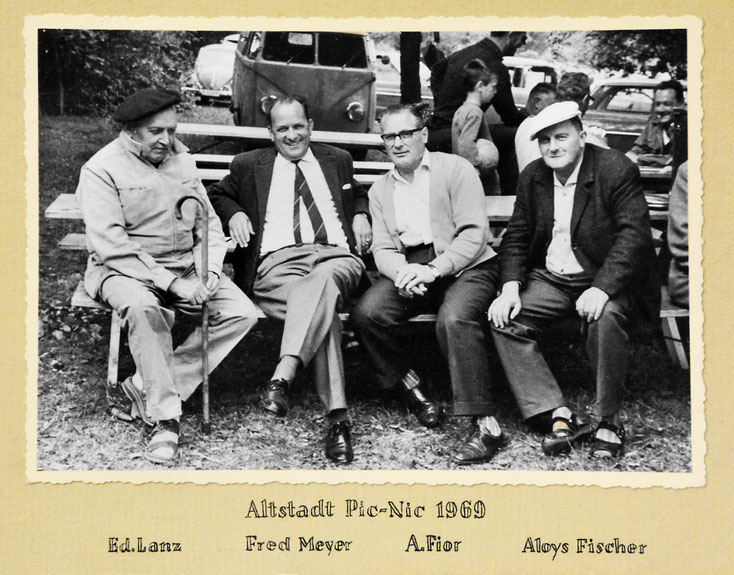- Brunngasse / Rue des Fontaines
- Burgplatz / Place du Bourg
- Burggasse / Rue du Bourg
- Jakob-Rosius-Strasse / Rue Jakob-Rosius
- Kanalgasse / Rue du Canal
- Kirchgässli / Ruelle de l'Eglise
- Obergasse / Rue Haute
- Obergässli / Ruelle du Haut
- Quellgasse / Rue de la Source
- Ring
- Römergässli / Rue des Romains
- Schmiedengasse / Rue des Maréchaux
- Untergasse / Rue Basse
- Untergässli / Ruelle du Bas
- Juravorstadt / Faubourg du Jura
- Mühlebrücke / Pont du Moulin
- General Dufour-Strasse / Rue du Général-Dufour
- Das Dufour Schulhaus - Überblick
- Das Dufour Schulhaus - Kloster und Spital
- Das Dufour Schulhaus 1818-1819
- Das Dufour Schulhaus - Abram-Emmanuel und Edouard Tièche
- Das Dufour Schulhaus 1818 - Louis Agassiz
- Das Dufour Schulhaus 1820-1827
- Das Dufour Schulhaus 1828-1835
- Das Dufour Schulhaus - Lehrer in geheimer Mission
- Das Dufour Schulhaus 1836-1838
- Das Dufour Schulhaus 1837 Jean Joseph Hisely
- Das Dufour Schulhaus 1839-1842
- Das Dufour Schulhaus 1843-1849
- Das Dufour Schulhaus 1845 Albert Friedrich Haller
- Das Dufour Schulhaus Kinder der Fabrik
- Das Dufour Schulhaus 1850-1869
- Das Dufour Schulhaus - Armin und Arnold Mueller
- Das Dufour Schulhaus 1870-1880
- Das Dufour Schulhaus 1881-1887
- Das Dufour Schulhaus 1885 - Hermann Aegler
- Das Dufour Schulhaus 1888 Robert Walser I
- Das Dufour Schulhaus 1888 Robert Walser II
- Das Dufour Schulhaus 1888-1891
- Das Dufour Schulhaus 1891 Grock
- Das Dufour Schulhaus 1892 - Gottlieb Hauser
- Das Dufour Schulhaus 1892-1895
- Das Dufour Schulhaus 1896-1898
- Das Dufour Schulhaus 1893 - Eduard Amsler
- Das Dufour Schulhaus 1896 - Hermann Hubacher
- Das Dufour Schulhaus 1897 - Emil Meyer
- Das Dufour Schulhaus - Die Familie Lanz
- Das Dufour Schulhaus 1897 - Fritz Antenen
- Das Dufour Schulhaus 1899-1905
- Das Dufour Schulhaus 1902 Werner Bourquin
- Das Dufour Schulhaus 1902 - MAURICE UND ANDRÉ VAUCHER
- Das Dufour Schulhaus 1905 - Karl Schoechlin
- Das Dufour Schulhaus 1906-1908
- Das Dufour Schulhaus 1908 - Hans Schoechlin
- Das Dufour Schulhaus 1909-1910
- Das Dufour Schulhaus 1911-1950
- Das Dufour Schulhaus 1951-2011
Das Dufour-Schulhaus / L' école Dufour

Die Familie Lanz: 3 Generationen am Dufourschulhaus

Die Familie Lanz entstammt einer Arztfamilie, die ursprünglich im «Berg» in Huttwyl (Oberaargau) seit Generationen den Beruf des Arztes mit dem des Landwirts verband. In Biel stimmten sie als Ärzte die politischen Geschicke des Städtewesens in uneigennütziger Weise mit und später nach dem Beitritt in den Kanton Bern verhalfen sie der demokratischen Entwicklung zum Durchbruch. [71] Die Famile, aus der ein Architekt hervorging, besuchte im Dufourschulhaus das Progymnasium und Obergymnasium.
Zu ihnen zählen Joseph Lanz (1818-1908), Friedrich Emil Lanz (1851-1926), Eduard Lanz (1886-1972) und sein Bruder Willy Lanz (1888-1924). Sie wohnten alle im Haus an der Schmiedengasse 10. In älteren Dokumenten wird Untergasse 10 angegeben. Am 10. Januar 1935 stellte Frau Dr. Lanz-Bloesch an den Gemeinderat Biel das Gesuch, das Teilstück der Untergasse zwischen Mühlebrücke und Collègegasse wieder mit dem früheren Namen Schmiedengasse zu bezeichnen. Dem Gesuch wurde 1936 entsprochen. [61]
Gebaut wurde das Haus aus Hauterive-Quadern mit drei Obergeschossen zu je drei Fensterachsen. Es hat ein Hof mit Galerie, die zum gleichzeitig errichteten Hinterhaus am Kanalgraben führt. Auf einem der erhaltenen Fassadenpläne hatte Eduard Lanz, als Baujahr 1790 und Samuel Jakob (gest. 1812) als Architekten vermerkt.[38] Das Haus gehörte unter anderem dem Politiker Georg Friedrich Heilmann (1785-1862). Dieser war der Bieler Gesandte am Wiener Kongress 1814-15 und Mitglied der 1819 gegründeten Studentenverbindung «Zofingia». Nachdem Heilmanns Tochter Emilie (1823-1856) Joseph Lanz 1848 heiratete, war das Heim an der Schmiedengasse in Biel 100 Jahre bekannt als «Haus von Dr. Lanz». 1929 eröffnete der neu gegründete Krankenpflegeverein der reformierten Kirchgemeinde Biel seine Tätigkeit im Hause Lanz. Drei Krankenschwestern bezogen die Wohnung und besorgten die Krankenpflege in den Familien der Vereinsmitglieder und denjenigen, die dem Verein beizutreten wünschten.[32]
Das vornehme Bürgerhaus, welches von der Familien Heilmann in den Besitz der Familie Lanz übergegangen war, hatte in seinen Räumen zahlreiche Kunstschätze und
Bücher. Es lebte von geschichtlichen Erinnerungen, alter Traditionen. In diesem Umfeld wuchs die nächste Generation der Lanz auf, die mit dem Haus fest verwurzelt waren.[47] Das Hinterhaus wurde in der Mitte des 19. Jahrhunderts im Parterre und im ersten Stock umgebaut und 1923/24 von Eduard Lanz um ein Geschoss auf die Höhe des
Hauptgebäudes aufgestockt. Im ehemaligen Ärztehaus richtete Eduard Lanz 1924 sein Architektenbüro ein.[38] 1994 konnte das Gebäude saniert
werden.

Joseph Lanz (1818-1908), Spitalarzt, Sänger, Mitglied der Studentenverbindung «Zofingia»
Schüler am Progymnasium Biel
Mitglied der Schulkommission vom Progymnasium von 1862 bis 1868
Joseph Lanz kam am 12. Dezember 1818 in Alchenstorf bei Koppigen, als Sohn von Johann Jakob Lanz (1785-1855) und Anna Elisabeth Probst (1782-1858) zur Welt. Dort verbrachte er seine religiös geprägte Jugend als Spross einer angesehenen Arztfamilie. Bereits sein Grossvater Samuel (1756-1842) hatte sich dort als Chirurgus niedergelassen. Der Spruch an Samuels Ofen war zugleich auch das Familienmotto: «Gott ist der Arzt und ich sein Knecht. Wenn er will, so heile ich recht.» Im Verzeichnis der patentierten Ärzte des Kantons Bern 1807 findet sich vom Geschlecht Lanz fünf Ärzte mit Wohnadressen: ein Lanz (Arzt und Wundarzt) in Melchnau, Samuel Lanz (Arzt und Wundarzt) in Koppigen, Joseph Lanz (Wundarzt) in Wyssachengraben, sowie Johannes (1740-1810) und Andreas Lanz (Arzt und Wundarzt) in Huttwil.
Im Alter von 12 ½ Jahren kam Joseph 1831 nach Biel, wo ihn die Familie des Goldschmieds Seiz im Obergässli in Pflege nahm. Nach dem Besuch des Bieler Gymnasiums begann er 1836 das Medizinstudium an der neu gegründeten Berner Hochschule, wo Eduard Fueter, F. W. Vogt, Hermann Demme und Karl Emmert seine Lehrer waren. Dort war er von 1837 bis 1841 aktives Mitglied des Zofingervereins.[46] Neben seinen Studien liebte er besonders das Turnen und den Gesang.[119] 1841 erhielt er das Staatsexamen und setzte seine Studien in Paris und Berlin fort. Von dort teilte Joseph Lanz in Briefen seinem ehemaligen Lehrer Karl Emmet eine Reihe von Beobachtungen über die Berliner medizinische Schule im Winter 1841/42 mit:
Joseph Lanz: «Es lässt sich nicht leugnen, dass Berlin durch seine grossartige Anstalten und die Vereinigung vieler ausgezeichneter Männer immer mehr an Glanz
zunimmt und dem Arzt und jedem anderen Gelehrten ungeheuer viel bietet. (…) Manche Einrichtungen scheinen aber nur dafür da, um den Studenten Geld abzupressen, und um diesen teuren Preis
findet man doch keineswegs alles, was man verlangen könnte. (…) Die ehemalige Ruts’sche Klinik in der Charité über Chirurgie und Augenheilkunde hat jetzt *Jüngken. Ich sah ihn mit wahrem
Entsetzten bei einer Narkose des Oberschenkels Hammer und Meissel anwenden (…) Die ehemalige lateinische Klinik hat Schönlein übernommen, von dem man hier über viel Wunderkuren erzählt, von denen
aber freilich in der Klinik nur so viel zu sehen ist, dass er uns interessante Präparate liefert, die aber so wenig wie anderswo mit der Diagnose immer übereinstimmen. Das zwei Stunden lange
Sprechen scheint ihn zu ermüden und man muss in seiner Nähe sein, wenn man ihn hören will. (…) Die Ohan’sche Universitäts-Poliklinik leitet und organisiert *Romberg. Er ist der geistreichste und
gelehrteste Professor der Medizin, den ich hier kennen gelernt habe. Sein Werk über die Geisteskrankheiten, das ich wie noch selten mit wahrem Genuss durchstudierte, verrät den gelehrten
Empiriker, der Neues und Wahres bringt (…) In der ehemalige Graef’sche Klinik erhält *Dieffenbach viel Applaus, den er sowohl durch seine Kühnheit und Fertigkeit als auch wegen seiner
Wissenschaftlichkeit verdient. Angelstein, ein guter Augenoperateur und routinierter Praktikus, ist sein Oberarzt. Bei ihm sind oft sehr interessante Fälle zu sehen. (…) Das Studentenleben, das
nur etwa in der Anbetung von Liszt’s etwas Eigentümliches zeigt, bietet mir keine Gelegenheit zu Zerstreuung.»[115]
*Johann Christian Jüngken (1793-1875) Chirurg, Augenarzt; Moritz Heinrich Romberg (1795-1873), Neurologe, schrieb das Lehrbuch der Nervenkrankheiten, Ehrengrab
der Stadt Berlin; Johann Friedrich Dieffenbach (1792-1847), Wegbegleiter der plastischen Chirurgie.
Wieder in der Schweiz liess sich Joseph Lanz als Arzt in Alchenstorf nieder und praktizierte dort zwei Jahre lang. 1843 wurde er Mitglied der Medizinisch-chirurgischen Gesellschaft des Kantons Bern. Ab 1845 wohnte und behandelte er seine Patienten in Biel. Am Juli 1854 zog er ins Haus von Oberst Heilmann in die Schmiedengasse 10 und eröffnete seine Praxis im zweiten Stock. Daneben half er als Assistenzarzt im Spital Untergasse 45.
Familie
Joseph Lanz heiratete zweimal: am 15. 6. 1848 Emily Heilmann (1822-1856), Tochter des Bieler Politikers Georg Friedrich Heilmann, mit der er fünf Kinder hatte, von denen er nur Emil (1851-1926)
und Elisabeth Mathilde Emilie (1852-1889) aufwachsen sah (119). Nach deren Tod heiratete er am 21. 10. 1858 die Pfarrerstochter Julia Sophia von Rütte (1828-1923) aus Sutz, die die Kinder
liebevoll aufzog. Sophias Weltanschauung war vor allem karitativ geprägt: Als Mitbegründerin und langjähriges Mitglied des Bieler Spitalbasars unterstützte sie das Gemeindespital finanziell. Als
Präsidentin des Frauenkomitees organisierte ab 1875 einen Bazar zugunsten des «Asyls für arbeitslose, verlassene Mädchen». Der Bazar war mit einem «Teeabend» verbunden. Das Asyl, das manchem verwahrlosten Mädchen ein Zuhause gab, war ganz auf Wohltätigkeit angewiesen und musste 1887 aufgelöst werden. Es konnte jedoch in kleinerer und kostengünstigerer Form weitergeführt werden. 1894 fanden dort 134
Mädchen Schutz und Aufnahme und konnten in Familien untergebracht werden. Sophia leitete als Präsidentin auch den am 1. März 1848 von 12 Bielerinnen gegründeten Frauen-Krankenverein. Die
Poliklinik des Spitals lieferte ihnen die nötigen Medikamente. Annemarie Geissbühler-Lanz im BT: «Jedes Mitglied bezahlte 4 L, stiftete ein Leintuch und gab eine Suppenzusicherung ab. Die
eigentliche Krankenpflege übernahm eine vom Verein angestellte Krankenschwester.»[111] Der Verein versorgte Kranke und Bedürftige mit frischen Speisen
(2742 Portionen Suppe im Jahr 1876) und Lebensmitteln. In der vom Verein gegründeten christlichen Volksbibliothek wurden jährlich bis zu 10‘000 Bücher ausgeliehen. Bevor die Bücher in Umlauf
kamen, mussten sie vom Pfarrer genehmigt werden. Sie starb am 24. Juli 1923 mit 95 ½ Jahren als älteste Bielerin.[4]
Arzt der Bieler Notfallstube
Als das Gymnasium 1818 wegen Platzmangel ins Spitalgebäude (Dufourschulhaus) verlegt wurde, erhielt die Armenverwaltung der Burgergemeinde im Gegenzug das Thellunghaus an der Untergasse
45.[112] Am 15. April 1836 beschloss der Rat von Biel, «der Regierung für die Errichtung einer kantonalen Notfallstube den zweiten Stock mit dem
Gewölbe im Erdgeschoss des Spitalgebäudes an der Untergasse auf 6 Jahre in Miete zu geben.» Die Notfallstube wurde am 5. April 1837 mit sechs Betten eröffnet und diente auch den Ämtern Nidau,
Büren, Courtelary und Erlach. In seinem Werk «Die Notfallstube in der Bieler Altstadt 1837-1866» erwähnt Christian Forney: «Notfallstuben waren Einrichtungen der staatlichen Armen- und Krankenfürsorge, in denen Kranke und Verletzte, die dringen ärztliche Hilfe bedurften, sofort untergebracht
werden konnten. Darüber hinaus wurden arme und bedürftige Personen in diesen primär für medizinische Notfälle bestimmten Krankenstuben unentgeltlich behandelt und gepflegt. Solche Einrichtungen
waren im Kanton Bern insbesondere in der Mitte der 1830er Jahre, also in der Zeit der liberalen Regeneration, in verschiedenen Landesteilen eingerichtet worden.»[118] Zur Notfallstube Biel zählte laut dem Departement des Inneren «das Seeland und der reformierte Teil des Jura.»
Der Aufsichtskommission gehörten u.a. von 1836 bis 1845 der Theologe Charles Ferdinand Morel (1772-1842) und von 1854 bis 1863 der Hauptmann Gottfried Scholl (1803-1865) an.[118] Durch die Notfallstube wurde es nicht nur eng im Spital, es gab auch zu wenig Platz für die Patienten. Sie mussten alle im Obergeschoss untergebracht werden. 1842 hielt eine Nervenfieberepidemie Biel in Atem, mit der sich der damalige Spitalarzt Caesar Adolph Bloesch (1804-1863) auseinandersetzte. Die Notfallstube wurde abwechselnd von Dr. Johannes Gatschet und Dr. Karl Theodor Schaffter (dem Älteren) geleitet und nach dem Tod des Letzeren und der Abreise des Ersteren 1842 von Dr. Eugen Ludwig Neuhaus. Dieser trat 1851 in neapolitanische Dienste und starb ein Jahr später an Nervenfieber.
«Unteres Thellunghaus» an der Untergasse 45. Von 1818 bis 1866 Spital. 1973 unter Rekonstruktion der Fassade von 1666 (ohne Ladengeschoss) neu erbaut. Fotos: Archiv Altstadtleist. [14]
1845 gründete Joseph Lanz zusammen mit Eugen Neuhaus den Seeländischen Bezirksverein. Der Zweck des Vereins war die Förderung der Wissenschaft und der Kollegialität
unter dem Medizinpersonal. Es ist gut möglich, dass Lanz durch Eugen Neuhaus dazu angeregt wurde, als Stellvertreter in der Notfallstube mitzuarbeiten. 1851 wählte man Lanz zum Bataillonsarzt des
Bataillons Nr. 18. In dieser Funktion nahm er am Sonderbundskrieg mit dem Bataillon Ganguillet teil, das gegen Freiburg operierte. [7] In der medizinischen Fachwelt machte sich Joseph Lanz 1851
einen Namen, als es ihm gelang einen an Lungenschwindsucht erkrankten Patienten durch eine zweijährige Kur vollständig zu heilen. Er verordnete Oelum jecoris Aselli mit Inhalation von warmen
Wasserdämpfen. Hinzu kam eine Ableitung von Oleum jecoris und Lichen islandicus mit einem Haarseil. Ein Teil seiner Studien befasste sich mit der Linderung von Wehenkrämpfen als Geburtshindernis.
Über mehrere Jahre traten im gleichen Wirtshaus Fälle von Asphyxie auf, bis Joseph Lanz herausfand, dass dies auf eine fehlerhafte Konstruktion des Stubenofens zurückzuführen war.
1851 wurde Dr. David Nieschang definitiv Spitalarzt. Er mochte keine Kritik und ohrfeigte deswegen auch schon mal die Spitalabwartin. [118] Nieschang teilte sich das Amt mit dem
Aristokraten und Chirurgen Carl Neuhaus (1829-1893), der 1858 die schlecht bezahlte Leitung des Spitals unter sehr prekären Verhältnissen übernahm. In einem Spital-Jahresbericht schilderte er:
«Keine Spur von Ventilation, überfüllte Krankenzimmer, mangelnde Isolierräume, schmutziges Verbandsmaterial und Bettzeug, langes aufbewahren der Leichen im Haus selbst, ein finsterer, stinkender
Hof mit einem Schweinestall und permanente Ausdünstungen aus der mangelhaften Abtrittsgrube. In einer offenen, den ganzen Hof durchschneidende Rinne, floss das gesamte Spülwasser des Spitals und
der Nachbarhäuser. An die hintere Hofmauer anstossend befand sich ein grosser nachbarlicher Düngerhaufen, dessen flüssiger Inhalt denselben ganz durchnässte und im Winter wahre Jauchegletscher
bildete.» [123] Der Aufstieg in die oberen Stockwerke war mühsam, da die schmale und steile Wendeltreppe den Transport der Kranken unnötig erschwerte. Medizinische Fachzeitschriften waren
entsetzt: «Man kann es kaum für möglich halten, dass dieses Spital in dem finsteren Hausa an der engen Untergasse existieren kann, da alles den sanitären Bedingungen einer solchen Anstalt
zuwiderläuft.» Neuhaus liess sich nicht entmutigen und fand in Joseph Lanz einen wertvollen Mitarbeiter und Freund.
Weder die Burgergemeinde noch der Direktor des Sanitätswesens hatten Geld, um das verlotterte Spital zu modernisieren. Ein 1854 erfolgter Umbau der burgerlichen Armenkommission milderte das
Problem etwas, beseitigte es aber nicht. 1857 wurde der Gipsverband eingeführt. Die Gipsschienen erhielten eine gleichmässige Dicke, als ein Bäcker auf die Idee kam, das Gipspulver durch ein Sieb
zu streuen. [120]
Eröffnung vom Gemeindespital Pasquart 1866
Die baulichen und hygienischen Zustände des Spitals an der Untergasse veranlassten Joseph Lanz und Carl Neuhaus, einen Spitalbaufonds zu gründen, um ein Spital in einem anderen Quartier zu
errichten.[31] 1863 ging die Verantwortung für das Spitalgebäude von der Burger- auf die Einwohnergemeinde über.[118]
Am 4. Januar 1864 fand die erste Sitzung der vom Gemeinderat eingesetzten Spitalbaukommission unter Präsident Gustav Bloesch statt. Im April 1864 erfolgte die definitive Einigung über den
Bauplatz von August Wildermett auf dem Pasquart. Im Januar 1865 beschloss der Gemeinderat, die Spitalbaukommission (Präsident Dr. Neuhaus) mit dem Bau zu beauftragen. Mit finanziellen Mittel des
Baufonds, der Burger- und Einwohnergemeinden des Seelands und des Juras, von Privaten und der Ersparniskasse Biel konnte das Spital durch den Architekten Rychner gebaut werden. Am 29. November
1866 wurde der Neubau in Betrieb genommen. [126] Das Spital war für 60 Patienten knapp bemessen. Da es ständig auf finanzielle Hilfe angewiesen war, befand sich darin wie in einer Kirche ein
Opferstock. 63 Gemeinden trugen jährlich zum Unterhalt der Betten bei, davon 15 aus dem Jura (2 Betten) und 27 aus dem Amtsbezirk Nidau (2 Betten). Die Stadt Biel bezahlte 1 Bett.[120]
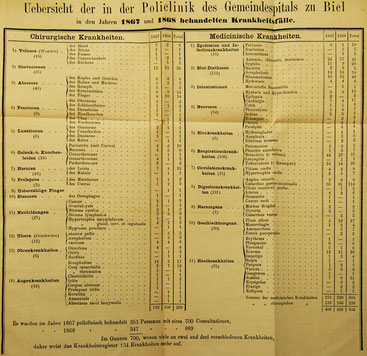
Joseph Lanz beteiligte sich in der Entwicklung, Organisation und Verwaltung des Gemeindespitals am Pasquart. Dem Spital war eine Krätzkuranstalt (ab 1869) und eine
Poliklinik angegliedert. Joseph Lanz teilte sich das Amt des Spitalarztes mit Carl Neuhaus, 4 Krankenschwestern betreuten die Patienten. Die für den Nachtdienst eingeteilte Schwester hatte 12 Uhr
mittags ins Bett zu gehen und um Schlag 9 Uhr wieder aufzustehen. Die Spitaldirektion entwarf und genehmigte die Hausordnung und Dienstvorschriften. Bezüglich des Dienstbotenzimmers führten
sie die Bestimmung ein, dass jede Bieler Familie gegen einen Jahresbeitrag von Fr. 6.- das Recht habe, bei allfälliger Erkrankung weiblicher Dienstboten, dieselben in erster Linie in diesem
Zimmer unterzubringen. Im ersten Jahr schlossen sich 82 Familien diesem Regulative an. Wegen der voraussichtlichen Zunahme von männlichen Patienten durch die Juragewässerkorrektion kam 1867 ein
neues Zimmer mit fünf Betten hinzu. Die Anstalt verfügte nun über 40 aufgerüstete Krankenzimmer. Zur Desinfektion der Kleider der neu aufgenommenen Patienten und der Krätzigen wurde im Badehaus
ein eiserner Infektionsofen eingerichtet. Das Spital verfügte endlich über ein modernes Ventilationssystem, dessen einziger Nachteil im hohen Kohlenverbrauch für den Luftaustausch
bestand.[120]

Eine der besten Errungenschaften des Neubaus, die dem Spitalverwalter Joseph Lanz zu verdanken ist, war die Installation von Warm- und Kaltwasserleitungen (nach dem Vorbild zweier Basler Spitäler), deren Erstellung der auf dem Gut vorgefundene Brunnen ermöglichte. Der Brunnen versorgte die Kessel des Waschhauses, den Rinnstein, die Küchenkochtöpfe und die drei im Erdgeschoss befindlichen Badezimmer mit reichlich reinem Quellwasser. Dieses wurde mittels eines Pumpwerks auf den Estrich des Hauses, in ein grosses, schmiedeeisernes Reservoir getrieben. Das Reservoir versorgte alle Toiletten mit dem nötigen Spülwasser. Es ermöglichte durch die Speisung des Warmwasserapparates, der mit einem Kessel mit dem Kochherd verbunden war, die Installation von Kalt- und Warmwasserhähnen der Lavabos der drei Stockwerke.
Was immer noch fehlte war ein Eiskeller, obwohl Eis zur Linderung der Schmerzen in allen Krankenhäusern fast unentbehrlich geworden war. Die drei Eisgruben der Stadt
lieferten abwechselnd und unentgeltlich das nötige Eis, ebenso Franz Walter von der Bierbrauerei Walter. Am meisten Eis spendete die Witwe Bridel-Schwab. Das Spital wünschte, einmal auch Eis zum Aufbewahren von Vorräten und Lebensmitteln zu
haben. Ein weiteres Problem war das Schnelltrocknen der Wäsche im Winter.[120]
1867 erhielt das Spital eine beträchtliche Summe an Legaten: 20‘000 Franken vom Bieler Kaufmann Adolf Perrot und 4‘000 Franken von F. H. Bourquin (Sonvillier), Uhrmacher in Madretsch. 249
Patienten/innen wurden unentgeltlich und 120 gegen Entgelt behandelt. In der Poliklinik waren es 353 unentgeltliche Patienten. Ein Pflegetag kostete durchschnittlich 156 Cents, ein Bett jährlich
Fr. 569.40.-.[120]
Die finanziellen Mittel, die dem Krankenhaus zur Verfügung standen, reichten bei weitem nicht aus, um alle Aufgaben zu erfüllen. Die Ausgaben für Kinder und arme Kranke führten zu einem Defizit.
Deshalb gründete Julia Sophia Lanz 1867 zusammen mit Frau Locher-Hartmann und Josephine Kuhn-Barber ein Damenkomitee, das jährlich den «Bazar zu Gunsten des Gemeinde-Spitals von Biel»
veranstaltete. Per Inserat wurde die Bieler aufgefordert, ihre Spenden in den Pfarrhäusern oder im Haus Lanz abzugeben. Der erste Basar fand im grossen Rathaussaal statt und brachte 2382 Franken
ein.
Nach der Statistik des Bieler Spitals gehörten zu den krankheitsanfälligsten Berufen: Taglöhner (70), Knechte (43), Mägde (42), Landarbeiter/innen (25), Uhrmacher/innen (44), Hausfrauen (41),
Zimmerleute (14), Eisenbahner und Angestellte (11), Holzfäller (9) und Mechaniker (9). Joseph Lanz ging der Frage nach, ob die Uhrmacher berufsbedingt an sogenannten «Uhrmacherkrankheiten»
litten, konnte aber nichts Konkretes feststellen. 1869 spendete Progymnasiallehrer Heinrich Boltshauser (1803-1872) 9 Waschzüber und Oberst Friedrich Schwab (1803-1869) kurz vor seinem Tod 165 Maas Krankenwein mit Fass.[121]
Aufgrund einer Hausepidemie von Pyämie bei Chirurgischkranken 1869 überlegte man sich ein Isolierhaus für ansteckende Krankheiten zu bauten. Im gleichen Jahr erhielt das Spital als Legat von den
Erben des Oberst Schwab 50‘000 Franken, die oberhalb des Spitalsgutes befindliche Rebe am Unter-Tschäris und das sogenannte Hohlengut in Madretsch, mit Haus und 8 Juch. Land.[121] Dieses Legat ermöglichte 1874 den Bau der Isolierstation und weitere Dependenzen: Im Hauptgebäude Wäsche- und Vorratskammern, neue Badezimmer im Erdgeschoss,
mehrere Kranken- und Schwesternzimmer und im Hintergebäude Wein- und Eiskeller, Totenkammer, Operations- und Sektionszimmer und Waschhaus. Eine Galerie verband die beiden Gebäude.[126]
Ab den 1870er war Joseph Lanz Vizepräsident und Verwalter der Spitaldirektion und Präsident des Spitalkollegiums. Sein Sohn Dr. Emil Lanz war ebenfalls Mitglied dieses Kollegiums. 1871 gründete
die Ersparniskasse einen Fonds, der die Einrichtung einer Kinderabteilung ermöglichte.[122]
1872 breitete sich die Blatternkrankheit in Biel aus. Um die Krankheit einzudämmen, wurden alle Häuser, in denen die Betroffenen langen, mit einem Erkennungsplakat gekennzeichnet. Die Direktion des Inneren ernannte Joseph Lanz zum Kreisimpfarzt für den Amtsbezirk Biel. Erst nachdem das betreffende Haus nach seinen Anweisungen gereinigt worden war, konnte das Plakat mit Bewilligung der Ortspolizei entfernt werden.
1873 war ein Fünftel der Patienten von Ungeziefer befallen, was die Krankenschwestern vor eine grosse Herausforderung stellte. 1874 erlebte das Spital eine Epidemie
von Wunddiphterie und Spitalbrand. [123] 1878 führte Dr. Neuhaus die moderne antiseptische Wundbehandlung ein. Eine Finanzspritze erhielt das Spital 1879/80 durch ein Legat von 20‘000 Franken von
Pfarrer und Dichter Adam Friedrich Molz (1790-1879) und
seiner Frau Emilie Molz (gest. 1874). [124]1883 riefen Joseph Lanz, Karl Neuhaus und zwei weitere Ärzte zur Gründung eines Spitals für Unheilbare auf. Sie waren der Meinung «dass die Unheilbaren
in der Krankenpflege vergessen oder übergangen worden sind. Daher soll in Biel ein Spital für Unheilbare gegründet werden.» 1889 konnte das Spital ein «Krankenasyl für Unheilbare und
Rekonvaleszenten» im Nachbargebäude (Besitzung Lehmann-Cunier, Seevorstadt 61) unterbringen. Von 1887 bis 1890 erhielt das Spital 1000 Franken von Verdan-Wildermett (1887), 3000 Franken von
Drahtzug- und Baumwollspinnereileiter Fritz Bloesch-Neuhaus (1888) und 10‘000 Franken von François Verdan (1889). 1890 spendete Joseph Lanz 5000 Franken für die Unheilbaren und Rekonvaleszenten.
[125]
Gründung von Biels 1. Kinderkrippe
1888 gründete Joseph Lanz zusammen mit der Armenkommission der Stadt Biel eine Tageskrippe für Kinder im Alter von 6 Wochen bis 4 Jahren. Damit sollten Mütter entlastet werden, die ausser Haus
arbeiteten oder durch Krankheit verhindert waren. Im April 1890 wurde für die «Kinder-Krippe Bubenberg» der Vorstand definitiv konstituiert. Die Aufsicht oblag einem Damenkomitee. Sie
verpflichteten sich, die Krippe regelmässig zu besuchen und die Aufsicht zu führen. Sie hatten auf folgendes zu achten: Sauberkeit, Ernährung, Pflege und Bekleidung der Kinder, Zahlung des
Kostgeldes, korrekte Anmeldung, Ordnung und Sauberkeit der Unterkunft, Belüftung der Zimmer, Instanthaltung von Mobiliar, Wäsche, Küchengeräte, Ausstattung und Versorgung der Küche. Ausserdem
besuchten sie häufig die Familien der Kinder, um sich zu vergewissern, dass die Eltern wirklich ausser Haus arbeiten. Die Krippe war von Montag bis Samstag von 6 Uhr morgens bis 20 Uhr abends
geöffnet. Die Suche Räumlichkeiten erwies sich als schwierig. Einer der ersten, welche die Krippe finanziell unterstützten, waren die Uhrenfabrikanten von Omega. Louis Brandt, sein Sohn und die
Mitarbeiter legten die damals stolze Summe von 150 Franken für dieses gemeinnützige Werk zusammen.[109] Joseph Lanz war nicht nur Vorstandsmitglied,
sondern auch der Kinderarzt der Krippe. Die Einweihung fand am 1. Dezember 1890 im Juraquartier an der Mittelstrasse statt. Aus Platzmangel erfolgte im Juni 1891 der Umzug ins Haus Bichsel am
Friedhofweg 22. Dank Beiträgen der Burgergemeinde, Einwohnergemeinde, des Armenvereins, der Ersparniskasse, der Loge «Stern am Jura» sowie verschiedener Legate und Kollekten konnte der Betrieb
aufrechterhalten werden.
Später wurde Emil Lanz Vorstandsmitglied der Bieler Krippe. Der Verein übernahm 1894 das Krippengebäude und liess sich im Handelsregister eintragen. Laura Lanz gehörte dem Damenkomitee an und
besuchte die Kinder mehrmals wöchentlich. Aufgrund der sich abzeichnenden Defizite beschloss der Vorstand, den Gemeinderat um einen jährlichen Beitrag zu bitten. Dessen ablehnende Haltung führte
1896 beinahe zur Schliessung der Einrichtung und zur Liquidation des Vereins. Sobald die Kinder 4 Jahre alt waren, mussten sie wieder in ihre prekären und teilweise unbeaufsichtigten
Wohnverhältnisse zurückkehren, da die Stadt Biel bis 1926 keinen Kindergarten für Kinder ab 4 Jahren hatte.
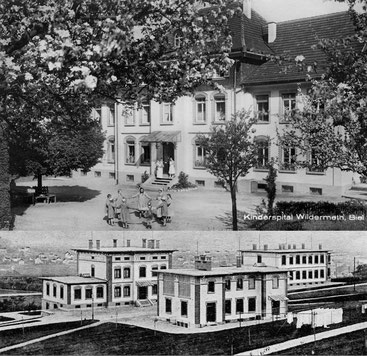
Im Verwaltungsrat des Kinderspitals Wildermeth (1884-1889)
Da die Bevölkerung Biels stark angewachsen war, litt das Gemeindespital wieder an Platzmangel. Eine Verbesserung trat erst mit dem Bau des Kinderspitals Wildermeth ein. Dessen Gründer, Sigmund Heinrich Wildermeth (1801-1883) brachte es in preussischen Diensten bis zum Rittmeister des 1. Garde-Dragoner-Regiments, nahm 1834 seinen Abschied und lebte fortan auf dem alten Familiensitz im Schlössli Pieterlen, das heute ein Altersheim beherbergt. Sigmund Heinrich Wildermeth und seine Frau Johanna Esther Schneider (1799-1873) vermachten ihr Vermögen von 477‘272 Franken der Stadt Biel, mit der Bestimmung damit ein Kinderspital zu errichten. Karl August Wildermeth fühlte sich übergangen und vernichtete und veräusserte kurzerhand die wertvolle Familienbibliothek. Das Testament legte fest, dass mit dem Bau des Spitals erst begonnen werden dürfe, wenn aus den Zinserträgen ein Kapital von 100‘000 Franken gebildet worden sei. Es war Dr. Carl Neuhaus, der das Ehepaar Wildermeth auf die Idee brachte, ihr Vermögen einem Kinderspital zur Verfügung zu stellen. Bei der Testamentseröffnung am 11. Mai 1883 war Carl Neuhaus der Willensvollstrecker. Er wurde 1884 zusammen mit Joseph Lanz, Amtsschreiber Hartmann und Pfarrer Ischer in die Verwaltungsbehörde der Stiftung «Kinderspital Wildermeth» gewählt. Von 1874 bis 1890 befand sich im Haus Lanz an der Schmiedengasse 10 die Ersparniskasse Biel, die das Kinderspital finanziell unterstützte. Dort ist heute noch das von einem Schlosser von Delsberg hergestellte schmiedeeiserne Gitter, welches das Portal vom Torabschluss der Klosterkirche Bellelay bildete und von Meier Sigmund Wildermeth für ein Trinkgeld erworben wurde. Es sollte ursprünglich im Wildermethspital aufgestellt werden.
Verschiedene Umstände führten dazu, dass sich der Bau des Kinderspitals um 20 Jahre verzögerte. Carl Neuhaus, der auch die Leitung übernehmen sollte, starb bevor das Kinderspitals am östlichen Berghang über der Stadt errichtet werden konnte. Es bestand aus den vier Gebäuden Krankenpavillon, Verwaltungsgebäude, Absonderungshaus und Waschhaus. Am 12. Oktober 1903 konnte es eröffnet werden. [115] Aufgenommen wurden Kinder bis 15 Jahren. In erster Linie wurden arme Bedürftige berücksichtigt, die in den ersten Jahren kein Kostgeld zahlten. Aber auch Kinder wohlhabender Eltern wurden gegen Zahlung eines Kostgelds aufgenommen. Jährlich fanden um die 500 Kinder Aufnahme. Später wurde das Kinderspital mehrfach erweitert und umgebaut.
Abschied als Spitalarzt
Auf Neujahr 1907 zog Lanz sich aus der Spitalkommission vom Pasquart zurück. Sein letzter Besuch im Gemeindespital war der Tag, an dem er Oberschwester Elisabeth Zürcher zu ihrem 40jährigen Dienstjubiläum gratulierte. Sie starb ein Jahr später im Alter von 66 Jahren.
Konservator des Museums Schwab (NMB)
Die Stiftung des Pfahlbauforschers Friedrich Schwab ermöglichte in Biel den Bau eines Museums. Die Schenkungsurkunde vom 4. November 1865 wurde von Joseph Lanz mitunterzeichnet. Als Mitglied und
Konservator des Museums Schwab betreute Lanz die Pfahlbausammlung. Später amtete er als Museums-Präsident und trat 1906 zurück.
Vielseitig Beschäftigt
Neben seiner ärztlichen Tätigkeit übernahm Joseph Lanz Ämter in der Gemeinde und engagierte sich an gemeinnützigen Werken. Als Musikliebhaber und Sänger gründete er
1847 den gemischten Chor «Concordia», dessen Präsident er war. Er war 1848 Mitbegründer des Bieler Stadtturnvereins und der Ersparniskasse Biel sowie 1876 der Anstalt Bethesda in Tschugg, die
Epileptiker betreute. [7] Von 1863 bis 1874 war Lanz Gemeinderat. 1874 beschäftigte er sich in seinem Bericht «Der Wasserreichthum der öffentlichen und Privatbrunnen der Gemeinde Biel» mit einem
Beitrag zur Lösung der Wasserversorgung der Stadt Biel. Die Römerquelle lieferte wegen der 54 privaten und 52 öffentlichen Brunnen zu wenig Wasser.
Joseph Lanz war ausserdem Mitglied der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft, Mitglied des reformierten Kirchgemeinderates, Präsident der Kirchenbaukommission, Mitglied und Präsident der
Primarschulkommission (1849 bis 1865), Mitglied der Brandkommission der Feuerwehr, Mitglied der Schulkommission des Progymnasiums, Mitglied der Baukommission des Mädchenschulhauses,
Mitglied des protestantisch-kirchlichen Hilfsvereins des Kantons Bern, Mitglied und langjähriger Präsident des freiwilligen Einwohner-Armenvereins (1850 bis 1898). [7] Dr. Joseph Lanz starb in
Biel am 22. 1. 1908 im Alter von 90 Jahren als ältester Bürger der Stadt Biel. Das Spital erinnerte an ihn mit einer 1910 an einer Wand des Vestibüls angebrachten Marmorplatte mit entsprechender
Inschrift, da Lanz 37 Jahre lang Direktor dieser Einrichtung war. Das Spital wurde später in den Vogelsang verlegt.
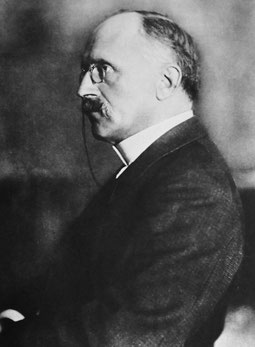
Emil Lanz-Bloesch (1851-1926), Spitalarzt, Sänger,
Mitglied der Studentenverbindung «Zofingia»
Schüler am Progymnasium Biel
Friedrich Emil Lanz, Sohn von Joseph Lanz, kam am 24. Juli 1851 in Biel zur Welt. Zusammen mit seiner jüngeren Schwester, der späteren Frau Haller, verbrachte er
seine Kindheit an der Schmiedengasse 10. Nach dem Tod seiner Mutter Sophia 1858 kümmerte sich seine Grossmutter Heilmann um ihn.
Nach dem Besuch des Progymnasiums in Biel kam er in die Kantonsschule Bern. Nach der Matura am Obergymnasium begann er 1870 das Medizinstudium an der Berner Hochschule. Dort entdeckte er sein
musikalisches Talent und trat der Studentenverbindung «Zofingia» bei. Den Zofingern blieb er zeitlebens treu. 1874 erhielt er das medizinische Staatsexamen.[24] Längere Studienreisen führten ihn nach Berlin, Paris, Wien und Prag. Durch praktische Fachkurse vertiefte er seine Ausbildung. Ab 1876 war Emil Lanz Assistent bei
Professor Peter Müller am neu eröffneten kantonalen Frauenspital in Bern und arbeitete als Geburtshelfer. 1878 liess er sich im elterlichen Haus an der Schmiedengasse 10 als praktizierender Arzt
und Geburtshelfer nieder.[24]
1883 heiratete er Dr. Marie Julie Laura Bloesch (1883-1950), die Enkelin des Landammanns Bloesch, welche in der Schmiedengasse 10 geboren wurde. Ihre Kinder waren Margrit (Säuglingsfürsorgerin),
Emily (Handarbeitslehrerin), Eduard (Architekt) und Willy (Arzt). In der Schmiedengasse waren Emil Lanz und seine Frau Laura jahrzehntelang als Ärzteehepaar stadtbekannt.[24]
1896 erhielt Emil Lanz an der Schweizerischen Landesausstellung den Ehrenpreis in der Kategorie «Hygiene, Chirurgie und Medizin».
33 Jahre Bieler Chefarzt für Innere Medizin
Als 1893 der Spitalarzt Dr. Neuhaus starb, wurde Emil Lanz während 33 Jahren Chefarzt der Inneren Medizin. Verfügte er nicht über die benötigen Hilfsmittel, stellte
er sie kurzerhand selbst her. So liess er sich am 7. 11. 1893 einen neuen «Säug-Apparat» patentieren. Das Spital platzte wieder einmal aus allen Nähten und brauchte eine Vergrösserung. Dringend
benötig wurde eine neue Heizung, ein neuer Operationssaal und Elektrizität für Licht, Waschhaus und den Röntgen-Apparat. 1901 erhielt das Hinterhaus eine Warmwasserheizung. Am 23. Februar 1902
brach auf dem Dachboden des Hauptgebäudes ein Feuer aus. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern. Danach musste ein neuer Dachstuhl erstellt werden, der mit Dienstwohnungen ausgestattet
wurde.[117] 1902 konnte im Hauptgebäude die Warmwasserheizung installiert und die Kanalisation des Spitalgebäudes an die städtischen Kanalisationsanlage
angeschlossen werden. Auf Initiative seines Vaters gründete Emil Lanz die Poliklinik, in der einkommensschwache Personen unentgeltliche Sprechstunden erhielten.
Irène Dietschi in Liber Hospitalis, Bieler Spitalgeschichte 1415-2015: «Um die Tuberkulose einzudämmen studierte Emil Lanz intensiv die Fachliteratur und arbeitete sich in die Bakteriologie ein.
Im Pasquart erwies sich die Seuchenbekämpfung als schwierig: Patienten mit Tuberkulose oder anderen ansteckenden Krankheiten mussten mit den übrigen Patienten in einem Zimmer liegen. Im
Jahresbericht 1902 schrieb er: ‹Die humanen Aufnahmebedingungen mit gutem Gewissen zu erfüllen, ist bei den jetzigen Raumverhältnissen ein Ding des Unmöglichen. Wir heissen unsere Stadtväter zum
Augenschein willkommen. Sie dürfen bekehrt werden, wenn sie Blutarme neben Tuberkulösen, Augenkranke neben Hautkranken, Eiternde neben aseptisch Operierten, Wöchnerinnen neben Alkoholdeliranten
(Trunksüchtigen) antreffen.› »[105] 1904 konnte zumindest eine Liegehalle für Tuberkulose geschaffen werden, womit Biel über die erste
Tuberkulosestation im Kanton Bern verfügte.[112] Für Emil Lanz stand aber schon früh fest, dass das Spital Biel ein separates Tuberkulose- und
Absonderungshaus brauchte.[105]
Stadtpräsident Stauffer bestätigte an der Stadtratssitzung vom 23. August 1904, dass die Kranken des Spitals vorübergehend im Gang untergebracht werden mussten. Für dringende Umbauten im
Gemeindespital wurde nun ein Kredit von 13‘200 Franken bewilligt. Der Gemeinderat hoffte auch auf die Veranstaltung eines grösseren Basars, um die Mittel für die Spitalerweiterung zu
beschaffen.[113] Mittlerweile fand der Basar unter Emil Lanz’ Frau Laura (1863-1950) in der Tonhalle statt. Dort war der Anlass mit einem aufwändigen
Unterhaltungsprogramm verbunden. 1905 zum Beispiel mit Stadtorchester, Chinesischer Hofballquadrille, Damentanzgruppe und Damenturnverein. Den Abschluss bildete die Inszenierung «Frühlings
Erwachen», zu der Progymnasiallehrer Arnold Heimann (1856-1916) den Text beigesteuert hatte, der von einer Schülerin der Mädchensekundarschule gefühlvoll vorgetragen wurde. Der Basar brachte 5630
Franken ein. Davon waren 230 Franken für das Asyl und rund 5000 Franken für die Installation der Operationssäle bestimmt. Im Sommer 1905 konnten die neuen Operationssäle bezogen werden. Ende 1905
erhielt das Spital als Legat von Ingenieur Alfred Neuhaus (1826-1905) 20‘000 Franken.[117] 1906 erbrachte der Basar einen Gewinn von 7000 Franken. Davon gingen 1320 Franken an das Kinderspital Wildermeth, der Rest an das Gemeindespital, wovon 2200 Franken für die
weitere Einrichtung des Operationssaales verwendet wurden.[105]
Emil Lanz schrieb regelmässig in den Spital-Jahresberichten. 1907 hielt er fest: «Das Spital musste 7 nicht isolierte Geisteskranke mit 311, darunter einen Kranken mit 270 Pflegetagen zu
beherbergen, was für das Personal und die übrigen Patienten eine Zumutung darstellte. Die Schwierigkeiten, Geisteskranke in die Irrenanstalt zu verlegen, sind im höchsten Grad beklagenswert.
Platzmangel und erschwerte Vorschriften waren die Ursache. Die Tuberkulosestation bedarf Verbesserung. Was nützen Liegehallen und Liegestühle wenn die Kranken aus Platzmangel wochenlang ohne
Rücksicht auf den Krankheitsverlauf (Leicht- und Schwerkrank) das gleiche Zimmer teilen. Es wundert nicht, wenn ab und zu ein Kranker dies nicht erträgt und ausreisst.» In den Spitalgärten wurde
ein reger Gemüsebau betrieben, der zur Bereicherung des Spitalmenüs beitrug. Eine Reduzierung des Weinkonsums für die am Weinbau beteiligten Patienten erwies sich als ungünstig, da bei den
Patienten regelrechte Erziehungserscheinungen auftraten. Der Weinkonsum war daher mit erheblichen Kosten verbunden. [128] 1908 führte das Spital «regelmässige Ausgehstunden für das
Pflegepersonal» ein.[129]
Vom Gemeinde- zum Bezirksspital
In der Botschaft des Stadtrats vom 19. März 1909 wurde mitgeteilt, dass der Staat Bern einen namhaften Betrag von rund Fr. 70,000 in Aussicht stelle, unter der Bedingung, dass das Bieler Spital
in ein Bezirksspital umgewandelt werde. Durch Volksabstimmung vom 18. April 1909 trat die Einwohnergemeinde Biel das städtische Spital unentgeltlich an die zu gründende Korporation ab. Am 15.
November 1909 erfolgte durch Dekret des Grossen Rates die Anerkennung des Bezirksspitals Biel als juristische Person.[130] Das Gemeindespital wurde zum
Bezirksspital der Ämter Biel, Büren, Courtelary, Erlach und Nidau und dadurch mit 80 Gemeinden verbunden. Zum Bezirksspital gehörte auch die Privatklinik Pasquart (Seevorstadt 75). Emil Lanz
arbeitete darin zusammen mit den Ärzten Schärer und Wyss. Die Klinik war spezialisiert auf «Chirurgie, Geburtshilfe, Frauenkrankheiten, innere Krankheiten und Unfälle». Mittlerweilen liessen sich
am Hauptgebäude die Winterfenster nicht mehr öffnen und die Rollläden wurden unbrauchbar. Trotz der Umwandlung zum Bezirksspital bedurfte es weiterhin der finanzielle Hilfe von Privatpersonen und
des Spitalbasars, um das Spital auf das Niveau anderer Bezirksspitäler zu bringen. Das Krankenasyl für Unheilbare wurde aufgelöst und die Patienten 1909 vom 1898 eröffneten Unheilbaren-Asyl im
Schlössli Mett übernommen. Danach diente das Haus Patienten mit chronischen und ansteckenden Krankheiten.
Das ehemalige Bezirksspital, heute Kunstmuseum (links) und die dazugehörende Poliklinik / Privatklink Pasquart (rechts).
Fotos: Postkartensammlung der Stadtbibliothek Biel.
Am 15. August 1909 wurde die Poliklinik in das Erdgeschoss und die Verwaltung in die oberen Stockwerke des neu erworbenen Verdanhauses (Seevorstadt 75) verlegt. Von
da an hatte Emil Lanz in der Poliklinik sein eigenes Untersuchungszimmer und betreute jährlich um die 2500 Besucher. Ab 1909 konnte etappenweise die Elektrizität eingeführt werden. Die
Spitalwäsche wurde nun mit einer Örtmannschen Waschmaschine gewaschen, der Operationssaal und die Krankenzimmer erhielten elektrisches Licht. Einen finanziellen Rückschlag brachte 1910 der
Zusammenbruch der Volksbank. Das Spital verlor dadurch den Basar-Erlös von 5000 Franken für den Kauf eines Röntgenapparates und vier Obligationen zu je 1000 Franken. Eine wesentliche Entlastung
des Budgets trat ein, als der Gemeinderat 1910 den Wasserzins um 50% erliess.[131] Im Januar 1911 konnte der lang gehegte Wunsch nach einem Röntgenapparat
erfüllt werden. Es war das neueste Modell der Firma Klingelfuess in Basel. Der bisher für septische Operationen benutzte Raum wurde als «Röntgenkabinett» eingerichtet. Im Verlauf des Jahres
wurden unter der Leitung von Dr. Schärer 243 Röntgenaufnahmen und Durchleuchtungen durchgeführt. Der Spitalbasar brachte 5000 Franken ein.[132] 1912 konnten
dank des Erlös des Basars die defekten Bretterfensterläden des Spitals durch Rollläden mit Auszugsvorrichtungen ersetzt und der Operationssaal mit einem neuen Sterilisationsapparat ausgestattet
werden. Am 12. Juni 1912 konnte im umgebauten Verdanhaus die «Privatklinik Pasquart» eröffnet werden. Das Spital erhielt 5000 Franken von den Vereinigten Drahtwerken und 7500 Franken vom Basar.
1913 brach im Asyl Feuer aus und der alte Riegelbau mit seinen hilflosen Insassen wurde beinahe ein Raub der Flammen. Danach beschloss die Spitalkommission, das Asyl nicht mehr als Krankenhaus zu
nutzen.[134] 1914 fehlte dem Spital noch immer eine Tuberkuloseabteilung und es litt erneut unter Platzmangel. Für einen Ausbau wurden nach und nach
finanzielle Mittel zurückgestellt, die aus Subventionen der Spitalgemeinden und den Erträgen der Spitallotterie stammten.
Während im Ersten Weltkrieg Private und Gemeinde das Spital unterstützten, tat der Staat das Gegenteil und reduzierte die Zahl der Staatsbetten von 29 auf 26. Auch bei der Kohlenversorgung half
er nicht und das Spital musste für 6000 Franken Aktien der Kohlenzentrale übernehmen. Glücklicherweise konnte das Spital mit der Hilfe von Ingenieur Hans Keller (1876-1957), Lehrer am Technikum,
Brennmaterial einsparen. Als das Spital mit Militärpatienten überfüllt wurde, weigerte sich der Staat Brot und Milch zu verbilligten Preisen abzugeben. 1916 vermachte Marie Walker dem Spital 5000
Franken und ihr Anwesen im Pasquart. In dieser Zeit der Not gelang es den Damen des Spitalbasars 7800 Franken zu sammeln. Dieser Betrag wurde zur Ergänzung des Mobiliars und der Wäsche der
Kranken verwendet.[136] 1918 waren es sogar 9000 Franken.
Da keine Erweiterungsbauten mehr möglich waren, wurde ein Neubau unumgänglich. Um das Spital zu erweitern, wurde durch Experten erstmals die Vogelsang-Besitzung in Betracht gezogen, einem
aussichtsreichen Gut in ruhiger Lage direkt über der Altstadt. Die Patienten würden fernab von Fabriken und Bahnlinien weder durch Rauch noch durch Strassenstaub belästigt. Ein
entsprechender Kaufvertrag wurde von der Spitalkommission am 7. Oktober 1918 genehmigt. Nun breitete sich in Biel eine lebensbedrohliche Grippeepidemie aus. Emil Lanz im Spital-Jahresbericht
1918: «Das mögliche Auseinanderhalten zwischen leichter und schwerer Grippe war infolge des Massenansturms unausführbar. Belegt wurden alle Plätze im Spitalgebäude, Asyl, Walkerhaus,
Privatklinik, in Korridoren und in den Sälen der chirurgischen und der Augenabteilung. Es mussten provisorische Räume in Baracken, in gemieteten Bauten oder durch die Umwandlung von Schulhäusern
in Notspitäler geschaffen werden. Die Sterblichkeitsrate im Spital war hoch, weil gerade die Schwerkranken dem Spital übergeben wurden, darunter Hoffnungslose, denen der Transport geschadet
hatte. Das Pflegepersonal wurde durch ihre Arbeit teils leicht, teils schwer krank, zwei Schwestern vielen der Grippe zum Opfer.» Wegen der Grippe verzeichnete das Spital mit 1'481 Patienten und
36'937 Pflegetagen die bisher höchste Patientenzahl. Von den 404 im Spital behandelten Grippekranken starben 92. Danach wurde die Förderung für einen Spitalneubau vorangetrieben. 1920 schrieb das
Bezirksspital einen Architekturwettbewerb aus. Der von Architekt Robert Saager verfasste Entwurf wurde mit dem 1. Preis ausgezeichnet und zur Ausführung bestimmt, die jedoch lange auf sich warten
liess. Bis 1923 war erst ein Drittel der benötigten Mittel beisammen. Als Emil Lanz 1926 starb, erlebte er den Bau des Tuberkulosepavillons nicht mehr. Dieser wurde erst 1930 als erstes
Spitalgebäude auf dem Vogelsang errichtet.
In Biel war Emil Lanz vielseitig für die Stadt tätig. Er war Mitbegründer des «Schweizer Alpenklubs Sektion Biel» und als Mitglied initiierte er zusammen mit Ernst
Schüler den Taubenlochschluchtweg. Die dazugehörige «Aktiengesellschaft zur Erstellung eines Fussweges durch die Taubenlochschlucht» wurde 1889 gegründet, Emil Lanz zum Präsident und Ernst
Schüler zum Kassierer gewählt. Dem Verwaltungsrat gehörten u.a. Oberförster Arnold Mueller an. Am April begannen die Bauarbeiten. Emil Lanz erstattete der Gesellschaft regelmässig Bericht über den Stand der Arbeiten. Dabei wurde
festgestellt, das mehr Bauten und Sicherungen benötig waren als vorgesehen, etwa 4 statt 2 Überbrückungen der Schüss und mehr Geländer, was Zusatzkosten von 4000 Franken zur Folge hatte. Am 13.
Oktober 1889 fand in Bözingen die Einweihung statt. Zur Kostendeckung wurde ein Eintrittsgeld erhoben.
Als Nachfolger seines Vaters kam Emil Lanz 1908 in die Museumskommission, wo er die prähistorische Abteilung betreute und zum Pfahlbaukenner wurde. Von 1921 bis 1926 wirkte er als deren Präsident
und sorgte für die Vergrösserung des Museums.[24] Als Konservator beteiligte sich Emil Lanz an diversen Grabungen: am Grabhügel am Hausersee (Kt.
Zürich); Moordorf Riesi am Hallwylersee; in Mosseedorf (1924).
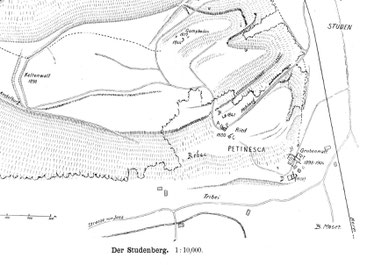
Hauptförderer der Forschungen in Petinesca
Im «Itinerarium Antonini», einem Reisebuch aus der Römerzeit, wurde Petinesca als eine Station auf der befestigten Strasse zwischen Aventicum (Avenches) und Salodurum (Solothurn) beschrieben.
1830 liess der Kanton Bern einige archäologische Nachforschungen am Jensberg durchführen, die auf die römische Niederlassung hinwiesen. Private führten in den folgenden Jahren sporadisch
Ausgrabungen in Petinesca durch. Als 1897 die Ruinen bei Studen durch verschiedene Umstände gefährdet waren, beschloss der Historische Verein von Biel, die nötigen Schritte zu deren Erhaltung
einzuleiten. Am September 1898 konnte in Studen am 220 Meter langen «Keltenwall», unter der Leitung von Emil Lanz weitere historische Funde freigelegt werden. Sie führten zur Blosslegung des
römischen Eingangstores, sowie der Strassenzufahrt und einiger das Tor umgebenen Räume. Aus dem «Historischen Verein von Biel» entstand 1900 die Gesellschaft «Pro Petinesca». Um die Finanzierung
der Ausgrabungen kümmerte sich Emil Lanz als Präsident und Dr. Albert Maag (1862-1929) als Sekretär. Maag wirkte am Progymnasium und Gymnasium Biel 42 Jahre als Lehrer der Geschichte und der klassischen Sprachen.
«Pro Petinesca» untersuchte während 10 Jahren den Keltenwall und römische Gebäude in der Grubenmatt. Emil Lanz verfasste darüber 1906 den ersten ausführlichen Bericht unter dem Titel «Petinesca.
I. Bericht über die Ausgrabungen der kelto-helvetischen und römischen Ruinen am Jensberg bei Biel von 1898 bis 1904». Die Reportage entstand nach technischen Plänen von Architekt Emanuel Jirka
Propper (1863-1933) und zeigte Pläne von Geometer B. Moser in Diessbach und Zeichnungen des Lehrers Bandi in Aarau.
Die Torturmanlage von Petinesca ist 1898 bis 1904 unter Emil Lanz durch die «Gesellschaft Pro Petinesca» ausgegraben und 1937 bis 1939 durch sein Sohn Eduard Lanz und den freiwilligen Arbeitsdienst restauriert worden.
1901 entstand unter der Mitwirkung von Emil Lanz das Buch «Das alte Biel und seine Umgebung». Als Kunstförderer gelang es ihm, die Stadtbehörde zu überzeugen, von
Paul Robert das grosses Ölgemälde «Sous bois» und den Entwurf zum Kirchenfenster «Loi et Grâce» zu kaufen. Er wurde Gründungsmitglied des Kunstvereins und war 20 Jahre in dessen Vorstand. Mit der
Förderung und der Restauration vom Zunfthaus kam der Kunstverein zu einem eigenen Heim.[24]
Emil Lanz wirkte im gemischten Chor «Concordia» als Sänger und Klavierspieler. Ab 1898 war er Mitglied der städtischen Armenkommission, als Nachfolger seines Vaters. Ferner war er Mitglied vom
freiwilligen Krankenverein Biel, im Vorstand des Bieler protestantisch-kirchlichen Hilfsvereins, Gründungsmitglied der Schweizerischen Gesellschaft für Urgeschichte (SGU) und Mitbegründer der
Bieler Sektion des Schweizer Alpenclubs.[24] In seinen letzten Jahren untersuchte er die Pfahlbauten von Nidau und die römischen Gräber von Mett. Einen
schweren Schicksalsschlag erlebte Emil Lanz durch seinen 1924 verstorbenen Sohn Willy (siehe Biografie unten). Zwei Jahre später starb Emil Lanz am 9. Februar 1926. Er vererbte am Museum Schwab
eine Truhe mit Kerbschnitzerei und zwei Wappen aus dem 16. Jahrhundert. 1929 erhielt die Stadtbibliothek 150 Bände der «Naturforschenden Gesellschaft», bestehend aus «Verhandlungen der
schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft» (1837-1914) und «Mittel der Bernischen Naturforschenden Gesellschaft» (1844 bis 1914).

Willy Lanz (1888-1924), Arzt in Bern und Montana, Mitglied der Studentenverbindung «Zofingia»
Schüler am Progymnasium und Obergymnasium Biel von 1899 bis 1908
Mitglied der «Gymnasia Biennensis» von 1905 bis 1907
William Eduard Moritz, zweiter Sohn von Emil Lanz, kam am 8. April 1888 in Biel zur Welt. Am Obergymnasium nahm er 1907 sein Diplom entgegen. Ab 1908 studierte er in
Bern, München und Berlin. Während seiner Studienzeit schloss er sich der Studentenverbindung «Zofingia» an, welche die Devise hatte «Vaterland, Freundschaft, Wissenschaft». 1913 erwarb er sich in
Bern das Ärztediplom. Willy Lanz wurde Assistenzarzt im Pathologisch-anatomischen Institut und später der chirurgischen Universitätsklinik in Bern. 1916 wurde er im Militär zum Oberleutnant der
Sanität befördert.
Seine ärztliche Karriere ging bergauf, als man ihn zum Chefarzt der Poliklinik in Bern ernannte. Die Ausbildung war noch nicht beendet, als Willy Lanz von einer schlimmen Krankheit
überrascht wurde. Als seine Kräfte nachliessen, siedelte er zur Kur nach Montana (Wallis) über. Nahezu genesen, arbeitete er als Arzt weiter. In kurzer Zeit gelang es ihm, sich auf dem Gebiet der
Lungenchirurgie einen Namen zu schaffen. Als in Deutschland die Ärzte die operative Hilfe der Lungenschwindsucht einführten, eignete er sich dieses Wissen an. Als erster Schweizerarzt wandte er
die neue Methode mit Erfolg an. Willy Lanz hatte auf verschiedenen wissenschaftlichen Gebieten beachtliches geleistet. Die Medizinische Fakultät der Universität Bern ehrte ihn 1921 mit der hohen
Auszeichnung der Hallermedaille. Am 30. Oktober 1924 starb er mit 36 Jahren an seiner langwierigen Krankheit in Heiligenschwendi, wo er zur Kur weilte.[37]
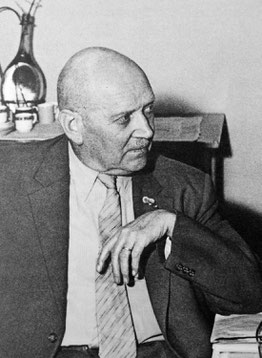
Eduard Lanz (1886-1972), Architekt, Pionier des genossenschaftlichen Wohnungsbaues, Mitglied der Studentenverbindung
«Zofingia»
Schüler am Progymnasium und Obergymnasium Biel von 1897 bis 1905
Mitglied der «Gymnasia Biennensis» von 1903 bis 1905
Eduard Paul Georg Lanz kam am 23. April 1886 an der Schmiedengasse 10 zur Welt. In dem geräumigen Haus, in dem er zusammen mit drei Geschwistern aufwuchs, waren oft Künstler und Wissenschaftler
zu Besuch. Ab 1897 besuchte Eduard Lanz das Progymnasium im Dufourschulhaus. Emil Meyer, Archivadjunkt vom Staatsarchiv Bern, war sein Klassenkamerad. Danach bereitete er sich im gleichen Gebäude am neu gegründeten humanistischen Obergymnasium
auf die Hochschule vor. 1905 schloss er seine Schulzeit mit der Maturität ab.[5]
Militärdienst
1905 trat Eduard Lanz topfit seinen Militärdienst an, so dass in der Arzt bei der Aushebung sofort für Diensttauglich erklärte. Seine Körperlänge betrug 173 cm, der Brustumfang 88 cm und der
Oberarm 26,5 cm. Lanz war ein hervorragender Schütze. 1906 besuchte er die Feldartillerie-Rekrutenschule in Bière (Kanton Waadt) und im gleichen Jahr die Artillerie-Unteroffiziersschule in Thun.
Er wurde Fahrkorporal, 1908 Leutnant und 1912 Oberleutnant der Feldartillerie. 1946 wurde er aus dem Militärdienst entlassen.[79]
Studium als Architekt
Lanz wandte sich aufgrund seiner zeichnerischen Begabung der Architektur zu und studierte von Oktober 1905 bis März 1910 am Polytechnikum in Zürich (heute ETH).[71] In den Freifächern setzte er sich u.a. mit folgenden Themen auseinander: Grundfragen der Charakterbildung, Städtebau, Schweizer Kulturgeschichte, Grundlagen der
Pädagogik, Einführung in die Philosophie, mittelalterliche Kunstdenkmäler in der Schweiz, die Kunst des 18. Jahrhunderts, Goethe. Er wurde in folgenden obligatorischen Fächern
unterrichtet:[80]
Höhere Mathematik mit Übungen
Darstellende Geometrie mit Übungen
Architekturzeichnen
Formenlehre, Skizzierübungen
Gebäudelehre I (Wohnhaus)
Gebäudelehre II (öffentliche Gebäude)
Perspektive mit Übung
Innerer Ausbau; Kostenanschläge
Stillehre mit Übungen
Construction civile
Exercices de construction civile
Mechanik I mit Übung
Baustatik mit Übung
Technologie der Baumaterialen
Eisenkonstruktionen mit Übungen
Ingenieurkunde mit Übungen
Petrographie
Architektur mit Skizzierübungen
Ornamentik und dekorativer Ausbau mit
Kompositionsübungen
Verschiedene Kompositionsübungen
Figurenzeichnen
Landschaftszeichnen
Modellieren
Kunstgeschichte
Rechtslehre
Bauhygiene
Aus Familientradition trat er in Zürich der Studentenverbindung «Zofingia» bei, befreundete sich mit den gleichaltrigen Theologiestudenten Max Gerber, Karl Barth und Max Gerwig und wurde durch sie mit den Ideen von Leonhard Ragaz (soziale Gerechtigkeit, Völkerverbrüderung) vertraut.[5] Eduard Lanz: «Als Student habe ich mich mit den politischen, religiösen und geistigen Strömungen auseinandergesetzt um die Nöte und Forderungen unserer Zeit zu verstehen.»[71] Auf Anregung von Ragaz entstand das Blatt «Aufbau», das Lanz abonnierte. Auch an den Jahresversammlungen der «Neuen religiös-sozialen Vereinigung» nahm er regelmässig teil. Daneben pflegte Lanz seine Liebe zu Griechisch, Latein und zu den alten Kulturen. In den Semesterferien leistete er seinen Militärdienst bis zum Leutnant der Artillerie ab. Von 1908 bis 1909 erfolgte ein Praktikum als Zimmermann bei der Holzfirma Kästli in Münchenbuchsee, wo er praktische Kenntnisse für seinen späteren Beruf erwarb. Ab 1909 wieder am Polytechnikum in Zürich, machte er am Juli 1910 bei Gustav Gull (1858-1942) seinen Abschluss als Architekt. Danach beteiligte sich Lanz an einem Schulhausneubau in Bern und zog 1911 um die französische Sprache zu verbessern für fünf Jahre nach Lausanne.[5] Dort leitete er für das Architekturbüro Chessex-Chamorel-Garnier den Bau des Palace-Hotels, des damals grössten Hotels der Westschweiz, sowie die Bauarbeiten vom Hotel Richemont und Beausit.[71]
Aufenthalt in Deutschland
Auslandsaufenthalte erweiterte sein Wissen: Von 1908 bis 1909 studierte er in München an der Ludwig-Maximilians-Universität.[3]
In Berlin fand er vom 1. Dezember 1916 bis zum 1. Juli 1917 eine Anstellung beim bekannten Wohnungsreformer Bruno Möhring (1863-1929), wo er sich mit Städtebauprojekten und einem
Arbeiterrestaurant und einer Beamtenkantine der Daimlerwerke in Berlin-Marienfeld befasste.[71] 1917 beteiligte er sich an einem Wettbewerb des
Alt-Zofingervereins und des Schweizerischen Zofingervereins, die für ihr 100-jähriges Stiftungsfest 1918 der Stadt Zofingen einen Zierbrunnen schenken wollten. Ursprünglich war Lanz auch als
Jurymitglied vorgesehen. Da er aber in Deutschland weilte und nicht anwesend sein konnte, trat Architekt Indermühle an seine Stelle. 103 Entwürfe wurden von allen Teilnehmern eingereicht. Den
Zuschlag erhielt schliesslich der Entwurf des Bildhauers Julius Schwyzer.[55]
Vom 1. Januar bis 15. Dezember 1918 war Eduard Lanz an der Akademie der Künste von Berlin Meisterschüler von German Bestelmeyer (1874-1942). Lanz beteiligte sich an der Ausführung der Messelschen
Museumsbauten, dem deutschen Freundschaftshaus in Konstantinopel und Kirchenbauten. Gleichzeitig studierte er an der Technischen Hochschule Berlin. Die Arbeit wurde mehrmals durch den
Militärdienst in der Schweiz unterbrochen.[71] Als unmittelbarer Zeuge der Novemberrevolution 1918 begeisterte sich Lanz für sozialistische Ideen und trat
der Sozialdemokratische Partei Deutschlands bei. Zeitweise war er auch im städtischen Wohnungsamt in Berlin tätig. Im Städtebau gewann damals die Gartenstadtbewegung an Bedeutung und der
Kleinwohnungsbau wurde zum Thema. 1918 beteiligte sich der inspirierte Eduard Lanz von Deutschland aus am «Ideenwettbewerb zur Erlangung eines Bebauungsplanes für die Stadt Biel und ihre Vororte»
mit seinem Entwurf «Rot und Schwarz».[2]

Pläne für ein Gemeindehaus
1918 gab es die uns heute bekannten Gemeindehäuser noch nicht. Die Sitzungen fanden in einer von Alkohol geprägten Atmosphäre in den «Gemeindestuben» der Wirtshäuser statt. Im Kanton Bern drängte
sich der Gedanke auf, diesen Lokalen eine alkoholfreie Gemeindestube oder ein alkoholfreies Gemeindehaus gegenüber zu stellen. Die «Kommission für Wirtshausreform der Schweizerischen
Gemeinnützigen Gesellschaft» und der «Schweizerische Verband gemeinnütziger Vereine für alkoholfreie Wirtschaften» veranstalteten einen Wettbewerb unter schweizerischen Architekten, um Entwürfe
für Gemeindestuben und Gemeindehäuser zu erhalten. Den Architekten war es freigestellt, das Lokal als Einbau in ein bestehendes Gebäude zu integrieren oder einen Neubau zu entwerfen. Das Projekt
verlangte, dass sich der Bau am Stil des Ortes orientiert und sich somit der Umgebung anpasst. 149 Vorschläge wurden von124 Verfassern eingereicht. Darunter befand sich auch die Projektskizze
«Bärnbiet» von Eduard Lanz, der in dieser Zeit bei Glöcke an der Technischen Hochschule Charlottenburg Städtebau studierte. Lanz stellte sich das Gemeindehaus als gemütliches Berner Wirtshaus
vor. Er gewann zwar nicht, erhielt aber eine Ehrenmeldung.[91]

Zurück in der Schweiz
1919 kehrte Lanz in die Schweiz zurück und
wohnte zuerst in Binningen. Dann zog er aus beruflichen Gründen nach Basel. Er hatte dort seit 1919 eine Anstellung als bauleitender Architekt im Hochbaubüro der Kreisdirektion II der SBB
und betreute die Bahnbauten in Solothurn und Biel. Bis 1924 war er Vorstandsmitglied und Archivar der Eisenbahner Baugenossenschaft Basel (E. B. G.). 1921 befand er sich für 6 Wochen auf einer
Studienreise in Rom und Sizilien. In diesem Jahr heiratete er Dora Paula Grütter (1889-1982) aus Burgdorf. Aus dieser Ehe gingen die drei Kinder Verena, Annemarie und Ulrich hervor.[1] Ulrich Lanz-Steinegger liess sich am Bürgerspital Basel zum Facharzt für Innere Medizin ausbilden und starb 1959 mit 35 Jahren an einer schweren Krankheit.
Altstadtleist-Vorstandsmitglied Annemarie Geissbühler-Lanz (1927-2023) war Sekundarlehrerin und Präsidentin der Regionalgruppe Biel-Seeland des Berner Heimatschutzes.
Als Leiter für die SBB-Bahnbauten zuständig, plante und errichtete Eduard Lanz von 1919 bis 1923 in Biel das Lokomotivdepot mit 24 Gleisen und einer
Reparaturwerkstatt. Ab 1. April 1922 befand er sich für diese Arbeit nur noch in Biel.[72] Es wurde ihm deshalb eine Wohnung im
Eisenbahnersiedlungsquartier Hofmatten in Nidau zugewiesen. Am Wolfweg 2 verbrachte er mit seiner Familie zwölf glückliche Jahre. Lanz, der in Nidau in die Sozialdemokratische Partei eingetreten
war, besuchte des öfter seinen Nachbar und Parteigenossen Guido Müller, der im gleichen Quartier am Rennweg 5 wohnte. Hauptsächlich unterhielten sie sich darüber, wie man den genossenschaftlichen
Wohnungsbau fördern könnte. 1924 gab er seine Stelle bei der SBB auf und eröffnete im ersten Stock seines Elternhauses ein eigenes Architekturbüro.[5]
Eduard Lanz, der sich in seiner Freizeit oft im Jura aufhielt, baute 1924 in Les Près d’Orvin ein Chalet für den Touristenverein Naturfreunde Sektion Biel. Es befindet sich in unmittelbarer Nähe des Skilifts. Zur Wasserversorgung wurde das Haus mit einer Zisterne ausgestattet. 1935 erfolgte von Eduard Lanz ein Umbau und Ausbau. 1954 erstellte er eine neue Toilettenanlage.
Das Haus der Naturfeunde Sektion Biel in Les Près d’Orvin. Foto links von Heinz
Strobel.
Wenig Platz für Grossfamilien
Eduard Lanz: «Unter den Schweizer Städten hat Biel seit 1850 (seit der Entwicklung zum Industriestandort) das relativ grösste Bevölkerungswachstum zu verzeichnen.
Die Wohnbautätigkeit war zur Hauptsache ungeregelter Spekulationsbau in den Aussenquartieren.»[95] Wohnknappheit entstand aber auch durch die Erstellung des
zweiten Bahnhofs, wo zahlreiche Wohnungen ohne Aussicht auf Ersatz abgerissen wurden. Die ersten, die der Wohnungsnot durch Selbsthilfe entgegenschritten, war die am 29. April 1910 gegründete
Eisenbahnerbaugenossenschaft Biel (EGB). Ihr erfolgreiches Vorgehen wurde richtungsweisend. Sie erstelle nach dem Vorbild deutscher und englischer Gartenstädte von 1911 bis 1914 auf den
Hofmatten in Nidau 72 Wohnungen mit grosszügigen Gärten. Zwischen 1908 und 1913 stiegen die Wohnungspreise in Biel infolge von Spekulationen um 15 bis 40 Prozent. Der Ruf nach kommunalem
Wohnungsbau wurden immer lauter. Der Erste Weltkrieg verschärfte die Wohnungsnot von 1914 bis 1918. Dies führte zur Gründung von Wohn- und Baugenossenschaften, sowie zum kommunalen Wohnungsbau.
1914/17 förderte die Gemeinde den Wohnungsbau mit einem Mietkasernenblock. 1919 trafen sich in Biel die Vertreter aller politischen Parteien, um zur Linderung der Wohnungsnot den Bau von
Kleinwohnungen zu fördern. In den 1920er Jahren lebten 20 % aller 5 bis 7-köpfigen Familien in Zweizimmerwohnungen. Auch in den Schulzimmern des Dufourschulhauses waren obdachlose Familien
untergebracht, bis die Gemeinde 1921 am Rennweg in Mett eine Baracke für 5 Familien errichten liess. Als die SP 1921 die Mehrheit im Bieler Gemeinderat erlangte, war ihre wichtigste Aufgabe die
Bekämpfung der Wohnungsnot. Die finanziellen Mittel waren jedoch aufgrund der Überschuldung zu gering. Obwohl das Stadtbauamt immer wieder mit Projekten für Klein- und Notwohnungen beauftragt
wurde, lag die Realisierung der meisten Siedlungen in den Händen von Genossenschaften mit ihren privaten Architekten.[17]
Eduard Lanz: «Die Wohnungsnot traf die wirtschaftlich Schwachen und Schwächsten immer mehr. Waren schon Wohnungen für minderbemittelte Kreise schwer erhältlich, so
wurde dieser Mangel für kinderreiche Familien zur Kalamität. Die Wohnungsnot unbemittelter kinderreicher Familien ist umso gravierender, als sie zu völlig unhaltbaren Wohnverhältnissen führt. Sie
hat die Verwahrlosung zahlreicher Kinder zur Folge. Anstatt die Belegung der baufälligen und gesundheitsschädlichen Wohnungen zu vermindern, werden diese erst recht belegt. 1926 bildete sich
deshalb in Biel ein Initiativkomitee, das der Gemeinde den Bau von Wohnungen auf genossenschaftlicher Grundlage mit Subventionierung durch die Gemeinde empfahl. Diese Basis ermöglicht für die
bedürftigsten Familien echte Heime zu schaffen, die Leute anzusiedeln statt zu kasernieren, ihnen nicht nur eine vorübergehenden Unterkunft, sondern wirkliches Wohnen zu geben, ohne das ein
echtes Familienleben keine Wurzel fassen kann. Es geht also keineswegs darum, Armenviertel oder Notwohnungen entstehen zu lassen.»[95]
Die Organisation des gemeinnützigen Wohnungsbaues
Am 20. September 1919 gründete Eduard Lanz in Olten den «Schweizerischen Verband zur Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaues» (SVW) mit. Er wurde 1926 in
«Schweizerischer Verband für Wohnungswesen und Wohnungsreform» und ab 1941 in «Schweizerischer Verband für Wohnungswesen» umbenannt. Der französische Name blieb unverändert mit «Union Suisse pour
l'Amelioration du Logement».
Der Verband bezweckte, die Wohnungsnot in den Griff zu bekommen und der Bevölkerung gesunde und befriedigende Wohnverhältnisse zu verschaffen. Dazu dienten folgende
Mittel: Ausarbeitung zweckmässiger Organisationsformen (Normalstatuten, Reglemente usw.); Beratung von Initianten für die Gründung von Baugenossenschaften; Veranstaltung von Vorträgen und
öffentlichen Besprechungen über Siedlungs-, Bau- und Wohnfragen; Wanderausstellungen und dergleichen; Beratung und Mithilfe bei der Finanzierung von Unternehmungen auf dem Gebiete des
gemeinnützigen Wohnungsbaus; Bauberatung, Prüfung und Begutachtung von Bebauungsplänen, Bautypen, Baumethoden, Baunormen, Wohnungseinrichtungen, Gartenanlagen usw.; Durchführen von Wettbewerben;
Einflussnahme auf die Gesetzgebung, insbesondere auf die Bau-, Strassen- und Hypothekargesetzgebung, durch Ausarbeitung von Gutachten und Voranschlägen für Abänderungen und Verbesserungen
zuhanden der zuständigen Behörden; grundsätzliches Eintreten für eine soziale Bodenpolitik; Bekämpfung der Bodenspekulation und aller unlauteren Bestrebungen auf dem Gebiete des Wohnungswesens;
Herausgabe einer periodisch erscheinenden Zeitschrift.[147]
Als Sitz des Verbands wählte man Zürich, Präsident war der Zürcher Stadtrat Dr. Klöti. Der Vorstand bestand aus 28 Personen aus 17 verschiedenen Kantonen, Lanz
gehörte ihm nicht an. Am 12. Oktober 1919 organisierte der Verband im Gewerbemuseum Winterthur eine Ausstellung mit Plänen für Wohnungskolonien. 1920 erschien die Broschüre «Die Bekämpfung der
Wohnungsnot» und die Gründung der Zeitschrift «Der gemeinnützige Wohnungsbau» (ab 1928 «Wohnen»), in der Eduard Lanz mehrere Artikel verfasste. 1921 wurde die Musterhausaktion ins Leben gerufen,
um vom bisherigen System der Mietskasernen zu einer besseren Wohnform, dem erschwinglichen Eigenheim in Form des Kleinhauses überzugehen. 1926/27 fand in 20 Ortschaften eine Wanderausstellung
statt, die 33 entstandene Kleinhaussiedlungen aus der Nachkriegszeit zeigte.[148] 1926 wurde Lanz Mitglied der Sektion Bern, im Zentralvorstand amtete er als
Sekretär und Präsident (ab 1940) und war jahrelang Mitglied der Technischen Kommission.
Die Bevölkerung sensibilisieren
Am Dezember 1926 gelangte in Biel die Vorlage zur Beteiligung der Gemeinde am Bau von Wohnungen für kinderreiche Familien zur Abstimmung. Um die Bieler über die Notwendigkeit der Erstellung
dieser Wohnungen zu informieren, veranstaltete der Mieterschutzverein von Biel und Umgebung im grossen Rathaussaal eine öffentliche Versammlung mit Lichtbildervortrag. Die Referenten waren Eduard
Lanz und Stadtpräsident Guido Müller.[149]
Ausstellung «Stadtentwicklung und Kleinwohnungen»
1927 organisierte Eduard Lanz zusammen mit Stadtgeometer Jean-Felix Villars (1876-1973) und Redaktor Werner Bourquin (1891-1971) für die Stadt in der
Logengasseturnhalle die Ausstellung «Stadtentwicklung und Kleinwohnungen». Sie zeigte die aus dem Wettbewerb von 1918 hervorgegangenen Studien und Vorschläge für einen neuen Bebauungs- und
Alignementsplan. Mit dieser Ausstellung wurden in Biel die Weichen für einen im weitesten Sinne sozialeren Städtebau gestellt.[39] Eduard Lanz: «Die
Ausstellung bestand aus 4 Abteilungen:
1) Vergangene Stadtentwicklung mit alten Landkarten der Gegend, Stadtplänen und alten Ansichten der Stadt Biel.
2) Vorschläge für die zukünftige Stadtentwicklung mit der von der Abteilung für Stadterweiterung erarbeiteten
Bebauungsplanvorlage mit statistischen Unterlagen der Stadt Biel.
3) Stadtentwicklung und Wohnungsbau der Stadt Biel mit Vergleichsmaterial und statistischen Aufstellungen.
4) Das Kleinhaus mit dem Material der Kleinhaus-Wanderausstellung des Schweizerischen Verbandes für Wohnwesen und Wohnungsreform, ergänzt durch Siedlungen der Stadt Biel. Statistische
Aufstellungen.»
Der 4. Punkt lenkte die Aufmerksamkeit der Besucher auf das neue Kleinhausprojekt der Allgemeinen Bau- und Wohngenossenschaft unter der Leitung von Lanz. Im Katalog
zur Ausstellung schrieb Eduard Lanz: «Für weniger bemitteltere Kreise mit Kindern sollte die siedlungsmässige Wohnweise im Flachbau mit Gartenland angestrebt werden mit Beteiligung und
Verantwortung der Wohnungsinhaber auf der Basis der Genossenschaft oder im Eigenheim. So wird es gelingen, auch diesen Bevölkerungsschichten eine engere Heimat zu schaffen. Man sollte nicht nur
Häuser und Strassen bauen und alles andere dem lieben Gott, der Polizei, der Armenbehörde und der freien Vereinstätigkeiten überlassen.»[17] Guido Müller,
Stadtpräsident von 1921 bis 1947: «Die von Lanz betreute Ausstellung übte eine starke Anziehungskraft auf die Bevölkerung aus und regte zum Bau von Kleinhäusern in geschlossenen Siedlungen an.
Ausser der einheitlichen Überbauung hatte das den Vorteil einer von Anfang an gut ausgenützten Strassen- und Kanalisationsanlage.»[45]
Pionierarbeit mit 275 Genossenschaftswohnungen
Eduard Lanz war bestrebt, mit seiner Arbeit einen ökonomischen und sozialen Fortschritt zu erreichen. Aufgrund seiner religiös-sozialen Überzeugung heraus förderte er den genossenschaftlichen Wohnungsbau, der für Jahrzehnte zu einer seiner Hauptaufgabe wurde. Dabei orientierte er sich an der deutschen Gartenstadtbewegung und der Idee des funktionalen Neuen Bauens. Die Siedlungen baute Lanz vorwiegend am Stadtrand.[10] Bauhistoriker Sylvain Malfroy: «Die platzsparende Reihenbauweise ermöglichten es den Arbeiterfamilien, in angenehmen, sonnigen Verhältnissen zu wohnen. Die Gärten sollten nicht nur das Gefühl des Wohnens im Grünen vermitteln, sondern dank des Anbaus von Gemüse zur Selbstversorgung beitragen.»[12] Die Wohnkolonien von Eduard Lanz reduzierten in Biel die Wohnungsnot und trugen gleichzeitig zum sozialen Aufstieg der Stadt bei. Später taten es ihm andere Architekten gleich.

Siedlung Rennweg-Mett (1925)
Rennweg 68-82*
Eduard Lanz baute seine ersten 32 Genossenschaftswohnungen für die Eisenbahnergenossenschaft im Mettfeld. Das von der Einwohnergemeinde
Biel unterstützte Projekt umfasst 8 Häuser in 2 Blöcken zu je 4 Häusern mit 2x2 Dreizimmerwohnungen. Am 1. November 1925 konnten die Häuser bezogen werden. Die Mietpreise betrugen
durchschnittlich Fr. 80.- für 3 Zimmer mit Mansarde. Bei den Grabarbeiten 1925 wurde eine Ruhestätte von ca. 12 Gräbern römischen Ursprungs entdeckt. Eduard Lanz’s Vater Emil Lanz,
Direktionspräsident des Museums Schwab und Konservator, liess die Fundstelle systematisch ausgraben und untersuchen. Unter seiner Leitung wurden 9 nahezu unversehrte Skelette geborgen. Man fand
Scherben von römischen Tongefässen, aus denen eine Vase rekonstruiert werden konnte.[34]

Siedlung Falbringen (1926-1931)
1. Etappe: 1926/27, Sonnhalde 2-16
2. Etappe: 1930/31, Sonnhalde 1-3, 15-17*
Der Vorsteher der Vormundschaftsbehörde, Emil Gräppi (1895-1967), gründete am 5. Mai 1925 mit 29 Stadtangestellten die Bieler Wohnbaugenossenschaft (BIWOG). Die Genossenschaft setzte sich
zunächst die Aufgabe, das der Gemeinde gehörende Terrain am Falbringenweg zu überbauen. Die Verhandlungen mit der Gemeinde bezüglich der Verleihung eines Baurechts führten bald zum Abschluss
eines Vertrages. Die Finanzierung wurde durch das Entgegenkommen der Gemeinde und der städtischen Versicherungskasse erleichtert. Historikerin Margrit Wick-Werter: «Emil Gräppi, der selber mit
seiner Familie in der Falbringensiedlung wohnte, war während 42 Jahren Präsident der Wohnbaugenossenschaft, die später noch weitere Siedlungen erstellte. Und immer war Architekt Lanz
dabei.»[15] Die zweite Wohnsiedlung, die Architekt Lanz in zwei Etappen von 1926 bis 1931 in den Falbringen schuf, ist ein Ensemble aus 4 Reiheneinfamilienhäusern und 4
Mehrfamilienhäusern.

Rebecca Omoregie, Vizedirektorin der Wohnbaugenossenschaften Schweiz: «Auch die grosse Freifläche macht den Reiz der Siedlung aus: Die Sonnhalde ist eine grüne Oase mit Gärten und einer grossen Wiese mit Obstbäumen, Blumen- und Gemüsebeeten. Der Aussenraum hat gestalterischen und historischen Wert: Der Kinderspielplatz steht noch immer am selben Ort, wo ihn Lanz vor hundert Jahren entworfen hat, ebenso die Allee und die zentrale Wegachse, die zum Emil-Gräppi-Brunnen hinunterführt.»[10] Für den Brunnen hatte Lanz versuchsweise eine Mauer aus rotem Klinker erstellt. Er wollte den in der Schweiz weniger bekannten Ziegelstein bei den Behörden und Handwerkern bekannt machen, um ihn für den Bau des Volkshauses zu verwenden.

Siedlung Möösli (1927-1945)
1. Etappe: 1927/28, Pestalozziallee 26-48, Möösliweg 15-37
2. Etappe: 1930/31, Pestalozziallee 2-24, Möösliweg 1-13, Brüggstrasse 39-43
3. Etappe: 1944/45, Pestalozziallee 47-93, Brüggmattenweg 31-77
4. Etappe: 1944/45, Pestalozziallee 52-70, Möösliweg 39-67*
Von 1927 bis 1945 erstellte die «Allgemeine Bau- und Wohngenossenschaft» (A.B.G.) mit Lanz etappenweise den Bau einer Siedlung für kinderreiche Familien auf dem Möösliackerterrain an der Pestalozziallee. Eduard Lanz: «Die Haupterschliessungsstrasse des ganzen von der Gemeinde zu Kleinwohnungszwecken reservierten Landkomplexes erhielt am Pestalozzi-Erinnerungsjahr seinen Namen.»[53] Seine Arbeit galt als die beste Umsetzung des Siedlungsgedankens in Biel.
Eduard Lanz berichtete 1928 in der Zeitschrift Wohnen über die erste Etappe von der Siedlung Möösliacker: «Die errichtete Kleinsiedlung für 24 kinderreiche Familien
(ca. 120 Kinder) bildet eine erste selbsttätige Teilsiedlung des in 9 kleinere Komplexe eingeteilten Gemeindeareals im Halte von ca. 70.000 m2. Die Kolonie umfasst 24 Einfamilienhäuser in 4
Blöcken, Mittelhäuser zu 4 Zimmern, Endhäuser mit einem fünften Dachzimmer, Bad- und Waschküche neben der Küche, Gartenland 200-300 m2. Es wurde gewissermassen ein Minimaleinfamilienhaus für
kinderreiche Familien als möglichst preiswerter, wirtschaftlicher Wohntyp entwickelt, der den Verhältnissen der kinderreichen Familie Rechnung trägt. Voraussetzung dafür bildete:
1) Schlafmöglichkeit mit Platz für 6 Betten.
2) Geräumiges Wohnzimmer, getrennt von der Küche.
3) Kleine, arbeits- und wegsparende Küche sowie Waschküche. Die beiden Arbeitsräume der Mutter in Wohnzimmer- und Küchennähe, im selben Geschoss.
4) Günstige Bademöglichkeit und Wasch- und Putzraum.
5) Rationelle Heizmöglichkeit und Wärmehaltung.
Die Einfamilienhäuser, zu je 3 Doppelhäusern in 4 Blöcken zusammengefasst, haben 4 Zimmer, die Endhäuser haben ein fünftes Zimmer im Dach. Die Häuser umschliessen einen Hofplatz. Durch einen
Windfang-Vorraum mit Garderobe gelangt man in die geräumige Wohnstube, von der aus, durch eine Türe abgeschlossen, die Buchenholztreppe in den 1. Stock führt. Die unmittelbar an die Wohnstube
anschliessende Küche ist der ungestörte Arbeitsplatz der Mutter. Sie ist nicht grösser bemessen als nötig, um den Herd, daneben den Zimmerofen mit Kochrohr, den Schüttstein mit Putzmaterial- und
Kehrichteimerschrank, den Arbeitstisch am hochgezogenen Fenster, darunter entlüfteter Speiseschrank in der Fensternische, dann den Küchenschrank und die tischbildende Holzkiste unterzubringen.
Der Abort befindet sich neben der Küche auf dem Kellervorplatz mit Ablage für Putzgeräte usw., die aus der Küche verbannt sind. Die Waschküche liegt innerhalb des Hauses neben der Küche und ist
als Wasch-, Bade- und Putzraum für die Familie eingerichtet mit Ausgang in den Garten zum Wäscheaufhängen und Gartenausgang. Jedes der 3 Schlafzimmer im 1. Obergeschoss hat Platz für 2 Betten,
die Endhäuser haben ein fünftes Dachzimmer. Der Dachboden dient als Abstell- und Werkraum. Ein speziell konstruierter Ofen mit Einfeuerung von der Küche her, heizt Wohnstube und Küche und durch
einen Heizkanal zugleich die beiden darunterliegenden Schlafzimmer. Die Häuser sind halbunterkellert. Die Vorgärten sind durch Eisenbetonkästen abgetrennt. Das Fassadenmauerwerk besteht aus
Winkelsteinen. Die Fenstereinfassungen (3 Typen) bestehen aus ganzen Eisenbetonfensterrahmen. Die Dacheindeckung besteht aus Falzziegeln auf Schalung. Die Wohnräume erhielten Eichenriemenböden,
die Schlafräume tannene Riemen, Küche und Vorraum Steinzeugplatten oder Terrazzo. Die Doppelhäuser sind unterschiedlich gestrichen und haben als Handzeichen ein entsprechendes aufgemaltes
Monatssymbol.
Die Mieter sind unbemittelte Familien mit 4 und mehr Kindern. Sie sind Genossenschafter und beteiligen sich mit 5% des Anlagewertes ihres Hauses, den sie in monatlichen Raten einzahlen. Sie
besitzen ein in der Regel unkündbares Wohnrecht, auch bei Entwachsen der Kinder. In diesem Fall haben sie den Mehrzins zu entrichten, der den besonderen Zuwendungen der Gemeinde entspricht. Die
Realisierung dieser Teilsiedlung erfolgte durch die Allgemeine Baugenossenschaft Biel (Präsident Stadtschreiber Fürsprecher Obrecht). Der Vorstand dieser Baugenossenschaft wurde seither durch
Mieter der Siedlung ergänzt.»[53]
Das Bieler Jahrbuch 1928 beschrieb das Innere: «Die geschickte Raumaufteilung erlaubt bestmögliche Ökonomie an Installationen. Die Waschküche (zugleich Bad- und Waschraum mit Ausgang in den
Garten) ist neben der Küche gelegen, welche mit dem Wohn- und Essraum in Türenverbindung steht. Ausmass und Einrichtungen sind auf Armreichweite berechnet. Von der Küche aus erfolgt auch die
Beheizung des Hauses durch den zentralen Kachelofen mit Kochgelegenheit und Luftkanal in das obere Stockwerk.»[20]

Durch den Baustiel von Eduard Lanz kam der Bedarf nach weiteren Wohnungen für kinderreiche Familien auf. 1930/31 wurde von derselben Baugenossenschaft eine neue Bauetappe in Angriff genommen, auf der gleichen Grundlage: Die Wohnungsinhaber mussten Genossenschafter sein und sich mit 5 % des Wohnungswertes durch gestaffelte Einzahlung beteiligen. Familien mit 4 Kinder und mehr hatten Vorrang vor anderen Familien und zahlten ausserdem den verbilligten Mietzins entsprechend dem Beitrag der Gemeinde (20 %) an die Baukosten. Es entstand 16 Reihenfamilienhäuser und zwei Wohnblöcken mit je vier Wohnungen.[11] Zwei Reihen von Zweifamilienhäusern schlossen die Gruppe an der Westseite ab. Zwischen den Häusern der ersten Etappe und zweiten Etappe befand sich eine alte Kiesgrube, die von Arbeitslosen in einen Spielplatz mit Promenade umgewandelt wurde. Von 1944 bis 1945 baute die «Siedlungsgenossenschaft im Möösli» nach den Plänen von Eduard Lanz weitere 48 Reihenfamilienhäuser in der 3. Etappe und weitere 25 in der 4. Etappe. Schwester Margrit Lanz betreute die Mösliacker-Kolonie als Säuglingsfürsorgerin.
Von links nach rechts: Die Wohnkolonie Möösli um 1940. (Foto: Bildarchiv ETH-Bibliothek Zürich, Stiftung Luftbild Schweiz. Fotograf: Swissair Photo AG, CC BY-SA 4.0), Möösli I und Möösli II

Wohnkolonie Champagne (1929-31)
Schwalbenstrasse 10-24, Im Grund 9-23, 10-24, Champagneallee 7-21*
Die für die «Baugenossenschaft des Gemeindepersonals» (BIWOG) erstellte Wohnsiedlung besteht aus 8 Blöcken von 4 Reiheneinfamilienhäusern. Zu jedem Haus gehört ein 180 Quadratmeter
grosser Garten. Lanz versah die Wohnungen jeweils mit 4 Zimmer, Küche, Keller, Waschküche, Werkraum, Estrich und Zentralheizung.[21]

EGB Genossenschaftssiedlung Nidau-Hofmatten Süd (1929)
1929, Genossenschaftstrasse 2-16, 20-26, Möwenweg 2-24, Barbenweg 2-8*
Die nach Plänen von Eduard Lanz erbaute 4. Etappe der Wohnkolonie der «Eisenbahnerbaugenossenschaft Hofmatten» in Nidau konnte 1929 bezogen werden. Sie bestand aus 28 Einfamilienhäusern (8
Wohnblocks von 20 Wohnungen à 5 Zimmern). Gilbert Bongard erwähnt in den Nidauer Chlouserbletter: «Die neuen Wohnungen kamen für die künftigen Mieter teurer zu stehen als ursprünglich angenommen.
Einfachere Bahnangestellte konnten sich einen Hausteil nicht mehr leisten. So wurden die Wohnungen während der folgenden Krisenjahre auch an Angehörige anderer Berufsgruppen vermietet:
Buchhalter, Bank- und Postbeamte, Prokuristen und andere. Anfangs der 30er Jahre wohnten von den fünf in Nidau tätigen Sekundarlehrern deren vier im Hofmattenquartier. Lanz erstellte mitten in
der Wohnkolonie an der Hofmattenstrasse 18 ein winkelförmiges Genossenschaftshaus. In diesem Mehrzweckbau waren neben drei Wohnungen ein Versammlungsraum, ein Sitzungszimmer sowie ein ehemaliger
Laden und eine Telefonkabine untergebracht. Im grossen Saal wurden nicht nur Genossenschaftsversammlungen abgehalten. Bildungsinteressierte Genossenschafter/innen organisierten regelmässig
kulturelle Veranstaltungen. Eduard Lanz hielt Vorträge über Kunst und Architektur. Das Hofmattenquartier galt damals innerhalb der Gemeinde als sozialdemokratische Hochburg. Anfangs der 40 Jahre
war die Wohnungsnot derart erdrückend, das junge, wohnungslose Paare ihre Möbel im Versammlungsraum deponieren durften. In den Jahren 1974/75 beherbergte das Gebäude einen der Kindergärten
Nidaus. Die Baumreihe, welche die Genossenschaftstrasse durchzieht, wurde ebenfalls von Lanz angelegt.»[103]
Impressionen der Bauetappe Lanz am «Rundgang Hofmattenquartier», 27. 4. 2024. Mit Gilbert Woern («Mitglied Redaktionskommission Buch Eduard Lanz - Bieler Architekt des sozialen Bauens» und Nora Molari (Mitbegründerin des Architekturbüros Molari Soffer Architektur).
Wohnhäuser mit grosszügiger Gartenanlage und Genossenschaftshaus (unteres Bild rechts). Bilder anklicken zum vergrössern.

Genossenschaftssiedlung Dählenweg/Waldeggweg (1930/31)
1930/31: Meisenweg 11, Dählenweg 23-39, 18-36, Waldeggweg 6-16*
Für die BIWOG erstellte Lanz im Lindenquartier am Dählenweg 24 Häuser, bestehend aus 18 Vierzimmerwohnungen und 6 Fünfzimmerwohnungen.
Notwohnungs-Musterhaus (1943)
Büttenbergstrasse
1943 herrschte in Biel erneut grosse Wohnungsnot. Der Gemeinderat richtete im Dachgeschoss vom Dufourschulhaus notdürftig 10 Zweizimmerwohnungen ein und wollte für weitere Familien
Notwohnhäuser aus Holz erstellen. Dazu brauchte es ein Musterhaus. So fertigte Eduard Lanz ein Doppelhaus aus Holz für je eine Familie berechnet, das besonders durch seine zweckmässige gute
Anordnung der Innenräume auffiel (drei Zimmer, Küche Waschküche, Schopf und Kellerraum) mit zirka 400 Quadratmetern Umschwung. Das Haus kostete nach Abzug der Subvention nur 15‘000 Franken. Bis
1947 baute der Architekt in Biel 275 Genossenschaftswohnungen.
*Adressen: Sylvain Malfroy, Des alvéoles d’intimité dans un environnement communautaire, Bieler Jahrbuch, Biel 1995, S. 54
Lebenswerte Wohnungen auch für Landarbeiter
Am 23. Mai 1942 referierte Eduard Lanz als Präsident der Sektion Bern des Schweizerischen Verbandes für Wohnungswesen und Wohnreform in Langenthal über das
Wohnungsproblem der landwirtschaftlichen Dienstboten und Arbeiter. Dieses Thema interessierte auch die ökonomische und gemeinnützige Gesellschaft des Kantons Bern. Sie luden ihn am 8. September
1942 nach Bern an die Sitzung der Kantonalen Kommission für Gemeinnützigkeit ein, wo er erneut über die «Wohnungsfrage zu Stadt und Land» referierte.[77]
Eduard Lanz: «Die Abwanderung von Arbeitskräften vom Land, die aus Mangel an Wohnraum erfolgt, steht die Überbevölkerung und einem durch die Kriegsverhältnisse beeinträchtigten städtischen
Wohnungsmarkt gegenüber. Innerhalb von 42 Jahren wuchs die Schweiz um 1.500.000 Personen, während die landwirtschaftliche Bevölkerung um ca. 210.000 Personen abnahm. Untersuchungen zeigen, dass
die Wohnungsbeschaffung für verheiratete Angestellte (Knechte) am dringendsten ist. An zweiter Stelle stehen die verheirateten landwirtschaftlichen Arbeiter und Taglöhner, die zeitweise auf dem
einen oder anderen Betrieb arbeiten. Die ledigen Knechte und Angestellte sind vielfach angewiesen auf unbeheizte Gaden irgendwo im Obergeschoss des Wohnstockes oder anderswo auf dem Hof. Die
Bauernknechtsfamilien sind noch viel schlechter dran. Eine richtige Wohnung steht ihnen auf dem Hof selten zur Verfügung. Die landwirtschaftlichen Arbeiter, Handlanger, Taglöhner/Innen wohnen oft
im Dorf in alten abgewirtschafteten Häusern oder Gaden. Es ist unsere Pflicht, die Wohnungsfrage der landwirtschaftlichen Angestellten nicht nur zu betrachten nach den Folgen für den Betrieb,
sondern nach den Folgen und ihren Auswirkungen auf die Menschen.»[78]
Vorbild für andere Genossenschaftswohnungen
Die Gemeinde Grenchen bewilligte am 30. Dezember 1947 einen Kredit von 355'000 Franken für den Bau von zwei Wohnblöcken «nach dem System Eduard Lanz».
Das rote Biel (1921-1947)

Seit dem 5. November 1918 gehörte Eduard Lanz der Sozialdemokratischen Partei Biel an (73). Dies zu einer Zeit, als der freisinnig-bürgerliche Gemeinderat der Stadt
Biel einen riesigen Schuldenberg anhäufte. In Wien erlangte 1919 die Sozialdemokratische Arbeiterpartei (SDAP) die Mehrheit im Gemeinderat und leitete als «das rote Wien» wichtige Reformen für
die Arbeiterschaft im Sozial- und Bildungsbereich sowie im genossenschaftlichen Wohnbau ein. Wohnblöcke mit genügend Grünflächen und Häuser im sogenannten «Neuen Bauen» prägten Wien. Das sollte
auch in Biel möglich sein.
Als die Gemeinde Biel 1921 praktisch bankrott war, erreichten die Sozialdemokraten bei den Gemeinderatswahlen die absolute Mehrheit. Nun begann die Ära des «Roten Biel» und des Stadtpräsidenten
Guido Müller, zugleich Finanzdirektor und Vorsteher des Baudepartements. Im Krisenjahr 1921/22 brachten 3500 Arbeitslose und die Zahlung von Arbeitslosenunterstützung die Gemeindekasse an ihre
Grenzen. Die Stadt brauchte viel Geld, um den Bau neuer Strassen und den Unterhalt und Ausbau des bestehenden Strassennetzes zu finanzieren. Hierzu kamen die Förderung von Handel und Industrie,
Kunst und Sport sowie der Ausbau der Sozialfürsorge.[100] Guido Müller gelang es, die finanziellen Schwierigkeiten durch Sparmassnahmen statt durch
Steuererhöhung zu bereinigen. Nach sechs Jahren erzielte die Gemeinde 1922 erstmals wieder einen Einnahmeüberschuss.
Bereits 1910 hatte man sich gegenüber den Schweizerischen Bundesbahnen verpflichtet, das durch die Verlegung des Bahnhofs frei werdende Gelände zum Preis von Fr. 1'800'000 zu übernehmen.
1918 schrieb man zur Umsetzung eines Bebauungsplans einen Ideenwettbewerb aus. Die 1923 während der Auflagefrist gegen dieses Alignement zahlreich eingelangten Einsprachen, sowie die von den
Architekten Propper und Lanz eingereichten Gegenprojekte veranlassten die Bauorgane, am aufgelegten Alignementsplan verschiedene Abänderungen zu treffen. Der Gemeinderat beschloss, sämtlichen
Projekt-Varianten einem im Städtebau erfahrenen Fachmann zur Begutachtung zu unterbreiten, dem Stadtbaumeister Herter in Zürich.[104]
Als Grundlage für den Ausbau des Bahnhofquartiers diente:
1) Die Verlegung des Bahnhofs beim heutigen Hotel Elite, um 250 m nach Süden in unbebautes Gebiet.
2) Der am 7. April 1925 vom Regierungsrat genehmigte Alignementsplan, der einheitliche Häuserzeilen vorschrieb (an die sich Eduard Lanz allerdings nicht hielt).
Auf den frei gewordenen Flächen entstand ein Bahnhofsquartier mit Häusern im Stil des «Neuen Bauens», einer verlängerter Bahnhofstrasse und dem heute noch bestehenden dritten Bahnhof. Biel
erhielt ein modernes Gesicht.[56]
Bis 1930 reorganisierte das rote Biel den Trambetrieb, führte den Busbetrieb nach Berner Muster ein und ergänzte die Wasserversorgung mit einem neuen Reservoir. Im sozialen Bereich entstanden
unter anderem ein neues Strandbad, Altersheime, ein Arbeitsamt mit Berufsberatung, eine städtische Arbeitslosenversicherung, eine Schülerversicherung, ein Säuglingsheim, eine unentgeltliche
Geburtshilfe, mehrere Kinderkrippen und -horte sowie eine Altershilfe. Der genossenschaftliche Wohnungsbau, z.B. die Familiensiedlung Mösliacker, spielte eine ebenso wichtige Rolle wie die
Reorganisation des Schulwesens. Hier führte die SP die Lehrmittelfreiheit auch in den Mittelschulen ein.[95]
1940 verlor die SP die absolute Mehrheit im Gemeinderat. Mit dem Rücktritt von Guido Müller, der zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit die General Motors nach Biel
geholt hatte, endete 1947 auch das «rote Biel».
Ein Haus für die Arbeiterbewegung
Der erste Pionier der Arbeiterbewegung in der Schweiz war der aus Darmstadt stammende der politische Flüchtling Ernst Schueler, ein Bieler Gymnasiallehrer und langjähriger Redakteur des Schweizerischen Handelskuriers. Er gründete 1833 in Biel für die deutschen Handwerker den «Leseverein» als ersten Arbeitertreffpunkt. Schweizer Arbeiter bildeten ab 1838 in Genf den Grütliverein als radikale, politische Organisation. Er war in den ersten Jahren kein eigentlicher Arbeiterverein, denn im Vordergrund stand das «Heranbilden seiner Mitglieder zu tüchtigen, mit ihren Rechten und Pflichten vertrauten Bürgern». Am 1. 4. 1849 entstand die Grütlisektion Biel. Am 11. Juni 1865 stellte der Verein an einer Versammlung in Biel eine Reihe von sozialrevolutionären Forderungen auf, darunter: freiere Niederlassungsbedingungen und Vorrechte für Schweizer in allen Kantonen sowie die Wahl des Bundesrates durch das Volk. Die Arbeiterverhältnisse traten später in den Vordergrund. Die Grütlianer schlossen sich 1888 der Arbeiterunion an. 1893 bekannten sie sich zur Sozialdemokratie.[95]

In Biel eröffnete der Grütliverein am 15. 5. 1892 das erste Volkshaus der Schweiz, das den Namen Helvetia erhielt. Es befand sich bis 1916 im ehemaligen Abtenhaus an der Untergasse 21 (heute St. Gervais). Nachdem die Grütlianer aus der Sozialdemokratischen Partei (SP) austraten, übernahm die SP die Führung der Arbeiterbewegung. 1916 wurde die Volkshausgenossenschaft Biel mit Guido Müller als Revisor gegründet. Von 1916 bis 1932 war der Volkshausbetrieb in den gemieteten Räumen der ehemaligen Brauerei Seeland an der Juravorstadt 9 untergebracht.[56] Ab 1917 entstand aus Platzmangel die Idee eines neuen Volkshauses, welcher den Gewerkschaften auch als Kongressort dienen soll. Zu diesem Zweck ging am 28. Juli 1917 die «Baugenossenschaft Volkshaus Biel» hervor.
Im März 1922 beschloss der Vorstand, eine Eingabe an den Gemeinderat zu richten und ihn darin zu bitten, der Baugenossenschaft auf dem ehemaligen Bahnhofareal an der Güterstrasse einen Bauplatz zu reservieren. Als Antwort auf die Eingabe verlangte das Stadtbauamt am 5. April 1923 von der Baugenossenschaft Angaben über die Grösse des benötigen Grundstücks, die noch unklar war. 1924 konnte die Frage des Bauplatzes nicht weiter behandelt werden, da das Gutachten über die Bebauung des Bahnhofareals noch ausstand. [94] Eduard Lanz erarbeitete dennoch mehrere Planstudien, doch das Projekt verzögerte sich um mehrere Jahre. 1927 bewilligte die Gesellschaft einen Kredit für die Ausarbeitung von Plänen für einen Neubau. 1828 unterbreitete Lanz zwei Vorschläge, einen für ein Hochhaus in der Ecke gegenüber dem Hotel National und einen für einen Anbau gegenüber dem Café Transit.[94] Eduard Lanz: «Das Bauvorhaben des Hotels Elite leitete die Überbauung des seit dem Bahnhofneubau brachliegenden von der Gemeinde erworbenen alten Bahnareal ein. Dies gab Anlass, die Volkshausbaufrage wieder aufzugreifen, zumal die Zustände und Platzverhältnisse in den gemieteten Volkshauslokalen am Juraplatz unhaltbar geworden waren. Es wurde nun das Areal an der Aarbergstrasse (gegenüber dem Hotel National) bevorzugt.»[13]
Die Volkshausgenossenschaft Biel beschloss 1928, mit der Stadt Verhandlungen über den Erwerb eines Grundstücks auf dem alten Bahnhofplatz für den Neubau des Volkshauses aufzunehmen. Nach einer Volksabstimmung am 2./3. März 1929, die mit 3874 Ja gegen 1181 Nein ausfiel, bewilligte der Gemeinderat die Subvention für das Volkshaus. Im gleichen Jahr erwarb die Genossenschaft, deren Präsident der damalige Stadtschreiber Theodor Abrecht (später Bundesrichter) war, an der Bahnhofstrasse ein Grundstück von 800 m2 im Baurecht.[9] Eduard Lanz informierte daraufhin die Bevölkerung über die Pläne für den Neubau.

Lanz überzeugte den Vorstand der Baugenossenschaft Volkshaus mit einem Besuch in Basel, wo gerade das neue Kirchgemeindehaus (Oekolampad) mit einer ähnlichen Turmkonstruktion entstanden war. Seine Fassade war mit stark gebrannten Ziegelsteinen, den sogenannten Klinkern, verkleidet. Für deren Lieferung kam nur die Ziegelei Lausen in Frage, die als einzige Schweizer Firma Erfahrung mit der Herstellung dieser Steine hatte. Das Material von der Prüfstelle der ETH Zürich erfolgreich kontrolliert. Eine Probemauer steht als Brunnenrückwand bei der Siedlung Sonnhalde.[94]
Eduard Lanz: «Erstmals wurde in der Schweiz ein unglasierter, hartgebrannter Klinker verwendet, dessen Tönung und Vermauerung auf Schwierigkeiten stiess. Die Aussenmauern sind mit Kork-, Holzfasserstoff-, Bims- oder Backsteinplatten isoliert (je nach vorgesehener Wärmehaltung auf Basis eines einheitlichen Wärmedurchgangsfaktors). Das Klinkermauerwerk wird ergänzt durch einen entsprechend farbigen grosskörnigen Kunststein für Gesimse und Abdeckungen, rötlich-grauen Marmor für die Vitrinenbrüstungen, rotbraune Klinkerplattenverkleidungen der Aussenpfeiler mit Vitrinenrahmen in kupferroter Bronze».[13] PAm 13. Juni 1930 erfolgte die Baubewilligung und Projektverfasser Eduard Lanz konnte endlich mit dem Bau des Volkshauses beginnen. Es war seine 5. Version des Projekts.[13]
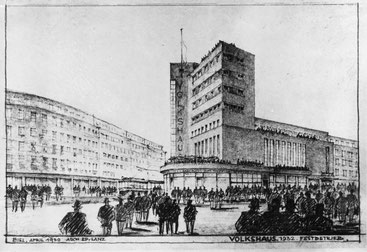
Die Bau- und Einrichtungskosten beliefen sich auf rund 1'700'000 Franken. Die beiden grössten Gewerkschaften des Platzes unterstützten das Vorhaben finanziell. Die
Metall- und Uhrenarbeiter gaben 16'000 Franken, die Bau- und Holzarbeiter rund 5'000 Franken. Hinzu kamen Anteilscheine der Gewerkschaften in Höhe von 61'000 Franken. Als einziger Zentralverband
zeichnete der Metall- und Uhrenarbeiterverband 5'000 Franken Anteilscheinkapital. Die Genossenschaft brachte aus eigenen Mitteln (Baufonds und Anteilscheinkapital) 200'000 Franken auf. Zur
Finanzierung des Baus zahlten die Gewerkschaftsmitglieder während 3 Jahren einen Tageslohn an die Genossenschaft.[9]
Auf der einen Seite der neuen Bahnhofstrasse stand auf Initiative von Maurice Vaucher, Präsident der Fédération Horlogère und unter der Bauleitung von Architekt Karl Frey, das Hotel Elite als
gehobene Unterkunft für die Vertreter der Uhrenindustrie. Gegenüber folgte nun unter dem Einfluss der Arbeiterbewegung, des von Eduard Lanz und Guido Müller bereits geförderten
genossenschaftlichen Wohnungsbaus und der Sozialdemokratischen Partei ein neues Volkshaus. Mit dem Volkshaus schuf Lanz sein Hauptwerk und das erste Hochhaus der Stadt. Die Einweihung fand am 19.
November 1932 statt.[13]

Die Architektur gilt als «städtebaulich hervorragend gelöstes Beispiel des Neuen Bauens. An einer der exponiertesten Stellen der Stadt, auf einem spitz zulaufendes Grundstück, kubisch gestaffelter Stahlbetonskelettbau mit roter Klinkerverkleidung. Massstäbliche Steigerung vom niedrigen Längstrakt an der Aarbergstrasse zum 8-geschossigen Hochhaus an der Bahnhofstrasse. Wohl vollkommenste Umsetzung der Bauaufgabe «Volkshaus». Sachlichkeit und Klarheit sind sowohl Ausdruck der Bauaufgabe als auch der Gesinnung der Nutzer. Plastisch überzeugender Baukörper, dessen Funktionen an den Fassaden ablesbar sind.»[58] Lanz errichtete sein Gebäude mit maximaler Funktionalität. Es bot Platz für alle Arten von sozioökonomischen Einrichtungen.
Eduard Lanz im Bieler Jahrbuch 1933: «Es war keine alltägliche Bauaufgabe. Sie fand ihre Erfüllung durch den Architekten nicht in der blossen Erfüllung der bautechnischen und architektonischen Forderungen des Zwecks schlechthin. Galt es doch einem Mittelpunkt der Bevölkerung Ausdruck und Gestalt zu geben an einem der exponiertesten Plätze der Stadt. Dies bedeutete nicht nur Ausdruckgeben im formalen Sinne, sondern geschah im persönlichen Erleben der Ideale, die unsere vergangene Generation zum Kampf für die demokratische Staatsform verpflichteten, heutige und künftige Generationen aus dem wirtschaftlichen und kulturellen Chaos der Planwirtschaft, der wirklichen Demokratie entgegenwirken zu müssen. Mit dem Ziel, den Bau sachlich aus den ihm zugrundeliegenden Funktionen zu entwickeln, war ich bestrebt, mich in der Gestaltung bis in die Einzelheiten aller architektonischen Zufälligkeiten und Launen zu enthalten und unbewusste Anflüge falscher Modernität im Reifeprozess des Baues zu eliminieren. Es galt zu sprechen ohne Schlagwort und nicht schön zu reden. Der Wille, dem Äussern eine kräftig, leuchtende Farbe zu geben, führte zur Wahl des Backsteinklinkermauerwerks als Verkleidung oder als Vollmauerwerk, einer rationellen und dauerhaften Bauweise.»[13]
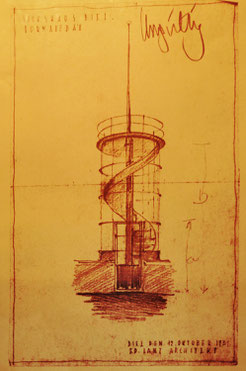
Stadtbaumeister O. Schaub würdigte in «Biel, ein Stadtbuch» (1936) das demokratische Wesen der Bieler Bevölkerung, dass der betonten Sachlichkeit des «Neuen Bauens»
(damals in Deutschland bereits als ‹Bolschewistisch› verschrien) offenstand.[59]
Das Gebäude, von den Bielern auch «Château du Peuple» genannt, galt auch als soziales und politisches Zentrum der Arbeiterschaft.[9] Zu ihren Bildungs- und
Kulturbestrebungen gehörten das Restaurant «La Rotonde» (seit 1932 so genannt), ein grosser und ein kleine Saal mit einer geräumigen, modern eingerichteten Bühne im ersten und zweiten Stock; die
Möglichkeit von Filmvorführungen mit Kinoanlage, zwei Musiksäle, ein grosser und drei kleinere Sitzungszimmer, der Lesesaal der Bibliothek und der Büchersaal im dritten Stock. Eng mit der
Tätigkeit der Gewerkschaften verbunden waren deren Berufssekretariate im vierten Stock (Metall- und Uhrenarbeiter, Bau- und Holzarbeiter, Arbeiterunion). Dazu enthielt das Volkshaus auch die
notwendigen Nebenräume und Einrichtungen, wie Gerantwohnung, Dienstzimmer, Küche, Keller, Waschküche, Kegelbahn, zwei Personenaufzüge, zwei Speiseaufzüge etc.[93] Über das Innere des Gebäudes schrieb das Bieler Tagblatt vom 21. November 1932: «Im Keller befindet sich eine moderne Heizungsanlage mit einen Apparat, der die
Temperatur aller Räume anzeigt. Der Heizer braucht nicht mehr selbst in die Zimmer zu gehen, um festzustellen, wie warm sie sind. Das Hotel verfügt über drei Stockwerke mit jeweils acht Zimmern
und einem Bad. Jedes Zimmer hat einen Telefonanschluss und eine Kalt- und Warmwasserleitung. Über eine Treppe gelangt man auf die 32 Meter hohe Plattform des Turms, von wo aus man einen
einmaligen Rundblick über die Stadt, den See und den Jura geniessen kann.»[57] Über den Bau des Volkshauses drehte das «Schweizerische Schul- und Volkskino»
einen Film, der bei den Zuschauern eine «ungezwungene Heiterkeit» auslöste.[92]
1933 fand eine Versammlung zur Besprechung der Lage in der Uhrenindustrie statt, an der 1200 Personen teilnahmen. 1935 nahm Lanz auch am Wettbewerb für das Volkshaus
Thun teil und erhielt den 2. Preis.
In der Nachkriegszeit wurden verschiedene Renovationen und Umbauten vorgenommen: Umbau der Heizung (Umstellung auf Ölfeuerung), Einrichtung des Wirtschaftslokals «Seebutz» 1948, Erweiterung des
Hotels im Zusammenhang mit dem Auszug des Smuv (Erhöhung der Bettenzahl von 33 auf 50) sowie die 1954 vorgenommenen Veränderungen im Kellergeschoss (Vorratsräume, Personalraum), Umbau des
Hoteleingangs und der Hotelbüros und die Erstellung des Saales Nr. 15 im Galeriegeschoss noch unter der Leitung von Eduard Lanz.[92]
Pietro Scandola, ehemaliger Direktor vom NMB (Neues Museum Biel) in «Häuser erzählen»: «1977 musste die Volkshausgenossenschaft Konkurs anmelden. Der Auszug der
Gewerkschaftssekretariate in den 50er Jahren, eine unrentable Hotelgrösse und die Konkurrenz des 1966 eröffneten Kongresshauses waren dafür mitverantwortlich. Die mögliche Privatisierung und
Kommerzialisierung des Volkshauses (z.B. als Einkaufszentrum) mobilisierte eine starke Gegenbewegung. Noch 1977 wurde der Kauf des Gebäudes durch die Stadt Biel an der Urne deutlich abgelehnt.
Ein breites Bündnis von Vertreter/innen aus Kultur, linken Parteien und sozialen Bewegungen bildete daraufhin die ‹Interessengemeinschaft Volkshaus› (IG Pro Volkshaus).»
Dr. Hans Jörg Rieger, im Bieler Jahrbuch 1983: «Bereits an der Gründungsversammlung des Vereins, die am 16. September 1981 im Restaurant St-Gervais stattfand, wurde beschlossen, eine
Volksinitiative zur Rettung des Volkshauses zu lancieren. In kurzer Zeit zählte der Verein 400 Mitglieder, darunter zahlreiche Vereine als Kollektivmitglieder. Eine Unterschriftensammlung wurde
gestartet, deren Inhalt lautete: «Die unterzeichneten Stimmberechtigten der Gemeinde Biel stellen, gestützt auf Art. 12 der Gemeindeordnung das Begehren, das Volkshaus, Bahnhofstrasse 11, Biel,
sei durch die Gemeinde Biel zu erwerben, zu sanieren und einer öffentlichen, insbesondere kulturellen und sozialen Nutzung zuzuführen.» Innerhalb von drei Tagen, vom 29. bis 31. Oktober,
sammelten die Anhänger der Initiative 4700 Unterschriften auf den Strassen und Plätzen der Stadt. Zur Einreichung der Initiative fertigten Mitglieder der IG ein grosses Modell des Volkshauses,
das die Unterschriftenpakete enthielt. Unter dem Motto ‹Wir haben für das Volkshaus erste Hilfe geleistet› wurde das Modell auf einer Bahre zur Stadtkanzlei getragen.»[90]
Scandola: «Ein glücklicher Umstand war, dass Konservatorium und Musikschule Interesse an einer Zentralisierung der verstreuten Unterrichtsräume zeigten und in ein neues Nutzungskonzept einbezogen
werden konnten. Die Bieler stimmten am 22. und 23. 10. 1983 mit 8202 Ja gegen 7438 Nein dem Kauf des Volkshauses durch die Stadt Biel relativ knapp zu. Von 1986 bis 1989 wurde der Bau saniert und
konnte der geplanten kulturellen und sozialen Nutzung zugeführt werden. ‹Rotonde›, der Name des Restaurants im Erdgeschoss, bürgerte sich bald als Bezeichnung des Gebäudes ein, das einst als
Volkshaus eine stolze Ikone der Arbeiterstadt Biel war.» Die Musikschule und das Konservatorium mit ihren damals rund 1400 Schülern, die bis dahin auf zehn verschiedene Gebäude (davon sechs in
der Altstadt) verteilt waren, konnten nun unter einem Dach zusammengeführt werden.[90]
Das Emil Schibli-Haus in Lengnau (1927) und das Eigenheim in Biel (1933)
Architekturhistoriker Robert Walker: «Das in Lengnau (BE) eines der ersten modernen Häuser der Zwanzigerjahre steht, ist Eduard Lanz zu verdanken, der es 1927 für den Lehrer und Dichter
Emil Schibli erbaute. Damals galt dieses kleine Haus als ein revolutionärer Bote der in Deutschland aufkommenden modernen Architektur. Nebst einem kleinen Objekt von Le Corbusier in Corseaux bei
Vevey, zählt dieses Wohnhaus zu den ersten Versuchen in einer neuen Formensprache. Auf der von Lanz gezeichneten Skizze sah das Haus wie ein Wachtürmchen aus, weil es an Stelle eines Satteldaches
ein Pultdach trug. Es sei die billigste Konstruktion, die man sich ausdenken kann, soll Lanz gesagt haben. Ziel war es, jeden Kubikzentimeter auszunutzen. Die Küche wurde auf wenige Quadratmeter
eingeschränkt. Trotz knappen Mitteln fügte Lanz dem Haus Bauteile hinzu, die geradezu luxuriös erscheinen, zum Beispiel den Erker. Bei der Renovation 1985-1990 erhielt das Haus teilweise neue
Fenster.»[2]
Emil Schibli-Haus in Lengnau. Zustand 2023
Als die Nidauer Wohnung für die Familie zu eng wurde, baute Eduard Lanz 1933 an der Schützengasse 90 in Biel sein eigenes Zweifamilienhaus, im Stil vom Emil Schibli-Haus. Er versetzte zwei Wohnungen firstparallel gegeneinander. Eine klare Aufteilung der Wohnungen wurde durch getrennte Eingänge gemacht. Lanz verwendete das originelle Farbkonzept rot/türkisgrün.[14] In seinem neuen Heim organisierte er 1933 eine öffentliche Ausstellung, über die Werner Bourquin im Bieler Tagblatt berichtete: «Die Küche ist das Kolumbusei der gesamten Ausstellung. Die Tatsache, dass die Küche keinen Raum hat für überflüssige Gegenstände, zwingt den Architekten, auch den kleinsten Platz mit Vorteil zu verwenden. Er muss alles in organischer Folgerichtigkeit anordnen, nicht anders, als handle es sich um den Arbeitsplatz eines Fabrikarbeiters. Alle Küchengeräte haben ihren speziellen Platz, der nicht beliebig gewählt wird, sondern in kürzester Entfernung des Arbeitsplatzes.»[22] Eduard Lanz baute in die Wand der sogenannten «Frankfurter Küche» eine aufklappbare Durchreiche ein, so dass man das Essen direkt ins Wohnzimmer servieren konnte, ohne die Küche verlassen zu müssen. Er verfügte im Untergeschoss über ein hübsches Arbeitszimmer mit Blick auf den Garten und richtete im Nebenraum eine Dunkelkammer für fotografische Zwecke ein. Der Balkonboden baute Lanz mit den übrig gebliebenen roten Klinkersteinen vom Volkshaus. Das originelle Haus, eingebettet in eine schöne Grünanlage, befindet sich 2023, also 90 Jahre später, immer noch im Originalzustand. So spürt man auch heute noch die Philosophie des Architekten. Ganz in der Nähe, an der Schützengasse 86, erstellte Lanz 1934/35 ein Dreifamilienhaus, welches die kantonale Denkmalpflege wie folgt beschreibt: «Das kompromisslos moderne Haus gehört zu den konsequentesten Auseinandersetzungen mit Themen des Neuen Bauens in Biel.»[14]
Das Wohnhaus von Eduard Lanz an der Schützengasse 90 in Biel. Zustand 2023
Umbau vom Ernst Möschler Haus in Nidau (1929)
Bei Umbauarbeiten im Haus von Ernst Möschler an der Hauptstrasse 38 in Nidau fand Eduard Lanz Reste alter, gut erhaltener Fresken. In einem gevierten Feld sah man
eine Darstellung von Adam und Eva. Eine andere Freske stellte vermutlich den heiligen Sebastian dar. Der Decke entlang zog sich ein nur zum Teil erhaltener schmaler Fries mit Menschen- und
Tierfiguren. Diese Fresken stammten vermutlich aus den ersten Jahren des 16. Jahrhunderts. Sie waren bis jetzt hinter einem Täfer versteckt.[141]
Umbau und Renovation vom alten Schulhaus Nidau (1931)
Das geräumige Schulhaus (heute Gemeindeverwaltung) wurde 1866 in der Schulgasse 2 erbaut und am 13. Oktober 1867 eingeweiht. Der Baugrund machte dem Haus jedoch zu schaffen. 1896 stellte der Rat
fest, dass «der schlechte, fast gefährliche Zustand des Schulhauses eine Reihe von Konsolidierungs- und Renovationsarbeiten erfordert.»[101] 1919 zogen
Primar- und Sekundarschule aus dem alten Schulhaus in das während des Krieges neu erstellte Gebäude am Balainenweg um. Zurück blieben eine einzige Primarklasse und der Kindergarten. Annemarie
Lanz: «Die zwei Jahre Kindergarten bei Fräulein Matter im alten Schulhaus brachten erste schulähnliche Erfahrungen, ebenso die Sonntagsschule in der Kirche Nidau. Ausflüge machten wir im
Zweierreiheli durch die Weyermannstrasse, zum Kindergarten-Garten, wo es Kräutersirup gab oder per Sonntagstram nach Bözingen und von da, natürlich zu Fuss, auf den Berg zum grossen Spielfest.»
[105]
Das Haus bot auch Platz für die Stadtverwaltung, Vereine und Parteien. 1930 zeigten sich Risse in der stark verwitterten Fassade infolge Absenkung. Das grosszügige Treppenhaus, die Gänge, sowie
alle Zimmer wiesen starke Abnutzungserscheinungen auf. Die Abwartswohnung musste aus hygienischen Gründen verlegt werden. Die Leitung des Umbaus wurde «Genosse Eduard Lanz» übertragen. Er hatte
die Fragen und Probleme in Verbindung mit der Schul- und Baukommission vorteilhaft gelöst. Wesentliche Veränderungen ergaben sich durch die Treppenänderung und den verschiedene Umstellungen und
Ergänzungen im Innenausbau. Dem gestiegenen Bedürfnis nach Turn und Sportmöglichkeiten wurde durch vollständige Neuerrichtung der alten Turnhalle unter Einbeziehung der ehemaligen Abwartwohnung
entsprochen. Es entstand ein imposantes und zweckmässiges Schulhaus.[97] Nach dem zweiten Weltkrieg setzte eine Zunahme der Bevölkerung und eine ständig
wachsenden Schülerzahl ein. Die untersten 4 Klassen der Primarschule mussten doppelt geführt werden und die der Verwaltung zur Verfügung stehenden Räume des alten Schulhauses mussten wieder
renoviert und mit Schulklassen belegt werden.[102] Von den Arbeiten von Eduard Lanz sind heute kaum mehr etwas zu sehen. Das Innere wurde bei späteren
Renovationen komplett umgestaltet, so auch die ehemalige Turnhalle (heute Büroraum).
Das alte Schulhaus Nidau, renoviert von Eduard Lanz und als modernes Gemeindehaus, Zustand
2023.
Foto links: Werner Friedli, ETH-Bibliothek Zürich, Stiftung Luftbild Schweiz, CC BY-SA 4.0
Eine Weidehütte wird zum Frauenklubhaus (1935)
1818 entstand der Schweizerische Alpenklub (SAC), der weibliche Mitglieder grundsätzlich ablehnte. Die Frauen antworteten noch im gleichen Jahr mit dem in Genf
gegründeten ersten Schweizerischen Frauenalpenklub (SFAC). Die Sektion Biel wurde am 21. November 1920 mit 24 Mitgliedern gegründet. Bald kam der Wunsch nach einem Berg- und Skiheim auf. Lange
begnügte man sich mit gemieteten Räumen, die alle ihre Nachteile hatten. 1928 kaufte der Klub in Prés-d’Orvin (Ilfinger-Matten) für 3000 Franken die Weidehütte «Sunneschyn» (Villa Hü), eines der
ältesten Gebäude der Region. Es erhielt als erste Erneuerung einen Schlafraum mit 23 Schlafplätzen. 1935 wurde unter der Leitung von Eduard Lanz das primitive «Chucheli» in eine zweckmässig
eingerichtete Küche umgebaut, und anstelle des Holzschopfes verfügte der Klub nun über einen geräumigen, hell getäferten und überaus gemütlichen Ess- und Aufenthaltsraum. Am 10. November
1935 konnte das Haus feierlich eingeweiht werden. Pfarrer Margot nahm die Segnung vor. [142] Nach der Fusion des SFCA mit dem SAC 1979, blieb die Bieler Frauensektion ab 1980 unter dem Namen
«Schweizer Alpen-Club Sektion Jorat BE, Biel» weiterhin selbständig.
Weekend-Häuser (1936/37)
Private Wochenendhäuser baute Eduard Lanz unter anderem für Hugo Renfer am Thunersee (1936) und für Walter Roth am Neuenburgersee (1937). Bei diesen einfachen Bauten konnte er seine handwerklichen Kenntnisse und Fähigkeiten im Holzbau und in der Konstruktion anwenden.[3]
Ein Heim für die Studentenverbindung «Zofingia» (1938/39)
Wie bereits in diesem Artikel erwähnt, waren mehrere Mitglieder der Familie Lanz bekennende Zofinger und trugen die entsprechenden weissen Mützen. 1938/39 konnte
Eduard Lanz an der Alpeneckstrasse in Bern einen Neubau für die Studentenverbindung errichten. Auf Vorschlag von Lanz liess der Heraldiker und Kunstmaler Bösch alle vier Seiten der Aussenfassade
mit Wappen schmücken. Das Innere erhielt einen grossen Kommerz- und Sitzungssaal, Bibliothek, Arbeitszimmer, Clubraum, Dusche, eine eigene Kegelbahn und eine Hauswart-Dreizimmerwohnung mit Küche
und Bad. Die Eröffnung fand am 10. Juni 1939 statt.
Der Holzlagerschopf der Burgergemeinde Biel (1940)
Die Burgergemeinde Biel plante seit mehreren Jahren den Bau eines Holzschopfes zur Lagerung, Trocknung und Verarbeitung ihres Brennholzes. Das definitive Projekt
entstand nach Plänen von Eduard Lanz an der Reuchenettestrasse. Lanz leistete damit einen wichtigen Beitrag zu den forstlichen Aktivitäten der Burgergemeinde. Das Lagergebäude fasste 1200 Ster
Holz. Davon konnten durch Verkleinerung 660 Ster Gasholz angeben werden. Sie ermöglichten die Belieferung von sieben Holzgaslastwagen mit einer Jahresleistung von 50.000 Kilometer. Der Schopf
wurde inzwischen abgebrochen und durch einen modernen Bau ersetzt.
Bauten der Nächstenliebe

Die Natur vor der Tür - Ferienhäuser für Kinder: Die aus der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung hervorgegangenen «Wiener Kinderfreunde» gingen auf die
Initiative von Journalist Anton Afritsch (1973-1924) zurück, der mit zahlreichen Eltern und Kindern gemeinsame Spaziergänge und Wanderungen unternahm und 1908 in Graz den «Arbeiterverein
Kinderfreunde» mit 50 Eltern gründete. Während des Krieges rückte die Fürsorgearbeit der «Wiener Kinderfreunde» in den Vordergrund. Grossstadtkinder sollten durch Ferienheime vor der
Verwahrlosung ihrer alltäglichen Umgebung und vor Unterernährung geschützt werden. Nach dem Krieg führte der wirtschaftliche Zusammenbruch zu einer Intensivierung der Fürsorgearbeit.
Kurz nach Kriegsende reiste Albert Hofer (1873-1963), Sekundarlehrer und Mitglied des Sozialdemokratischen Lehrervereins Bern, mit einem Kinderzug nach Wien, wo er im Herbst 1920 und im Sommer
1921 die «Wiener Kinderfreunde» und ihr Heim im Schloss Schönbrunn kennen lernte. Anlässlich der Sozialistischen Kinderwoche im Herbst 1921 unterstützten die Wiener das Vorhaben von Hofer, in
Biel durch die Sozialisten eine Kinderfreunde-Gruppe zu gründen. Eine Bieler Genossin wurde daraufhin in die Kinderfreunde-Schule in Schönbrunn-Wien aufgenommen. Die Ortsgruppe Biel stand
in schriftlichem Kontakt mit dem Reichssekretariat.[145] Nach seiner Rückkehr ins rote Biel beschloss Hofer mit einigen Parteigenossen, sich um die
unbeaufsichtigten Kinder von Biel und Umgebung während der schulfreien Zeit zu kümmern. Zu diesem Zweck konnte 1921 in Magglingen auf 960 m ü. M. in den Studmatten eine Spielwiese gemietet
werden, wo die Kinder zwar viel Spass hatten, aber manchmal auch der Witterung ausgesetzt waren.
Albert Hofer gründete in Biel am 9. Januar 1922 den «Arbeiterverein Kinderfreunde Biel und Umgebung» (La société des Amis des enfants de Bienne). Damit entstand in der Schweiz die erste
Kinderfreundegruppe nach Wiener Vorbild. Ziel war es, «die Kinder den verderblichen Einflüssen der Strasse zu entziehen und sie vor Verrohung zu schützen.»[139] Auf Antrag des Vereins stellte die Schuldirektion zwei Zimmer im Dufourschulhaus werktags von 16 bis 20 Uhr zur Verfügung. Die Kinderfreunde wollten aber nicht nur
Hortstunden anbieten, sondern auch sonntags Spiele im Freien organisieren. Es brauchte daher ein Eigenheim.[144]
Dieses Vorhaben wurde 1922 vom Gemeinerat von Biel unterstützt. Er bewilligte eine öffentliche Sammlung für den Kauf eines Grundstücks und den Bau einer Unterkunftshütte. Die Burgergemeinde gewährte einen Barbeitrag an die Hütte. Am 7. und 8. April 1923 fand im Volkshaussaal an der Juravorstadt ein Basar «Zugunsten eines Jugend- und Ferienheimes» statt. An der Stadtratssitzung vom 23. November 1923 wurde beschlossen dem Verein Kinderfreunde einen Betriebsbeitrag von 1000 Franken und für den Bau der Ferienhütte in Magglingen einen Betrag von 2000 Franken zu gewähren. Dies führte zu Oppositionen seitens der Bürgerlichen. Mit 28 zu 24 Stimmen wurde das Projekt genehmigt und schliesslich vom Volk mit grosser Mehrheit angenommen. Die Bürgerlichen waren nach wie vor der Meinung, dass es sich bei diesem Projekt um einen «Missbrauch von Gemeindegeldern» handle. Der Verein beauftragte 1923 sein Mitglied Eduard Lanz, dessen Frau Dora als Sekretärin dem Verein angehörte, mit dem Bau der Schutzhütte. Seine Pläne zeigten ein aus vorhandenen Steinen gemauertes Erdgeschoss mit Küche und Aufenthaltsraum und ein Oberschoss aus Holz mit 40 Schlafplätzen. Die Hütte war mit einer Abwasserzisterne ausgestattet.[144] Sie entstand «Am Wald 31», umgeben vom Büschen und Bäumen und Spielplätzen. Um die Bauschulden abzutragen beschloss der Verein am 6. September 1926 in der Gemeinde Nidau eine Geldsammlung von Haus zu Haus durchzuführen.
1927 konnten bereits 50 Ferienkinder im Haus betreut werden. Die Knaben schliefen auf Strohlagern, die Mädchen auf Matratzen. Sie erhielten jeden Sonntag gratis Suppe und Tee. Das Haus wurde zum idealen Treffpunkt für Jugend und Sport.[139] Regelmässig übernachteten unter der Woche Wanderklassen im Kinderfreundehaus, welche die hübsche Landschaft der Jurahöhen kennenlernten. Unter dem ersten Präsident Karl Spitznagel kostete die Übernachtung inklusive Morgenschokolade Fr. 1.30.-. Die Kirchen fanden das skandalös und protestierten in der Schweizer Kirchenzeitung: «Man schaut zu, wie die Sportvereine die Jugendlichen wegnehmen, man schaut zu, wie die Sozialisten die Jugend organisieren, und jammert, dass es so ist, dass man nichts machen kann. Warten wir nur, dann werden wir es bald auch bei uns erleben, dass die Sozialisten, wie in Österreich, uns die Schulkinder wegnehmen, sie in Kinderfreundegruppen vereinen und mit ihnen am Sonntag statt des Gottesdienstes Kulturfeiern und Proletarierfeste veranstalten. Tausende von Kindern werden auf diese Weise jedem religiösen Einfluss entzogen.»[146] Der Beliebtheit dieser Einrichtung tat dies keinen Abbruch und viele begeisterte Eltern pilgerten weiterhin an den Wochenenden mit ihren Kindern nach Magglingen.
1928 zählte die Kinderfreundebewegung in Deutschland rund 400 Ortsgruppen und 200 Kindergruppen mit 200‘000 Kindern. In der Tschechoslowakei hatten die Kinderfreunde
100 Gruppen mit 10‘000 Kinder. Die Organisationen in der Schweiz, Österreich, Polen, Lettland, Dänemark, Spanien, Portugal, Holland, Luxemburg, Belgien, Frankreich und Argentinien hatten zusammen
300‘000 Kinder. Die Mittel zur Aufrechterhaltung des Magglinger Betriebes beschaffte der Verein durch die Mitgliederbeiträge und durch einige Kollektivmitglieder, die fast ausschliesslich aus den
Bieler Sektionen der Gewerkschaftsverbände stammten. Die rund 200 Mitglieder zahlten jährlich 5 Franken.[139] 1929 schädigte eine Einbrecherbande das Heim.
Als 1930 die sozialdemokratischen Frauen Biels einen sozialistischen Frauentag in Magglingen veranstalteten, stellte der Verein Kinderfreunde sein Heim zur Verfügung. Vom 18. Juli bis 6. August
1932 bildeten 210 «Rote Falken» auf dem Gelände eine «Kinderrepublik».
Mit dem etappenweisen Aufbau der Sportschule, nahmen auch die Aktivitäten im Heim zu. 1934 wurde es ans Stromnetz angeschlossen. 1944 erhielt das Heim einen Saalanbau mit Schlafsaal im
Obergeschoss. Nach der Beteiligung einer Hilfsaktion für das kriegsgeschädigte Florisdorf (Österreich), solidarisierten sich die Bieler Kinderfreunde mit den Wiener Arbeiterfamilien, indem sie
für deren Kinder Ferienkolonien in Magglingen organisierten.[144] 1947 nahm das Heim 50 Kinder aus Florisdorf auf. 1949 kamen auf Anfrage aus Mauthausen, 15
arme österreichische Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren für einen vierwöchigen Kuraufenthalt ins Kinderfreundehaus. Das Komitee «Biel grüsst Wien» rief am 26. Juli im Bieler Tagblatt die Bieler
Bevölkerung auf, «die armen und unterernährten Kinder durch Spenden (Schuhen, Kleider, Toilettenartikel, Obst) zu unterstützen.»[140] Das Ferienheim wurde in
den folgenden Jahren durch Anbauten erweitert, 1990 modernisiert und 2014/15 gesamtsaniert. Ab den 1970er Jahren rückte das Umweltbewusstsein in den Vordergrund und aus dem «Arbeiterverein
Kinderfreunde» wurde der pädagogische «Verein AbenteuerNaturBiel».[144]

Ferienheim «Bärgsunne», in Schwanden (1929): Für die erholungsbedürftige Schulkinder aus Nidau wurde 1908 die «Ferienversorgung Nidau» gegründet. Wegen der beschränkten Unterbringungsmöglichkeiten verbrachten die ersten Kinder ihre Ferien in alten Häusern in Schernelz und Prägelz. Eine Lösung die nicht überzeugte. Die kränklichen und schwachen Schulkinder sollten zur Stärkung ihrer Gesundheit und zur Vorbeugung gegen die Tuberkulose nicht aus den vielerorts schlechten Wohnverhältnissen in noch schlechtere für einen Ferienaufenthalt gebracht werden. Es fehlte das sonnige und luftige Eigenheim. Während die Kinder ihre dreiwöchigen Ferien auf dem Beatenberg, in Obwalden Bad Biembach und Ottenleuebad verbrachten, wurde inzwischen ein Baufonds für ein eigenes Ferienheim angelegt.[138] Zur finanziellen Unterstützung sammelten die Nidauer Kinder Altpapier und Pro Juventute-Marken und brachten diese ins Schulhaus. Am 15. Dezember 1928 tagte die Baukommission und lud die beiden Nidauer Architekten Eduard Lanz und Hans Wildbolz (1890-1951) zur Mitarbeit ein. Am 11. Februar legte Lanz der Kommission ein bereinigtes Projekt vor. Die Pläne wurden vom Eidgenössischen Gesundheitsamt gutgeheissen. Lanz übernahm die Projektierung, Hans Wildbolz die Bauführung. Die beiden Architekten kannten sich bereits durch die BIWO-Aktion von 1936. So entstand 1929 in Schwanden ob Sigriswil das Nidauer Ferien- und Erholungsheim «Bärgsunne» auf 1100 m. ü. M., auf einer ausladenden, windgeschützten Bergterrasse.
Das Nidauer Wohlfahrtseinrichtung «Bärgsunne» in Schwanden. Reproduktion aus Berner Schulblatt, Nr. 9, 1938, S. 136.
Das Holzhaus im Berner Chaletstil bot Platz für 50 Kinder und ihre Betreuer. Ihnen tat sich eine herrliche Aussicht auf die grossen Tannenwälder und auf die
Berggipfel auf. Zwei eigene Wasserreservoire sorgten für fliessendes Wasser im ganzen Haus.
Am 9. September zog als erstes die Ferienkolonie der Pro Juventute des Amtes Nidau ein. Am 5. Oktober folgte die erste Nidauer Sommerkolonie. Bei der Einweihung übergaben Lanz und Wildbolz den
Schlüsses des Heims an Emil Fawer (gest. 1963), den Präsidenten der Ferienversorgung. Er bezeichnete das Heim als Symbol der Nächstenliebe. Unterstützt wurde das Projekt vom Gemeinnützigen
Frauenverein unter Präsidentin Schwab.[85] Das Haus erhielt folgende Ausstattung: Im Erdgeschoss befanden sich der Aufenthaltsraum mit grossem und kleinem
Speisesaal, Küche, Speisekammer, Toiletten, separate Duschräume, Ankleide- und Trockenraum, Heizraum für einen eventuellen späteren Zentralheizungseinbau, Rüstraum und Nebenräume. Im ersten und
zweiten Stock befanden sich nach Süden je drei Zimmer mit je sechs Betten, nach Norden Krankenzimmer, Zimmer für die Lagerleitung, Waschraum, Bad usw., in der Mädchenabteilung ein spezielles
Zimmer zum Kämmen. Das Dachgeschoss war für den Hauswart bestimmt.[116] An der künstlerischen Gestaltung war Heinz Balmer beteiligt. Er malte das Wahrzeichen
von Nidau, den Krebs und den Fisch an der Vorderseite des Hauses. Der Spruch über dem Hauseingang lautet: «Mir hein is nit lang bsunne, hei boue a dr Sunne!». Im Esssaal stand «Alpenluft isch
rein u gsund, Milch und Chäs macht chugelrund.» Das Haus und die Pläne von Lanz dienten als Vorbild für ein Kinderheim in den Karpaten.[85] Der Bau kostete
1929, inklusive Mobiliar, 83‘922 Franken.[138] 1933/34 ergänze er das Ferienheim mit einem Erweiterungsbau, einem Spiel- und Lesesaal und einer Liegehalle.
Die «Bärgsunne» wurde in en folgenden Jahren mehrmals erweitert.[85]
«Es ist eine besondere Genugtuung, dass ich in meiner Heimatstadt Biel ein Werk verwirklichen konnte,
welches nicht nur dem Wohl der Gemeinde, sondern auch der Entfaltung des kirchlichen Lebens dient.»
Eduard Lanz über das Wyttenbachhaus [76]

Wyttenbachhaus (1940/42): Die zweisprachige reformierte Kirchgemeinde benannte auf Vorschlag von Pfarrer Helbling das Gotteshaus nach dem in Biel wirkenden
Reformator Thomas Wyttenbach.[75] Eduard Lanz: «1922 schuf der Kirchgemeinderat auf Antrag von Pfarrer Blattner einen Fonds zum Bau eines
Kirchgemeindehauses. 1928 wurde eine Kirchgemeindehauskommission gebildet, die sich über verschiedene Kirchgemeindehäuser in der Schweiz informierte. 1930 suchte man nach einem günstigen
Bauplatz.» Sie erhielten zahlreiche Offerten. So wurde ihr eine Parzelle in Bahnhofsnähe, eine an der Seevorstadt, eine an der Juravorstadt, eine im Ring 12, eine zwischen der Bözingenstrasse und
der Reuchenettestrasse sowie an der Kreuzung der Seevorstadt mit der Rosiusgasse angeboten. Auf der letzten Parzelle stand die alte Villa Rosière, welche die Kirchgemeinde am 20. Juli 1930 als
Provisorium kaufte. Eduard Lanz: «Das einzige kleine 2-fenstrige Unterrichtszimmer vermochte neben einem Sitzungszimmer, einem kleineren Saal und einer auf die zwei Stockwerke zerstreuten
Sigristenwohnung den Bedürfnissen des Unterrichts, der Sonntagsschule, der Jugendgruppen etc. immer weniger gerecht zu werden.» 1937 entschloss man sich zu einem Rosière-Neubau und
veranstaltete dazu einen Ideenwettbewerb. Lanz beteiligte sich mit dem Entwurf «Neues im Alten». Als die Kirchgemeinde das Blöschhaus kaufte, überlegte man sich dort die notwendigen Räume sowie
eine Pfarrwohnung unterzubringen, was aber nicht zur Ausführung kam.[110]
Am 21. August 1939 beschloss die Kirchgemeinde den Neubau durch Eduard Lanz projektieren zu lassen. Wegen des Kriegsausbruchs überlegte sich die Kirchgemeinde aus finanziellen Gründen, das
Blöschhaus zu erwerben und dort die notwendigen Räume sowie eine Pfarrwohnung unterzubringen, was aber nicht zur Ausführung kam.
«Und so begannen», erzählte Lanz, «an der Stelle des abgebrochenen Hauses Rosière die Bauarbeiten, die 66 Bieler Firmen Beschäftigung verschafften. Darunter waren 2 Ingenieurbüros, 4 Baumeister,
2 Zimmereien, 2 Spenglereien, 2 Dachdeckermeister, 4 Bodenbelagsfirmen, 6 Schlossereien, 17 Schreinereien, 4 sanitäre Installationsgeschäfte, 5 Elektro-Installationsfirmen, 3 Heizungs- und
Installationsfirmen, 10 Maler- und Gipsergeschäfte, 2 Tapezierermeister und 3 Gärtnermeister. Aus dem alten Rosiére war vieles ins Wyttenbachhaus übergegangen, so der schöne Brunnen, die alte
Eingangstür, das Gartengitter, Balken und anderes mehr. Fensterbänke, Gewände aus Hauterive und Jurastein sind als Mauer- und Sockelplatten neu entstanden.»[76]
Wyttenbachhaus: Türen der Villa Rosière und Inschrift mit Jahreszahl 1941.
Die Bühne vom Wyttenbachhaus, einst mit einer Metzler-Orgel versehen.
Teilansicht vom grossen Saal, mit Fresken des Kunstmalers Walter Clénin.
Die vom Bund, Kanton und Gemeinde weitgehend subventionierten Baukosten umfassten auch eine Korrektion an der Rosiusgasse. Das Wyttenbachhaus weist keine auffällige
Fassade auf, sondern fügt sich bescheiden in die Umgebung ein und ist auf klare Sachlichkeit ausgerichtet. Die Räume sind schlicht gehalten, nur der grosse, ebenerdige Saal für 300 Personen hat
eine Holzbalkendecke und eine umfangreiche Wandmalerei. Im grossen Saal befindet sich anstelle einer Bühne eine erhöhte halbrunde Abside mit seitlichem Rednerpult und Orgel. Ein grosses Vestibül
und weitere Räume können zur Erweiterung des Saales genutzt werden. Im Erdgeschoss ist eine Küche untergebracht.[75] Im Keller konnte 1940 der Sanitätsposten
vom Bieler Luftschutz eingerichtet werden. 1966 fand an der Jahresversammlung des Hilfswerks «Helvetas» ein Nepal-Abend statt. In einer kurzen Einführung wies Eduard Lanz auf das dortige
Schweizer Aufbauwerk für Entwicklungsländer hin und erwähnte insbesondere die tatkräftige Hilfe durch Schweizer Fachleute. Von 1977 bis 1979 wurde das Haus renoviert.

Kirche Vinelz (1949 bis 1951): Die Kirche von Vinelz stifteten die Grafen von Fenis, die auf der Hasenburg residierten. Sie wurde 1228 erstmals erwähnt.
1542 wurde der Turm angebaut. Zwei prächtige Glasgemälde von 1567 mit dem Berner Wappen schmücken als Kopien die Kirche. Die wertvollen Originale befinden sich im Historischen Museum
Bern.[49] Zu sehen ist auch die Wappenscheibe von Peter im Hag von 1550. Das Wappen zeigt die Initialen «PH» auf rotem Grund und eine weisse Hagrose. Der
ursprüngliche Bau wurde im 15. Jahrhundert erweitert und ist genau nach Osten ausgerichtet.[50] Aus dem 17. Jahrhundert stammen vier Chorstühle, die Kanzel
und die hohen Rundbogenfenster in Schiff und Chor.[62] Mit jedem Umbau wurden die Fenster der Kirche vergrössert, um mehr Tageslicht ins Innere zu
lassen.[50] 1944 beschloss der Kirchengemeinderat die Kirche durch Eduard Lanz einer Gesamtrenovation zu unterziehen. Das Innere war baufällig geworden. Der
Verputz blätterte ab, der Bretterboden und das Täfer waren verfault, Beleuchtung und Heizung mussten verbessert werden, der ganze Innenraum war durch Einbauten so beinträchtig, dass er nicht mehr
den Anforderungen entsprach. Die Renovierung war ursprünglich für 1945/46 geplant. Im Zusammenhang mit Vorstudien kamen im Herbst und Winter 1944/45 an drei Innenwänden des Schiffes Reste
mittelalterlicher Wandmalereien zum Vorschein. Mehrere Malschichten übereinander belegten das Vorhandensein verschiedener zeitlich und inhaltlich von einander unabhängiger Übermalungen, die nach
der Reformation übertüncht worden waren.[62]
Von 1949 bis 1951 renovierte Eduard Lanz die Kirche. Ihm gelang es an der südlichen Aussenwand die verschiedenen Bauphasen und Stile der Romantik-, Gotik und Barock durch Fensternischen und
-bögen sichtbar zu machen, ohne das ausgewogene Gesamtbild der Kirche zu beeinträchtigen.[51]

Im Inneren legte Lanz das zugemauerte Chorfenster wieder frei. Dann verlegte er die Chorempore an die Westwand auf der eine neue Kuhn-Orgel mit elf Registern aufgestellt wurde und stellte das alte Tonnengewölbe wieder her. Die Fresken wurden unter Mithilfe von Hans A. Fischer, Sekretär der kantonalbernischen Altertumskommission und Staatsarchivar, originalgetreu restauriert. Sie sind wegen früherer Fensteröffnungen nicht mehr vollständig. Vom vier Meter hohen Christophorusbild ist nur noch der Kopf und der spriessende Stab erhalten. 1952 entstanden drei Glasfenster des Malers Robert Schär (1894-1973). Zwei Glasfenster tragen die Inschrift «P. Wüthrich Glasmalerei». Unter den Berner Scheiben haben sich die an der Renovation Beteiligten, Architekt Lanz und Zimmermann Gehri, mit ihren Wappen verewigt, die Lanze und Ger zeigen.[48]
In der Kirche Vinelz legte Eduard Lanz die Fresken frei und restaurierte sie.
Die Renovation der 50er Jahre brachte neue Glasfenster. Hier «Der Sündenfall».
Unterhalb des Berner Wappens befindet sich links das Wappen von Eduard Lanz.
Das Schwesternhaus in Bellelay (1950): Das Kloster Bellelay oberhalb von Tavannes wurde 1900 in eine Heil- und Pflegeanstalt umgewandelt. Für die Pflegerinnen war es jedoch problematisch, ihre Freizeit wegen fehlenden Räumlichkeiten auf gleicher Etage mit den Patienten zu verbringen. Der Grosse Rat stellte 1950 für ein Schwesternheim 960‘000 Franken zur Verfügung und beauftragte Eduard Lanz. Sein Bauplan fasste die Bewohnerinnen zu einer familiären Wohngemeinschaft zusammen. Er schuf Raum für 62 Schwestern, die in 53 gemütlichen Einzel- und Zweierzimmern untergebracht werden konnten. Darüber hinaus standen ihnen weitere Ruheräume, Bad, Telefon, Waschküche, Bibliothek, Musikzimmer, Besucherzimmer (nur für Frauen) und eine Turnhalle zur Verfügung. Es konnte am November 1950 als Erinnerung an den verstorbenen Chefarzt und Direktor Dr. Humbert unter dem Namen «Foyer Humbert» eingeweiht werden. [36]
Das 1950 eingeweihte Schwesternhaus «Foyer Humbert» in Bellelay,
Zustand 2023.
Kapelle Magglingen (1959/60): Die Kapelle gehört der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Biel und wurde durch ein Legat der Schwestern Mary, Fanny und Jenny Moser 1919/20 am Kapellenweg 16 erbaut. 40 Jahre später musste die Kapelle restauriert und umgebaut werden. Finanziert wurde das Projekt durch ein Legat von Oberrichter Neuhaus. Architekt und Bauleiter war Eduard Lanz. Sein Kostenvoranschlag von 112‘500 Franken hatte jedoch bei der Finanzkommission keine Chance. Lanz musste nun die Bauarbeiten so weit reduzieren, dass die Bausumme ohne Orgel 80‘000 Franken nicht überstieg. Diesem Beschluss kam er nach, und die Baukommission genehmigte den neuen Kostenvoranschlag im August 1959. Am 28. September 1959 genehmigte der Gesamtkirchenrat die von Eduard Lanz vorgeschlagenen Skizzen und Pläne, sowie die Finanzierung. Die Arbeiten betrafen das Fundament, den Kirchenboden, die Decke, das Dach, den Glockenturm mit der Läutewerk, den Eingang, die Fenster, die elektrische Beleuchtung, die Dachwasserableitung, die Kanalisation und die Umgebung. Auf der Westseite konnten Kanzel, Tauf- und Abendmahltisch platziert werden. Decke, Holzgetäfer und Bänke wurden aufgehellt. Ebenfalls wurde die elektrische Fussheizung abgeändert. Der Spatenstich erfolgte am 12. Oktober1959, die Einweihung in Anwesenheit von Eduard Lanz am 3. Juli 1960.[143]
Kapelle Magglingen, Zustand 2024
Kirche Ligerz/Gléresse (1962/63): Die zwischen Weinreben und Sankt Petersinsel gelegene Hochzeitskirche Ligerz stammt von 1480. Der Turmhelm wies grosse Schäden auf, mit denen sich 1952 Gemeinderat befasste. 1954 traf sich für eine Besichtigung die Seeländer Gruppe des Heimatschutzes. Werner Bourquin, Konservator des Historischen Museums in Biel, und Architekt Eduard Lanz, hielten zwei Vorträge über die Vergangenheit und die Architektur der Dorfkirche. Die Gesellschaft wünschte daraufhin die Restaurierung des Kirchturms.[54] Der Heimatschutz beauftragte Architekt Schweizer in Thun mit einem Gutachten, das nach Feststellung bedrohlicher Schäden eine sofortige Reparatur des Turmhelms forderte. Zu diesem Zweck sollte Eduard Lanz einen Kostenvoranschlag ausarbeiten. Auch der bauliche Zustand des Turmes und des gesamten Kirchengebäudes liess zu wünschen übrig. Die spätgotische Decke des Kirchenschiffs wies Feuchtigkeitsschäden auf. Um die Restaurierung durchzuführen, ergriff Nationalrat Hans Müller von Aarberg die Initiative zur Gründung der «Stiftung für die Erhaltung der Kirche Ligerz», die 1962 ihre Arbeit aufnahm.[74] Unter der Leitung von Eduard Lanz erfolgte zunächst die Restaurierung des Kirchturms. Dabei wurde die Kapelle im Turmerdgeschoss (Turmchor der frühgotischen Kirche) instand gesetzt. Vom Kirchenschiff aus wurde ein neuer Zugang zum Dachboden der Kirche geschaffen, so dass das in der Kapelle durchbrochene Gewölbe wieder geschlossen werden konnte. Eine neue Tür an der Nordseite ermöglichte den direkten Zugang zu dem Raum, der als Taufkapelle oder Warteraum für Hochzeiten vorgesehen ist. Ausserdem wurde das Mauerwerk des Turms neu verfugt. Im Turmhelm mussten mehrere morsche Balken ersetzt werden. Unter Beibehaltung der alten glasierten Ziegel im oberen Teil wurde das Dach neu eingedeckt. Für diese Arbeiten verwendete die Stiftung einen grossen Teil von Spendenbeiträgen. [96] Im Verlauf der Arbeiten drängte sich eine teure Gesamtrenovation auf (Chor, Schiff), die sich ohne die Mithilfe von Lanz Etappenweise auf 20 Jahre erstreckte. Erst 1972 konnten die Arbeiten abgeschlossen werden.

Stadtkirche St. Benedikt in Biel (1967 bis 1971): Sie gehört neben dem Berner Münster zum bedeutendsten sakralen Werk der
Spätgotik im Kanton Bern.Schon bei der Renovation von 1909 bis 1912 unter Architekt Emanuel Jirka Propper (1863-1933) half Eduard Lanz als Zürcher Student während seinen Ferien mit.[3]
1944 sorgte Lanz mit der Hilfe von Initiant Hans Berchtold (1894-1975) und Ernst Schiess dafür, dass die Stadtkirche eine neue Orgel erhielt. Lanz unterstützte das Orgelneubauprojekt mit zahlreichen Vorstudien und bei den architektonischen und baulichen Arbeiten.[28] 1951 erhielt er von der Einwohnergemeinde Biel den Auftrag, die Turmuhr der Stadtkirche und das Vorderdach über dem Zifferblatt zu renovieren. In der restaurierten Uhr konnten Bruchstücke der alten Zeiger integriert werden.[27]
Unterschiedliche Setzungen der Fundamente hatten die Stadtkirche nach und nach gefährdet. Unter der Leitung der Architekten Eduard Lanz und André Meyer fand von 1967 bis 1971 eine umfangreiche Restaurierung statt. Sie brachte eine neuerliche Konsolidierung der Fundamenten durch Zement- und Silikon-Injektionen und des Schiffsoberbaus durch Eisenbeton-Plattenkonstruktionen unter den Seitenschiffdächern.[26] Die Dekors des 17. Jahrhunderts konnten freigelegt und alle Fresken restauriert werden. Die Stadtkirche erhielt einen Keller, einen Steinplattenboden, eine Heizung und einen Archivraum.
Impressionen der Stadtkirche St. Benedikt.

Fabrikbauten
Die «Cosmos Schild & Cie, A.G.» zählte zu den ältesten Fahrradfabriken der Schweiz. Gegründet 1894 in Madretsch, erweiterte Eduard Lanz die Fabrik 1924/25
(Östlicher Längstrakt) und 1933.
1962/63 konnte er für die Inhaberfamilie Junod das Fabrikations- und Bürogebäude der Uhrenmanufaktur Milus an der Reuchenettestrasse 21 erweitern.
Provisorische Bauten für die Bieler Gewerbeausstellung
Die 1933 gegründete Gesellschaft Bieler Woche (BIWO) setzte sich im selben Jahr zum Ziel, erstmals mit einer Gewerbeausstellung in Biel einheimisches Handwerk bekannt zu machen. In einer wirtschaftlich schwierigen Zeit fand die Idee, die Industriestadt Biel quasi unter einem Dach zu vereinen, Anklang. Da die dafür vorgesehene alte und neue Turnhalle Neumarkt nicht ausreichte, erstellte Lanz als «Ausstellungsarchitekt» provisorische offene und geschlossene Hallen. Darin befanden sich u.a. das Bekleidungsgewerbe, die Metallindustrie, die Seiden- und Fahrzeugfabrikation. 1934 folgte die zweite Ausstellung.
Erweiterungsbauten Bezirksspital Biel (1947 bis 1953)
1944 umfasste das Bezirksspital Biel die beiden Häuser Pasquart und Vogelsang, sowie den Tuberkulose- und Infektionspavillon Nadenbousch. 4 nebenamtliche Chefärzte, 1 nebenamtlicher Hilfsarzt, 5
halbamtliche Assistenten und 38 Schwestern betreuten 4070 Patientinnen und Patienten.[108] Im selben Jahr wurde an der Abgeordnetenversammlung der
Spitalgemeinden über das Erweiterungsprojekt im Vogelsang informiert. Ein Legat der 1944 verstorbenen Leonore Rüfenacht-Geiser in der Höhe von 200‘000 Franken ergab, unterstützte dieses Vorhaben.
1945 erfuhr Eduard Lanz erstmals aus der Tagespresse, dass das Bezirksspital Biel ausgebaut werden soll. Zu diesem Zweck beabsichtigte die Spitalkommission, den Spitalbetrieb im Pasquart
aufzuheben und das Gebäude samt Areal an die Stadt zu verkaufen.
Das Spital Vogelsang 1945 und nach der Erweiterung 1953. Fotos: Werner Friedli, Bildarchiv ETH Bibliothek Zürich, Stiftung Luftbild Schweiz, CC BY-SA 4.0
In einem Empfehlungsschreiben an die Direktion des Bezirksspitals führte Eduard Lanz aus: «Als Sohn des früheren Spitalarztes Dr. Emil Lanz und Enkel des damaligen Spitalpräsidenten Dr. Joseph Lanz hatte ich mit meinem Vater an den Studien für die Spitalerweiterung teilgenommen, die er seit Jahren verfolgte und mit grosser Hingabe vorbereitete.»[81] Die Kommission beauftragte jedoch die Zürcher Architekten Fietz und Steiger (Erbauer des neuen Zürcher Kantonsspitals) mit der Planung. Ab 1947 konnte Eduard Lanz doch noch am Spitalneubau mitarbeiten. Die Planausarbeitung erfolgte in Biel im Büro Lanz, die Fertigstellung der Pläne in Zürich durch das Architekturbüro Fiez & Steiger, die Bauleitung durch Schürch und Gfeller. Um die Kosten zu senken, verlangte die Spitalkommission von 43 Spitalgemeinden «die Erhebung eines jährlichen Baubeitrags von 3 Franken pro Kopf der Bevölkerung während 5 Jahren, beginnend 1948.»[82] Die Bauarbeiten dauerten von Dezember 1948 bis 1953. Am 16. Januar 1950 erfolgte der Spatenstich für den Bau «Vogelsang West» und am 12. Februar 1953 die Einweihung. Damit konnte das Pasquart-Spital aufgelöst werden.[105] Alle Abteilungen befanden sich nun im Spital Vogelsang. Bei der Eröffnung übereichte Architekt R. Steiger symbolisch den Schlüssel. Der Erweiterungstrakt umfasste 60 Patientenzimmer mit 145 Betten. Alle Krankenzimmer waren nach Süden ausgerichtet, die Nebenräume und Isolierzimmer nach Norden. Im untersten Stockwerk konnte die Geburtsabteilung untergebracht werden. Darüber folgten die Gynäkologie und die Ausgleichsstation. Die dritte und vierte Etage blieben der Chirurgie vorbehalten, während die oberste Etage die notwendige Aufstockung der Privatbetten ermöglichte. Im Operationstrakt befanden sich die Poliklinik, ein Röntgenraum und ein Labor. Im südlichen Vorbau befanden sich im Erdgeschoss das Schwesternzimmer und im ersten Stock der Gottesdienstraum (später mit Orgel). Alle Räume waren ventiliert, die Patientenzimmer durch Deckenstrahlheizung erwärmt und die Nebenräume durch Radiatoren beheizt. Das Spital verfügte nun über insgesamt 336 Betten.[106] Es waren 240 Personen beschäftigt, die durchschnittlich 300 Patienten pflegten.[107]
Pechsträhnen und Frustration
Viele Architekturentwürfe von Eduard Lanz blieben zu seinem Bedauern unrealisiert. Bei Planungswettbewerben musste er manche Niederlange einstecken. Auch war es ihm
fast nie vergönnt, mit städtischen oder staatlichen Bauaufgaben betraut zu werden. Einige seiner Projekte konnte er nur mit Kompromissen seitens der Bauherren verwirklichen.
Nicht realisiert: Für den Entwurf «Bielbatze» zum Gebäude der Ersparniskasse Biel, 1928, erhielt Eduard Lanz den Preis ex acquo (Fr. 120.-). Die
Jury entschied: «Das Gebäude ist mit der Schmalseite gegen die Strasse gerichtet. Diese Situierung ergibt einen schönen Zugang zum Gebäude und genügend Umschwung um das Haus. Der Haupteingang zum
Gebäude ist aber von der monumentalen Hauptaxe in die Ecke abgerückt, was zu Disharmonie führt. Der Wohnungseingang ist an die Nordfassade verlegt, was mit Rücksicht auf die Übersichtlichkeit
nicht zu empfehlen ist. Ganze Grundrissanlage des Erdgeschosses gut. Tresortreppenanlage falsch disponiert. Souterrain im allgemeinen gut. Disposition des 1. Stockes gut. Architektur der vier
Fassaden zu reich. Das Repräsentative in der Architektur sollte auf die Strassenfassade beschränkt bleiben.» (Text/Foto: Schweizerische Bauzeitung, Nr. 13, 1928, S. 163f)
Nicht realisierte Entwürfe (Auswahl)
- 1928: Entwurf «Bielbatze» für den Neubau eines Kassengebäudes der Ersparniskasse Biel. 2. Platz.
- 1930/38: Entwurf für einen Erweiterungsbau des Museums Neuhaus (NMB).
- 1933: Entwurf «Trio» für ein neues Post- und Bibliotheksgebäude auf dem Neumarktplatz in Biel.
- 1935: Entwurf für das «Volkshaus in Thun». 2. Platz.
- 1937: Entwurf «Einkehr» für die Kirche und das Kirchgemeindehaus Mett-Madretsch. 1. Platz. Der Wettbewerb wurde für ungültig erklärt.
- 1949: Wettbewerb «Primarschulhaus mit Turnhalle und Kindergarten in Biel-Mett». 5. Platz.
- 1950: Wettbewerb zur «Erweiterung der Primar- und Sekundarschulen mit Turnhalle in Lengnau (BE)». 2. Platz.
Weitere Niederlagen nahm er mit seinen vielen architektonischen Ideen, dem Kampf um die Erhaltung historischer Bauten und sozialen Anliegen in Kauf:
- Erweiterung vom NMB: Als Mitglied der Bieler Museumskommission setzte er sich für eine bauliche Erweiterung vom Museum Schwab ein, das an Platznot litt. 1938 legte er dazu mehrere Projektskizzen vor. Der Gemeinderat lehnte jedoch den Kauf von zusätzlichem Bauland ab und seine Pläne wurden nicht realisiert.
- Ausbau der «Alten Krone» in Biel zu einem Kunstmuseum: Ein Projekt mit dem er sich länger vergebens beschäftigte.
- Riegelhaus am Seilerweg 62: Er reagierte sofort, als er erfuhr, dass der Stadtrat 1969 eine Telefonzentrale in Madretsch erstellen wollte, das den Abriss eines 1830 erbauten Riegelhauses erforderte. Als Sprecher des Heimatschutzes setzte sich Eduard Lanz zusammen mit dem Lindenquartierleist für den Erhalt des schönen Bauernhauses ein. Lanz stellte fest, dass der Riegelbau zwar nicht denkmalschutzwürdig sei, aber an eine Zeit erinnere, als Madretsch noch aus Äckern und Wiesen bestand. Das Haus bilde einen schönen und passenden Strassenabschluss gegenüber dem Schulhaus und solle deshalb so erhalten bleiben. Eine Petition der Bewohner des Lindequartiers brachte 320 Unterschriften. Der Abriss konnte leider nicht verhindert werden.[99]
- Initiative für das Frauenstimmrecht: 1953 wurde eine Initiative gestartet, die erneut das Stimm- und Wahlrecht für Frauen im Kanton Bern
verlangte. Dem Bieler Initiativkomitee gehörten u.a. Eduard Lanz, Stadtpräsident Baumgartner und der ehemalige Stadtpräsident Guido Müller an. Sie kümmerten sich um die Unterschriftensammlung und
die Sensibilisierung für das Frauenstimmrecht. Am 17. Juli 1953 wurde die Initiative der Regierung übergeben. 1956 lehnte die Mehrzahl der Stimmberechtigten vom Kanton Bern die Vorlage
ab.[98]
Eduard Lanz als Technikums-Lehrer und Ausbilder
Im Schuljahr 1933/34 amtete Eduard Lanz am Bieler Technikum in der Fachkommission für Bautechnik und als Hilfslehrer für bautechnische Fächer. Er unterrichtete in den Bereichen Hochbau, Entwerfen
und Berechnen einfacher Bauten, Konstruktions- und Detailpläne, Statik und Eisenbetonbau. In seinem Bieler Architekturbüro nahm er mehrere Lehrlinge des Technikums auf.
Grabungen in Petinesca (1937 bis 1939)
Der Verein Pro Petinesca hatte 1904 unter der Mitwirkung von Emil Lanz-Blösch die Ausgrabungen in dieser alten römischen Siedlung abgebrochen. Allerdings war Petinesca bei weitem nicht
vollständig erschlossen. In der Krisenzeit von 1937, die mit grosser Arbeitslosigkeit verbunden war, beschloss Eduard Lanz aus archäologischem Interesse, die Ausgrabungsarbeiten in Petinesca
wieder aufzunehmen. Um die Wichtigkeit dieses Projekts zu unterstreichen, zeichnete er eine archäologische Karte, die er an verschiedenen Sitzungen vorstellte. Für die Durchführung schwebte
Lanz ein freiwilliges Arbeitslager vor. Nach mehreren Gesprächen mit dem Präsidenten des Museums Schwab und Vertretern der Gemeindebehörden konnte das Arbeitsamt Biel für die Durchführung
gewonnen werden. Lanz war nach eigenen Worten «Vermittler zwischen Museum und Arbeitsamt».[84] Nun konnten im Rahmen des Archäologischen Arbeitsdienstes neue
Grabungen in Petinesca durchgeführt werden. Als Mitglied der Ausgrabungskommission richtete Eduard Lanz den freiwilligen Arbeitsdienst (FAD) mit 20 arbeitslosen Helfern ein. Damit führte die
Gemeinde Biel erstmals ein FAD-Lager durch. Nicht alle waren begeistert, unqualifizierte Arbeitslose 7 Monate lang mit subtilen wissenschaftlichen Grabungsarbeiten zu beschäftigen. Die Verwaltung
und Organisation übernahm das Arbeitsamt Biel. Am 5. Mai 1937 bewilligte der Bieler Gemeinderat das Arbeitsdienstlager und einen Höchstbetrag von 4100 Franken für die Grabarbeiten. Den
Mitarbeitern stand ein gemütliches Bauernhaus in Oberstuden zur Verfügung. Der Arbeitsdienst Petinesca stand unter der Aufsicht einer 18-köpfigen Kommission, bestehend aus Vertretern des Bundes,
Kantons, der Museen Bern und Biel, sowie technischen Mitarbeitern und Vertretern der Gemeinde Biel und wurde von Professor Dr. Otto Tschumi präsidiert.[33]
Träger der Ausgrabungen war das Museum Schwab mit Werner Bourquin als Präsident.
Die Ausgrabungen begannen nicht bei der Torturmanlage auf der Grubenmatte, wo damals Emil Lanz und seine Mitarbeiter forschten. Aufgrund der zahlreichen römischen Münzfunde von 1870/72 am
Südosthang des Jensbergs setzte die Grabungsleitung den Spaten am Gumpboden an. Schon bald stiess man dort auf eine gallorömische Tempelanlage mit 7 Tempeln, 2 Kapellen, einer Umfassungsmauer und
einem Mehrzweckgebäude. Eduard Lanz informierte die Besucher regelmässig anhand alter und neuer von ihm gezeichneter Pläne über die Ausgrabungen und Funde. Freigelegt wurde ein 200 Meter langes
Stück der aus Tüscherzstein gemauerten Umfassungsmauer.
Zum Vorschein kamen Münzen, Tongefässe und Fibeln (Nadeln, mit denen die Römer ihre Kleidung zusammenhielten). Im Schulhaus Studen entstanden die Pläne, die jede Phase der Ausgrabung und jeder
Stein vermerkte. Schwierigkeiten bereitete ein Waldbesitzer, der die Grabungen verweigerte.
Im Bieler Tagblatt vom 9./10. September 1937 veröffentlichte der bekannte deutsche Prähistoriker Gerhard Bersu (1889-1964), erster Direktor des Deutschen Archäologischen Instituts, ein
ausführliches Gutachten über «Petinesca und der Jensberg». Am 15. November 1937 fand die Abschlussfeier des freiwilligen Arbeitsdienstes statt. Die guten Erfahrungen mit dem Arbeitsdienstlager
veranlassten den Bieler Gemeinderat für den Sommer 1938 einen zweiten Arbeitsdienst zu bewilligen.
Von 1938 bis 1941 gehörte Eduard Lanz der Bieler Museumskommission an. Im Sommer 1938 konnte die Torturmanlage in der Grubenmatt nach Plänen von Lanz in Biel renoviert werden und so vor dem
völligen Verfall gerettet werden. In dieser Zeit wirkten die Mitarbeiter von Petinesca für kurze Zeit als Statisten im Film «Füsilir Wipf» mit. Am 10. Dezember 1938 fand die Aufrichtung des
Tempels II auf dem Gumpboden statt. Nirgendwo sonst in der Schweiz wurde bisher ein gallo-römischer Tempelbezirk von dieser Grösse und Geschlossenheit gefunden. Nach den Plänen von Eduard Lanz
wurde für den Tempel ein Schutzdach errichtet. Der Tempelbezirk wurde durch Steinplatten erkenntlich gemacht. Ein Stück der grossen Umfassungsmauer konnte konserviert werden.
Anfang Februar 1939 erfolgten die Vorbereitungen für das Relief des Seelandes und den angrenzenden Gebieten im Massstab 1:25‘000 und der Umzug des Büros der T.A.D. Petinesca (Kantonales
Arbeitsamt) vom Schulhaus Studen ins Bieler Technikum. Die Ausgrabungen im Hinterberg förderten eine Herdstelle, verschiedene Mauerwerke und den quadratischen Unterbau eines nach Osten
ausgerichteten Gebäudes ohne Anbau zu Tage. Durch die allgemeine Mobilmachung verkleinerte sich das Arbeitslager und musste aufgegeben werden.[83]
Der archäologische Arbeitsdienst Petinesca schloss am 31. Oktober 1939 seine Grabungen mit einer Ausstellung der Arbeiten, sowie der Funde, Pläne und Modelle von Petinesca im Museum Schwab ab,
die besonders durch Schulen viel Beachtung fand. Nachdem die Reliefs des Tempelbezirks und der Torturmanlage an der Schweizerischen Landesausstellung gezeigt worden waren, wurden sie dem Museum
übergeben. Das Museum Bern wünschte für seine Mitarbeit Dubletten und Fundkopien der wichtigsten Fibelfunde aus Petinesca.
Eingang der Tempelanlage Petinesca am Gumpboden.
«Tempel 1» von 9 Tempeln.
Standort eines Mehrzweckgebäudes, in den 1930er Jahren «Priesterhaus» genannt.
Mitglied in vielen Kommissionen
Eduard Lanz war Präsident des Schweizerischen Verband für Wohnwesen der Sektion Bern, 1926/27 Vorstandsmitglied der Eisenbahnerbaugenossenschaft Biel und trat 1928 dem Bund Schweizer Architekten» (B.S.A.) der Sektion Bern bei. 1929 trat er dem Historischen Verein des Kantons Bern bei. Zusammen mit Schwester Margrit war er Mitglied der Schweizerischen Gesellschaft für Urgeschichte. Er war Mitglied der Bieler Museumskommission, der «Kommission für die Prüfung der Erwerbung von Gemälden aus dem Nachlass des Malers Robert» und der «Schweizerischen Vereinigung zur Erhaltung der Burgen und Ruinen». 1938 initiierte und gründete er mit einigen Geschichts- und Naturfreunden den seeländischen Verein für Heimatforschung.
Seit Jahrzehnten Mitglied des Schweizer und Berner Heimatschutzes, ging die Gründung einer Bieler Sektion auf seine Initiative zurück. Bis 1970 stand Eduard
Lanz der Regionalgruppe vom Heimatschutz als Obmann vor und wirkte danach weiterhin als Bauberater für die Altstadt Biel und als Vorstandsmitglied. 1966 ehrte ihn die Stadt Biel mit dem
Kunstpreis.
«Mit der Bieler Altstadt fühlte sich Eduard Lanz immer besonders verbunden,
und im Kreis des Altstadtleistes fühlte er sich sehr wohl.»
Dora Lanz-Grütter, Ehefrau von Eduard Lanz
Eduard Lanz, Liebhaber der Bieler Altstadt
Eduard Lanz trug
wesentlich zur Erhaltung, Verschönerung und Belebung der Bieler Altstadt bei. Als in den 1930er Jahren der Rest des Stadtgrabens überbaut werden sollte, konnte dies dank dem Veto von Lanz
verhindert werden.[8] Um der herrschenden Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken und den Bieler Handwerkern Arbeit zu verschaffen, beschloss die BIWO 1935, die
Altstadt unter Beizug mehrerer Architekten zu renovieren. Lanz wurde für die Untergasse, das Kirchgässli und den Ring eingeteilt. Die Verschönerung der Altstadt erfolgte unter Einbezug der
Hauseigentümer, die 50 Prozent der Kosten übernahmen. Zu den Eigentümern gehörte auch seine Mutter Maria Julie Laura Lanz-Blösch, die in der Untergasse/Schmiedengasse 10 wohnte. Als Vermittler
zwischen der BIWO und den Hausbesitzern fungierte der Altstadtleistpräsident Eduard Amsler. Die Beendigung der ersten Bauetappe feierte man mit der 1. Altstadtchilbi. Lanz renovierte in der
zweiten Bauetappe die Altstadt vom 1. April bis 15. Juni 1936 mit 120 Arbeitern und schloss damit das Projekt ab.[23]
Das 1577 von der Abtei Bellelay errichtete Abtenhaus an der Untergasse 21, konnte Lanz mit Hilfe der Genossenschaft BIWO stilgerecht renovieren. Dadurch wurde das
Gebäude 1936 in das kantonale Inventar der Kunstaltertümer aufgenommen. Unter Denkmalschutz stehen: 1) Erker und Fassade gegen die Untergasse mit Fenstereinfassungen aus dem 17. Jahrhundert,
Rippengewölben und Bauskulpturen. 2) Treppenturm mit Türeingang aus dem 16. Jahrhundert mit Abdeckung.[25]
An der Stelle der ehemaligen «Villa Rosière» baute Lanz 1940/42 für die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Biel an der Mühlebrücke das «Wyttenbachhaus».1942
erstellte er die ehemalige Amtswohnung des 1. deutschen Pfarrers am Ring 4 unter Verwendung älterer Substanz neu. 1955 kaufte die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde die Liegenschaft, die Lanz
für die Kirchgemeinde ausbaute und nutzbar machte.[30] 1948 vergrösserte er für den Apotheker Carl Frei die südliche Schaufensteranlage der Apotheke Stern.
Sie befand sich von 1914 bis 1971 an der Schmiedengasse 9/Rathausgässli 1.
Umbauten für das Kirchgemeindehaus, Ring 4 und für die ehemalige Apotheke Stern, Schmiedengasse 9
Genossenschaft Venner-Haas-Turm
1402 wurde der ehemalige Wehrturm aus den Steinen der 1367 zerstörten Burg erbaut und im 17. Jahrhundert bekannt, als der Mathematiker Jakob Rosius darin seine astronomischen Studien durchführte. So nennt man ihn auch Rosiusturm. In den 1940er Jahren musste der Turm dringend renoviert werden. Sein Besitzer, die Familie Haag, verkaufte ihn an die «Genossenschaft Venner-Haas-Turm». Ab 1945 war Eduard Lanz Vizepräsident dieser Genossenschaft und nach dem Tod von Fritz Haag ab 1955 Präsident. Die Genossenschaft bezweckte den Kauf des Venner-Haas-Turms, dessen Instandsetzung, Erhaltung, Unterhalt und Nutzung als Lokal der Pfadfinderabteilung «Orion» in Biel. 1945/46 steuerte die Staatsverwaltung des Kantons Bern zur Kunstaltertümerpflege Fr. 2000.- an die Ausbauarbeiten des Turmes.[52] Lanz hatte nun die Möglichkeit, mit den Pfadfindern den Turm zu verschönern. 2006 schenkte die Genossenschaft den Turm der Stadt Biel.
Der Venner-Haas-Turm auf einem Plan von Eduard Lanz.
Foto: Archiv Altstadtleist
Blick vom Rosius-Platz.
Titelbild der Statuten der Genossenschaft Venner-Haas-Turm.
Foto: Archiv Altstadtleist
1952 erstellte Eduard Lanz am Rosiusplatz einen Verbindungsbau von Archiv- zum halbrunden Gefängnisturm. Die Vorderseite ist eine Rekonstruktion der abgetragenen mittelalterlichen Verbindungsmauer. Die Rückseite erhielt im Erdgeschoss einen Zellentrakt der Stadtpolizei, im 1. und 2. Obergeschoss einen Balletsaal und weitere Räume für den Theaterbetrieb. Sein grösstes Projekt war die Renovierung der Stadtkirche in Zusammenarbeit mit dem Architekten André Meier. Die Geschichte der Stadtkirche dokumentierte Eduard Lanz 1963 zusammen mit Hans Berchtold, in der Monographie «500 Jahre Stadtkirche Biel».
Vorderseite Verbindungsbau mit mittelalterlichem Aussehen.
Rückseite vom Verbindungsbau.
Präsident und Ehrenmitglied vom Altstadtleist
Eduard Lanz war von 1939 bis 1947 Präsident vom Altstadtleist. Viele Jahre wirkte er Vorsitzender und Obmann der Leist-Baukommission. 1955 wählte man ihn zum Ehrenmitglied.
Eduard Lanz (links aussen) am Altstadtleist-Pic-Nic 1969.
Foto: Archiv Altstadtleist

1935 gründete Eduard Lanz zusammen mit Technikumsdirektor Hans Schoechlin und dem Leistpräsident Eduard Amsler die Altstadtchilbi. In den folgenden Jahren förderte Lanz die Chilbi mit neuen Veranstaltungsideen
oder nutze sie als Architekt und Lokalhistoriker, um den Besuchern die Architektur und Geschichte der Altstadt mit Führungen und Ausstellungen näher zu bringen.
Am August 1939 wählte der Altstadtleist Eduard Lanz, als Nachfolger des zurückgetretenen Caesar Zimmer, zum neuen Leistpräsidenten. Lanz befasste sich in seiner neuen Funktion sofort mit der Korrektion Rosiusstrasse-Brunngasse-Schützengasse, wobei
verschiedene Wünsche zur Gestaltung des Rosiusplatzes sowie des Platzes bei der Station Leubringerbahn unter Einbezug der Römerquelle geäussert wurden.[60]
Kriegsjahre
Die Altstadtchilbi 1939 war sehr gut vorbereitet. Auf dem Programm standen Alphornbläser, Fahnenschwinger, Ländlerkapellen, Kunstradfahrer, ein Trachtenmarkt und ein
Marktfrauendorf. Doch die Chilbi fand nie statt. Eduard Lanz: «Wegen der Kriegsmobilmachung wurde die Altstadtchilbi auf unbestimmte Zeit verschoben. Etwas später mussten die meisten von
uns zur zweiten Generalmobilmachung (10. Mai 1940) einrücken und noch im selben Monat brach der holländische, belgische und französische Widerstand zusammen. Nachdem zwei Tage lang
Zivilinternierte unsere Stadt passierten, überschritt kurz darauf ein französisches Armeekorps die Grenze. Unter dem furchtbaren Eindruck der Ereignisse fällt es schwer über unsere Tätigkeiten zu
berichten, die unter der Kriegszeit litt.»[69]
In der Altstadt wurde provisorisch ein Luftschutzausgang bei den Rosiustürmen gebaut. Am Chlauser 1939 konnten die Bieler Stadtmusikanten für die Turmmusik gewonnen werden.[63] Während der Kriegsjahre fand der Chlauser ohne dazugehörigen Markt statt, da es den Weggen- und Zuckerbäckern an Mehl und Zucker mangelte. 1940 waren 4
Vorstandsmitglieder im aktiven Dienst.[69] Die Generalversammlung vom Altstadtleist im Hotel Weissen Kreuz am 8. März 1941 stand im Zeichen der Solidarität.
Lanz konnte die Leistfamilien möglichst vollzählig versammeln. Für den Imbiss der ihnen gereicht wurde, übernahm die Kasse (in Absprache mit der Kriegswirtschaftszentrale Altstadt) zwei Rationen
pro Leistfamilie.[64]
Am Chlauser vom 9. Dezember 1941 organisierte Lanz eine schöne Kinderbescherung und im Namen vom Altstadtleist einen Altstadtkameraden-Treff in der Bielstube, das emotionale Eindrück hinterliess. Als «Altstadtkameraden» werden diejenigen bezeichnet, welche in der Bieler Altstadt geboren und/oder aufgewachsen sind.[70] So bedankte sich Werner Boll am 3. Januar 1942 in einem Brief an Eduard Lanz: «Welcher Zeitpunkt wäre geeigneter, als der alte überlieferte Bieler Chlauser, um unter uns Altstädtlern den Kameradschaftsgeist zu pflegen, ungeachtet der politischen Wirren. Ich hoffe dass diese schöne Geste zur Tradition wird.» An der Generlversammlung vom 16. Juli 1942 orientierte die Beratungsstelle Biel über die Luftschutzbauten in der Altstadt. Anschliessend wurde im Restaurant Rathaus in Anwesenheit des Feuerwehrkommandanten Geitlinger der Film «Füür im Huus» (Feuer im Haus) gezeigt.[67] Zu den Aufgaben von Lanz gehörte es auch, dafür zu sorgen, dass der Altstadtleist den obligatorischen Wehropferbetrag bezahlte.
Am 27. März 1943 führte Eduard Lanz den Leistmitgliedern im Hotel Kreuz eine Reihe von Armeefilmen in 16 mm vor. Sie trugen die Titel: «Handstreich»,
«Kanalüberquerung», «Kriegshundedienst» und «Skipatrouillen».[68] Am 19. November 1943 erhielt Eduard Lanz folgenden Brief: «Die Anwohner der Juravorstadt
und der Untergasse wären Ihnen dankbar, wenn Sie sich als Präsident unserer Altstadt folgender Sache annehmen würden: Schon seit längerer Zeit verbrennt die Färberei der Gebrüder Fischer einen
mit Benzin getränkten Kohlenstaub. Leider entsteht dabei einen Russ, der die ganze Umgebung schwarz macht. Die Strassen sehen aus wie in einem Gaswerk. Unsere schönen Fassaden, wo wir erst vor
kurzem gestrichen haben, werden bald ganz schwarz. Die Dächer werden so voller Russ, dass im Winter die Dachkänel verstopfen und wird die Rechnung vom Dachdecker bezahlen müssen. Wir wären Ihnen
dankbar, wenn Sie etwas unternehmen könnten.»[66] Ob Lanz in dieser Sache etwas unternahm, liess sich nicht feststellen, jedoch waren die Gebrüder Fischer
Mitglieder vom Altstadtleist. Zur Generalversammlung 1944 Mitglieder aufzubieten, scheiterte durch Einberufung des Präsidenten, Kassierers oder Sekretärs. Ein Grossteil des Vorstands befand sich
im Aktivdienst.[65]
Kreatives Vorstandsmitglied
1947 wurde Coiffeurmeister Fritz Schänzli Präsident vom Altstadtleist, während Lanz dem Leist als Vorstandsmitglied treu blieb. 1948 fand nach 10 Jahren wieder eine Altstadtchilbi statt, an der Eduard Lanz die Besucher auf die Schönheit und Sehenswürdigkeiten der Altstadt aufmerksam machte. 1949 führte er zusammen mit Fritz Schänzli an der Chilbi die Bieler Tradition des Armbrustschiessens wieder ein. 1950 konnte dafür ein geeigneter Schiessplatz mit einem von Lanz erbauten Schützenhaus zur Verfügung gestellt werden. Um Jugendliche und Erwachsene für diesen Sport zu begeistern, stellte der Altstadtleist eine stattliche Zahl eigener Armbrüste zur Verfügung. Der beste Schütze erhielt den von den Altstadt-Geschäftsleuten gestifteten Wanderpreis, auf dem der Name des Gewinners eingraviert wurde.[6] Um diesen Sport zu fördern, beschloss das Schiesskomitee des Leistes 1951 die Gründung einer Armbrustschützengesellschaft mit Eduard Lanz als Vizepräsident. 1954 erweiterte Lanz den Schützenstand auf 8 Scheiben für kniendes und stehendes Schiessen. 1956 verkaufte der Leist das Schützenhaus mitsamt Inventar und Scheibenstand an die Armbrustschützen Biel (ASG).[29]

Erforschung der Römerquelle
Die Römerquelle war der wichtigste Faktor zur Entstehung der Stadt Biel. Im trockenen Sommer 1947 entschlossen sich Eduard Lanz und Fritz Schänzli den unterirdischen Verlauf der Römerquelle zu erkunden und dabei ihre Vermessungsarbeiten zu dokumentieren. An der Altstadtchilbi 1954 präsentierten sie dieses Material in der Ausstellung «Bilder zur Erforschung der Römerquelle» erstmals der Öffentlichkeit. Ab diesem Zeitpunkt wurde die Chilbi von der Bevölkerung nicht mehr nur als unterhaltsames Volksfest wahrgenommen.
Altstadtchilbi-Ausstellungen von Organisator Eduard Lanz:
21. 08. / 22. 08. 1954
18. 08. / 19. 08. 1956
12. 08. / 23. 08. 1964
21. 08. / 22. 08. 1965
Bilder zur Erforschung der Römerquelle»
«Einst und jetzt»
«Die Bieler Altstadt wie sie war»
«Die Bieler Altstadt in Wort und Bild»
Römergässli
Römergässli
Kunsthaus, Ring 8
Alte Krone, Obergasse
Einige Bilder dieser Ausstellungen sind heute im Altstadtleistlokal an der Brunngasse 9 zu sehen. An der Chilbi 2015 erhielten die Besucher anlässlich des Jubiläums
«100 Jahre Altstadtleist/80 Jahre Altstadtchilbi» durch den Altstadtleist-Archivar Heinz Strobel erneut Gelegenheit, sich an der von Lanz und Schänzli entstandenen Dokumentation der Römerquelle
zu erfreuen.[19]
Als Vorsitzender und Obmann der Baukommission vom Altstadtleist setzte Eduard Lanz sich ehrenamtlich für die Erhaltung des 1936 renovierten Altstadtbildes ein. Die Fachkommission diente zur
Entlastung und Beratung des Leistvorstandes. 1954 berichtete Lanz: «Die Spezialkommission beratet die Grundeigentümer bei Fassadenrenovierungen oder vor dem Anbringen von Aushängeschildern,
Reklametafeln und Aufschriften. Sie behandelt die von der Bau- und Polizeidirektion zur Begutachtung überwiesenen Eingaben und leitet sie den Gesuchstellern weiter. Leider konnte die anlässlich
der BIWO beabsichtigte Innenrenovation nicht gefördert werden. Sie sind nicht denkbar ohne weitgehende Hilfe durch die öffentliche Hand.»[18] Unterstützung
erhielt Lanz durch die Mitglieder der Kommission: BIWO-Initiant Hans Schoechlin, Babtiste Dominiconi, Hermann Scherler und Hermann Hostettler.
Auf Anregung von Eduard Lanz beteiligte sich der Leist 1961 mit einer Spende an der Sammelaktion «Biel hilft Afrika» im Dienste der Entwicklungshilfe. Ende Jahr überwies die Stadt Biel mit Hilfe
der Bevölkerung 50‘000 Franken an das Ausbildungszentrum in Dar-es-Salaam (Tanganjika), der Mittelschule in Bali (Südkamerun) und an die Lehrwerkstätten in Tunesien.[44]
1967 kümmerte er sich um die Reparatur der Uhr der Stadtkirche. Da er auch alle anderen Turmuhren der Altstadt reparieren lassen wollte, beantragte er 1971, dass der Leist die im Stadtrat
laufende Motion betreffend Renovation der Uhr des Zeitglockenturms unterstützt.
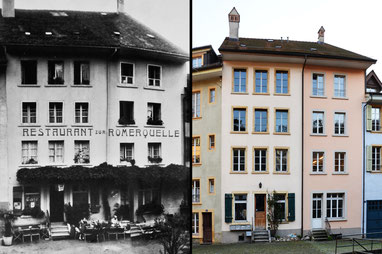
1967 wurde anlässlich eines Kirchenkaffees von Vertretern der Studentenseelsorge das Thema «Studentenheim» angesprochen. Die Schüler des Gymnasiums, des Kantonalen Technikums und der Handelsschule sollten einen gemeinsamen Treffpunkt erhalten. Bei dieser Besprechung war auch Eduard Lanz anwesend, der sich schon seit längerer Zeit mit der Ausarbeitung eines solchen Projektes beschäftigte. Gemeinsam wurde am 17. November 1967 ein Initiativkomitee für den «Verein zur Förderung des Foyers Römerquelle» aufgestellt, dem Vertreter der Kirchen, Schulen, Behörden und Bieler Vereinigungen angehörten. Zu diesem Zweck sollten die Liegenschaften Brunngasse 5 und 7 umgebaut werden. Am 23. November beschlossen die Leistmitglieder für die 1. und 2. Etappe je Fr. 2‘000.- zu spenden, mit der Auflage, bei der Warenbeschaffung nach Möglichkeit die Altstadtgeschäfte zu berücksichtigen. Der Architekt André Meier arbeitete in Zusammenarbeit mit Eduard Lanz ein Projekt aus, das folgende Einrichtungen vorsah: im Keller zwei Räume, davon einer für Musik; im Erdgeschoss eine Mensa und zwei Picknickräume; im 1. Stock drei Klubzimmer und Nebenräume.[35] 172 Studenten arbeiteten an dem Projekt. Nach Umbauten von 3 Monaten, konnte das Studentenheim 1968 eröffnet werden. Der Foyerbetrieb wurde 1989 eingestellt.
30 Jahre nachdem Eduard Lanz im Auftrag der BIWO die Altstadt mitrenoviert hatte, stand er sozusagen wieder am Anfang seiner Bemühungen. Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre waren die damals bunten Fassaden verwittert, einigen Häusern drohte mangels Unterhalt der Abbruch. Moderne Geschäftshäuser sollten die historischen Altstadthäuser ersetzen. Wieder einmal galt es, die Altstadt zu schützen und zu sanieren. Da der Stadtbaumeister wenig Verständnis für die Belange der Altstadt aufbrachte, wollte der Altstadtleist 1968 selbst eine Bauordnung für die Altstadt erarbeiten. Eduard Lanz besass zur Orientierung verschiedene Altstadtreglemente. Er wollte in einer Kommission ein Reglement erstellen und dieses dem Stadtbauamt vorlegen. Der Kommission gehörten Architekt Henri Dubuis (1906-2003) als Präsident, Eduard Lanz, Paul Lüthi und Hermann Hostettler an. Dubuis hatte in den 1930er-Jahren im Architekturbüro von Eduard Lanz» gearbeitet und unter dessen Leitung am Bau des Volkshauses mitgewirkt. Seither waren sie befreundet. [40] 1969 sollte das historische Haus Untergasse 45, das ehemalige Spital, vollständig abgerissen und neu aufgebaut werden. Der Leistpräsident und seine beiden Architekten hatten Bedenken gegen dieses Projekt. Zumindest die Fassade sollte in der bisherigen Form erhalten bleiben. Lanz und Dubuis wurden beauftragt, im Namen des Leistes Einsprache zu erheben. Lanz erhob auch im Namen des Heimatschutzes erfolgreich Einsprache.[41]
Im April 1971 feierte Eduard Lanz im Spital als Patient seinen 85. Geburtstag.[43] Kaum hatte er sich von der Operation erholt, wurde er im Leist mit einem Projekt «zur Rettung der Altstadt» konfrontiert. Die FBB-Stadträtin Marlise Etienne lancierte eine Volksinitiative unter dem Motto: «Treffpunkt Altstadt». Die Initiative richtete sich insbesondere gegen die geplante Erweiterung des «Kaufhaus Burg». Für dieses Warenhausprojekt sollte die historische Häuserzeile Schmiedengasse-Rathausgässli abgebrochen werden. Das Altstadtbild wäre zerstört worden. Etienne informierte den Leist in einer Vorstandssitzung über die Initiative, die der Vorstand sofort unterstützte.[42] Dem Patronatskomitee der Initiative gehörten u.a. Eduard Lanz, Henri Dubuis und Fritz Bühler (Architekten), Paul Lüthi (Altstadtleistpräsident), Fritz Schaenzli (Ehrenpräsident Altstadtleist), Hans Schöchlin (Alt-Technikumsdirektor) und Dr. Marcus Bourquin (Stadtarchivar) an.[61] Die Initiative kam schliesslich mit 4900 Unterschriften zustande. Lanz hielt den Leist stets über deren Fortgang auf dem Laufenden, bis er am 19. November 1972 mit 87 Jahren verstarb. An der Vorstandssitzung vom 29. November 1972 ehrte ihn der Leist durch Erheben von den Sitzen.
Schriften (Auswahl):
«Wohnungen für Kinderreiche Familien in Biel» in Schweizerische Zeitschrift für Wohnwesen (Zürich, Januar 1927), «Die Stadtanlage in Vergangenheit und Zukunft:
Stadtentwicklung und Kleinwohnung» (Biel, 1927), «Siedlung Möösliacker für kinderreiche Familien in Biel» in Das Wohnen, Nr. 11, (Zürich, 1928), «Habitations pour familles nombreuses» in
Habitation, Nr. 10, 1931), «Das neue Bieler-Volkshaus» in Bieler Jahrbuch/Annales Biennoises 1933, (Biel, 1933), «Colonie im Möösli, à Bienne in Habitation (Lausanne, Januar/Februar 1945), «Zur
Baugeschichte des Inselhauses» in St. Petersinsel: J.-J. Rousseau (Biel, 1946), «Einiges zur baulichen Entwicklung der Stadt Biel» in 50 Jahre Haus- und Grundbesitzerverein Biel und Umgebung
1903-1953 (Biel, 1954), 500 Jahre Bieler Stadtkirche (Biel, 1963)
Nachlässe
Zahlreiche Dokumente befinden sich im «archives de la construction moderne» der École polytechnique fédérale in Lausanne (epfl). Dieser Nachlass wurde von Sylvain Malfroy, inventarisiert, der im
Bieler Jahrbuch 1995 die Genossenschaftswohnungen von Eduard Lanz beschrieb. Der ETH-Zürich überreichte Annemarie Geissbühler-Lanz 44 Kollegehefte (Mitschriften) aus dem Studium der Architektur
(u.a. Prof. Schüle, Herzog, Rahn, Lasius) 1905-1909/10; sowie Kopien diverser Arbeits- und Schlusszeugnisse (u.a. ETHZ, Akademie der Künste, Berlin).
Literaturtipps
«Eduard Lanz 1886-1972. Rot und schwarz: lokale Architektenkarriere und internationales Selbstverständnis», Nathalie Ritter, Dissertation, Bern, 2011
«Eduard Lanz - Bieler Architekt des sozialen Bauens», Christoph Lanz, Regionale Fachverbände und Stadt Biel, ETH Zürich, gta Verlag, Zürich, 2026 www.eduard-lanz.ch
Gewidmet Annemarie Geissbühler-Lanz (1927-2023), Vorstandsmitglied vom Altstadtleist
Annemarie kam am 17. 2. 1927 am Wolfweg 2 in Nidau als Tochter von Architekt Eduard Lanz zur Welt. Dort verbrachte Annemarie die ersten Jahre ihrer Kindheit mit den
«Eisenbähnlern» in der Genossenschaftssiedlung Hofmatten. Mit Schulbeginn zog die Familie in das von Eduard Lanz erbaute Haus an der Schützengasse in Biel. Bei Kriegsausbruch 1940 trat sie den
Bieler Pfadfinderinnen bei und betreute später deren Heim. Nach ihrem Motto «Man soll Bildung betreiben, wo immer sich die Gelegenheit findet» wurde Annemarie 1954 Sekundarlehrerin. Pädagogische
Erfahrungen sammelte sie an der Dorfschule in Iseltwald und an der neuen Mädchenschule, später an der Fortbildungsabteilung des Marzili des Freien Gymnasiums Bern. Für das Rote Kreuz war sie als
Detachementsführerin einer Gruppe von Krankenschwestern tätig. 1956 heiratete sie den Sekundarlehrer Walter Geissbühler (1923-2009). Sie hielt Vorträge über Probleme der Kindererziehung,
verfasste Artikel im Bieler Tagblatt, schrieb von 1958 bis 1969 Literaturempfehlungen für das Berner Schulblatt und unterstützte die Bieler Altstadt kulturell mit der «Balade de Noël». 1985 trat
sie dem Altstadtleist bei und war von Juni 1987 bis 17. November 1998 Vorstandsmitglied. 1987 wurde sie Präsidentin der Regionalgruppe Biel-Seeland des Berner Heimatschutzes. Von 1991 bis 2009
verfasste sie 12 Chroniken für das Neue Bieler Jahrbuch.
Eine besondere Beziehung hatte sie zum geschichtsträchtigen Haus Schmiedengasse 10, in dem mehrere Generationen der Familie Lanz wohnten. Als Verwalterin und Mitbewohnerin machte sie die
historischen «Schätze» ihrer Vorfahren am Europäischen Tag des Denkmals 2001 der Öffentlichkeit zugänglich. 2011 initiierte sie die Petition «Erhaltung der Landwirtschaftszone Berghaus». 2021
realisierte Annemarie mit der Universität Freiburg den Kurzfilm «50 Jahre Frauenstimmrecht in der Schweiz». Unter ihrer Mitarbeit entstand in der EPFL Lausanne ein umfangreiches
Architekten-Archiv über Eduard Lanz, das den grössten Teil seines Nachlasses enthält. Ihre Arbeit über das Wirken von G. F. Heilmann am Wiener Kongress blieb unvollendet. Sie starb am 21. Mai
2023.
Quellen/Sources: 1) Ri, „«Eduard Lanz-Grütter» in Bieler Tagblatt, Biel, 22. 11. 1972, S. 4; - 2) Robert Walker, «Haus Schibli in Lengnau» in Berner Heimatschutz, Mitteilungsblatt 2004 , S. 14ff; - 3) Nathalie Ritter, Eduard Lanz 1886-1972. Rot und schwarz: lokale Architektenkarriere und internationales Selbstverständnis. Dissertation, Bern, 2011; - 4) Werner und Marcus Bourquin, Biel Stadtgeschichtliches Lexikon, Büro Cortesi, Biel 1999; - 5) Dora Lanz-Grütter, Eduard Lanz 1886-1972 - Nachruf und Lebenslauf; - 6) A. T. «Biel und seine Altstadtchilbi» in Bieler Tagblatt, Biel, 1. 9. 1950, S. 11; - 7) Der Bund, Bern, 24. Januar 1908, S. 2;- 8) gs., «Rund um den Kulturpreis» in Bieler Tagblatt, Biel, 31. 1. 1967, S. 3; - 9) R. R. «Die Bieler Volkshausgenossenschaft» in Das Wohnen, Nr. 5, Zürich, 1968, S. 1509; - 10) Rebecca Omoregie, «Ein Denkmal verdichten» in Wohnen, Nr. 5, 2012, S. 42ff; - 11) Eduard Lanz, «Wohnungen für kinderreiche Familien in Biel» in Das Wohnen, Nr. 9, Zürich, 1931, S. 134f; - 12) Sylvain Malfroy «Sonnige Wohnverhältnisse auch für Arbeiterfamilien» in Bieler Tagblatt, Biel, 23. 6. 1994, S. 13: - 13) Eduard Lanz, «Das neue Bieler Volkshaus» in Bieler Jahrbuch 1933, Biel, S. 132; - 14) ) Ursula Maurer, Jürg Saager, Bauinventar der Stadt Biel, Kantonale Denkmalpflege Bern, Einwohnergemeinde Biel, 2003; - 15) Margrit Wick-Werder, «Vom Versuchskaninchen zum Denkmal» in Bieler Brunnen-Büchlein, Bieler Manifest, Biel, 2004, S. 74; 16) Stadtplanungsamt Biel, Stadt Biel: Inventar schützenswerter Ensembles, Biel, 3. 1985, S. 17ff; - 18) Eduard Lanz, Bericht der Spezialkommission, 19, 3. 1954, Archiv Altstadtleist, Sammlung BIWO-Akten; - 19) Heinz Strobel, Ausstellungen Altstadtchilbi von 1954 bis 2016, Archiv Altstadtleist: - 20) Hans Berchtold, «Architektur» in Bieler Jahrbuch 1928, S. 128; - 21) d., «Wohnkolonie auf dem Champagnefeld» in Bieler Tagblatt, Biel. 30. 10. 1929, S. 4; - 22) Werner Bourquin, «Zur Wohnungsausstellung im Neuen Heim» in Bieler Tagblatt, Biel, 6. 6. 1934, S. 1f; - 23) Situationsbericht Fassadenrenovation, BIWO Akten, Archiv Altstadtleist, 18. Juli 1936; - 24) P. Scheurer, Dr. med. Emil Lanz-Bloesch - Spitalarzt in Biel, Bieler Jahrbuch 1927, S. 130ff; - 25) «Das Abtenhaus als Kunsteigentum» in Bieler Tagblatt, Biel, 5. 12. 1936, S. 3; - 26) Ingrid Ehrensperger-Katz, Reformierte Stadtkirche Biel, Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte, Bern, 1981, S. 7; - 27) «Die Turmuhr der Stadtkirche» in Bieler Tagblatt, Biel. 14. 9. 1951, S. 3; - 28) Ernst Schiess, «Die Erneuerung der Orgel in der Stadtkirche Biel» in Bieler Tagblatt, Biel, 17. 3. 1944, S. 6; - 29) Heinz Strobel, Der Altstadtleist und die Armbrustschützen, Biel, 2012, Archiv Altstadtleist; - 30) rd., «Ausserordentliche Gesamtkirchgemeinde-Versammlung der evangelisch-reformierten Gesamtkirchgemeinde Biel, Bieler Tagblatt, Biel, 25. 10. 1955, S. 4; - 31) Paul Knecht, «…um schlags neun wieder aufzustehen» in Biel-Bienne, 16. 1. 1992; - 32) «Krankenpflegeverein der reformierten Kirchgemeinde» in Bieler Tagblatt, Biel, 15. 5. 1929, S. - 33) Geschäftsbericht der Stadt Biel 1937, S. 119; - 34) d., «Römische Gräberfunde» in Bieler Tagblatt, 31. 10. 1925, S. 2; -35) rsb., «Biels Studentenfoyer Römerquelle gegründet» in Der Bund, Bern, 21. 11. 1967, S. 7 - 36) f.a., «Ein Schwesternhaus in Bellelay» in Der Bund, Bern 10. 11. 1950, S.; - 37) Dr. W. T., «Dr. med. W. Lanz» in Der Bund, Bern, 4. 11. 1924, S. 3, - 38) Hermann Schöpfer, «Tapeten in situ und in Reserve in einem barocken Bürgerhaus in Biel» in Zeitschrift für schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte, Nr. 68, Verlag Karl Schwelger AG, Zürich, 2011, S. 91ff; - 39) Daniel Andres, Biel-Veränderungen - Ein Überblick über die bauliche Entwicklung der Stadt Biel, Sauerländer AG, Biel/Aarau 1978, S. 50; - 40) Vorstandsitzung Altstadtleist, 17. 9. 1968, - 41) Vorstandsitzung Altstadtleist, 27. 5. 1969; - 42) Vorstandsitzung Altstadtleist, 16. 9. 1971; - 43) Vorstandssitzung Altstadtleist, 29. 04. 1971; - 44) Vorstandsitzung Altstadtleist, 10. 10. 1961; - 45) Guido Müller, «Die Verwaltungstätigkeiten der Bieler Behörden in den letzten 40 Jahren», Bieler Jahrbuch 1962, S. 9; - 46) G. Ludwig, «Zur Erinnerung an Herrn Joseph Lanz, med. Geboren 12. Dezember 1818, Gestorben 22. Januar 1908», Biel, 1908, S 5ff, Sammlung Stadtbibliothek Biel: - 47) Hans Bloesch, «Dr. Emil Lanz, Arzt in Biel, 1851-1926: Nekrolog», Bern, 1926, S. 3ff, Sammlung Stadtbibliothek Biel; - 48) Ferdinand Brügger, Kirchen im Seeland, Verlag W. Gassmann, Biel, 1980, S. 231f; - 49) Carl Friedrich Ludwig Lohner, Die reformierten Kirchen und ihre Vorsteher im eidgenössischen Freistaate Bern, Thun 1864, S. 530; - 50) Peter Wäschle, «Stilles Haus voller Geheimnisse» in Bieler Tagblatt, 11. 9. 1989, S. 14; - 51) F. S., «Vinelz Führung durch die Kirche» in Bieler Tagblatt, 24. 11. 1971, S. 24; - 52) A. Rudolf/M.Gafner, «Kunstaltertümerpflege» in Verwaltungsbericht der Erziehungsdirektion des Kantons Bern, Bern 1946, S, 107; - 53) Eduard Lanz, «Siedlung Möösliacker für kinderreiche Familien» in Das Wohnen - Schweizerische Zeitschrift für Wohnungswesen, Nr. 11, Zürich, November 1928, S. 227ff; - 54) sp., Assemblee du groupe seelandais du Heimatschutz in Fan- L’express, 7. 10. 1954, S. 10: - 55) «Wettbewerb für einen Zierbrunnen in Zofingen» in Schweizerische Bauzeitung, 13. 4. 1918, S. 167; - 56) Pietro Scandola, Volkshaus und Hotel Elite in Häuser erzählen… die Geschichte Biels vom Mittelalter bis heute, V: NMB, Biel, 2010, S. 58ff; - 57) Das neue Bieler Volkshaus eröffnet in Bieler Tagblatt, 21. 11. 1932, S. 2f; - 58) Inventar schützenswerter Objekte der Stadt Biel, Stadtplanungsamt Biel, März 1985, S. 17; - 59) Daniel Andres, «Biel-Veränderungen», Ein Überblick über die bauliche Entwicklung der Stadt Biel, Biel 1978, S. 53f
Archives de la construction moderne-EPFL, Lausanne, 0004 Fonds Eduard Lanz, 1910-1988: 60) 0004.01.0083, Korrespondenz, Biel, 16. 10. 1939; - 61) 0004.01.0018, Brief vom Gemeinrat der Stadt Biel an Frau Dr. Lanz-Bloesch, Biel, 6. 3. 1936; - 62) 0004.01.0010, M. Stettler, Die Kirche von Vinelz und ihre Wandmalereien; - 63) 0004.01.0018, Bericht Altstadtleist März 1939 bis März 1940; - 64) 0004.01.0018, Einladung zur Generalversammlung, Biel, 24. 2. 1941; - 65) 0004.01.0018, «An unsere Mitglieder», Brief, Biel, September 1944; - 66) 0004.01.0018, Kohlenstaub in der Bieler Altstadt, Brief der Altstadtbewohner an Altstadtleistpräsident Eduard Lanz, Biel, 19. 11. 1943; - 67) 0004.01.0018, Brief der Brandversicherungsanstalt des Kantons Bern an Eduard Lanz vom 11. 10. 1943; - 68) 0004.01.0018, Filmvorführungen im Hotel Kreuz, Dokument vom 27. 3. 1943: - 69) 0004.01.0018, Altstadtleist-Jahresbericht März 1940 bis Februar 1941, Biel, März 1941; - 70) 0004.01.0018, Chlauser 1941, Dokument vom Altstadtleist Biel, 4. 12. 1941; - 71) 0004.03.0018 Eduard Lanz, Lebensabriss; - 72) 0004.03.0018 Zwischenzeugnis der Schweizerischen Bundesbahn Kreisdirektion II, 4. 4, 1923: - 73) 0004.03.0018 Partei-Mitgliedsbuch von Eduard Lanz; - 74) 0004.01.0137 Denkschrift zur Kirche Ligerz von 1962; - 75) 0004.01.1038 Wyttenbach-Haus der deutschen und der französischen Kirchgemeinde Biel;- 76) 0004.01.0138 Eröffnungsrede über das Wyttenbachhaus, 19. 6. 1941; - 77) 0004.03.0009 Sitzung der Kantonalen Kommission für Gemeinnützigkeit, 8. 9. 1942; - 78) 0004.03.0009 Eduard Lanz, Exposé betreffend Massnahmen zur Bekämpfung der Landflucht; - 79) 0004.03.0018c Dienstbüchlein von Eduard Lanz; - 80) 004.03.0018 Abgangszeugnis der eidgenössischen polytechnischen Schule Zürich, 26. 3. 1910; - 81) 0004.03.0003 Bewerbungsbrief an die Direktion des Bezirksspitals Biel, 24. 7. 1945; -82) 0004.01.0067 Einladung zur Hauptversammlung der Spitalkommission Biel, 30. 10. 1947; - 83) 0004.01.035 Sitzungsprotokoll der Kommission für den archäologischen Arbeitsdienst Petinesca, 4. 10, 1939; - 84) 0004.01.035 Brief von E. Lanz an Professor Tschumi, Biel, 14. 5. 1937; - 85) 0004.01.021 Bericht über die 22. Ferienversorgung Nidau, Nidau, 1929, S. Sff
90) Dr. Hans Jörg Rieger, «1983 stand ganz im Zeichen des Volkshauses» in Bieler Jahrbuch/Annales biennoises 1983, S.123ff; - 91)
«Gemeindestuben und Gemeindehäuser» in Die Berner Woche in Wort und Bild, Bern, 18. 1. 1919, S. 28f ; - 92) Hans Flückiger, Philipp Jean, Robert Kapp jr., Urs Külling, Konrad Mäder, Hans Müller,
Christian Sumi, «Das Bieler Volkshaus», nach Quellen der gleichnamigen Festschrift von Rudolph Roth (1959) in Bieler Tagblatt, Biel, 17. 9. 1977, S. 14f; - 93) Theodor Abrecht, «Volkshaus Biel
eröffnet» in Beilage zur Berner Tagwacht, Bern, 21. 11. 1932, S. 2; - 94) Rudolph Roth, «Das Bieler Volkshaus und das Werden der Arbeiterbewegung», Biel,1959, S. 70ff; - 95) Eduard Lanz,
«Wohnungen für kinderreiche Familien in Biel», in Zeitschrift Schweizerische Zeitschrift für Wohnungswesen, Zürich, Januar 1927, S. 2ff; - 96) Herman von Fischer, «Denkmalpflege im Kanton Bern
1962 und 1963, Kirche Ligerz» in Berner Zeitschrift für Geschichte und Heimatkunde, Bern, 1965, S. 5; - 97) ch, «Bauliches aus Nidau» in Berner Tagwacht, Bern, 22. 12. 1931, S. 7; - 98) er, «Zur
Initiative für das Frauenstimmrecht» in Bieler Tagblatt, Biel, 5. 3. 1953; - 99) ml., «Der Lindenquartierleist steht für ein Riegelhaus ein» in Bieler Tagblatt, Biel, 23. 10. 1969, S. 3; - 100)
Guido Müller, «Das rote Biel und seine Aufgaben» in Berner Tagwacht, Bern, 10. 3. 1930, S. 6; - 101) Kurt Maibach, «Usgeben wegen dem Koufhuss…» in Nidauer Chlouserbletter Nr. 8, Nidau, 2004, S.
27; - 102) Graf, «Das neue Sekundarschulhaus in Nidau» in Bieler Tagblatt, Biel, 28. 5. 1957, S. 9; - 103) Gilbert Bongard, «Das Eisenbahnerquartier- Entstehung einer Gartenstadt in den
Hofmatten», in Nidauer Chlouserbletter, Nidau,2006, S.37ff; - 104) Geschäftsbericht der Stadt Biel, Biel, 1923, S. 159; - 105) Irène Dietschi, Liber Hospitalis, Bieler Spitalgeschichte
1415-2015,Biel/Reinach, 2015, S. 37ff; - 106) «Einweihung des Spital-Erweiterungsbaus» in Der Bund, Bern, 16. 2. 1953, S. 4; - 107) «Hauptversammlung des Bezirksspitals» in Bieler Tagblatt,
Biel, 29. 10.1954, S.3; - 108) «Bezirksspital Biel - Hauptversammlung der Abgeordneten der Spitalgemeinden» in Bieler Tagblatt, Biel, 5. 8. 1944, S. 4; - 109) «Kinderkrippe Biel» in Tagblatt der
Stadt Biel, Biel, 13. 4. 1890, S. 4; - 110) Robert Aeberhard, «Wyttenbachhaus» in Kirchen im Seeland, Verlag W. Gassmann, Biel, 1980, S. 101f; - 111) Annemarie Geissbühler Lanz,
«Frauen-Aktivitiäten» in Bieler Tagblatt, Biel, 19. 1.1 1989, S 10; - 112) Hermann Fehr, «100 Jahre Bezirksspital Biel» in Neues Bieler Jahrbuch 1967, Biel, 1967, S. 71ff; - 113)
«Stadtratssitzung vom 23. August» in Bieler Tagblatt, Biel, 25. 8. 1904, S. 2; - 114) Werner Bourquin, «Das Kinderspital Wildermeth» in Bieler Tagblatt, Biel, 25. 6. 1932, S. 1; - 115) Joseph
Lanz, Briefe an Carl Emmert über die Berliner Schule in Correspondenz-Blatt für Schweizer Ärzte, Nr. 8, Basel 1909, S. 284ff; - 116) «Nidau baut ein Ferienheim» in Illustrierte Schweizerische
Handwerker-Zeitung, Nr. 10, Zürich, 1929, S. 112
Universitätsbibliothek vonRoll, Bern: 117) C. Schweizer, Jahresberichte vom Gemeinde-Spital Biel, 1902 bis 1905, Biel 1906, BeM ZB var 2151; -
118) Christian Forney, Die Notfallstube in der Bieler Altstadt 1837-1866, Bern, 2009, S. 43ff, BeM RAB 10389; - 119) Zur Erinnerung an Herrn Joseph Lanz, med. Geboren 12. Dezember 1818, Gestorben
22. Januar 1908, Biel, 1908, S. 5ff, BeM ZB H va 2823
Staatsarchiv Bern, St. A.B. P.C 446, Jahresberichte über die Verwaltung des Gemeinde- bzw. Bezirksspitals Biel 1867 bis 1918: 120) 1867/68, 121)
1869, 122) 1870-73, 123) 1874, 124) 1878-81, 125) 1882-86, 126) 1893/94, 127) 1899-1901, 128) 1907, 129) 1908, 130) 1909, 131) 1910, 132) 1911, 133) 1912, 134) 1913, 135) 1916, 136) 1917, 137)
1918
138) E. Fawer, «Das Nidauer Ferienheim Bärgsunne» in Berner Schulblatt, Nr. 9, 28. 5. 1938, S. 135f; - 139) J. Klawa, «Kinderfreunde und Arbeiterbewegung» in Rote Revue, Zürich, Oktober 1929, S. 52; - 140) «Wer will da helfen?» in Bieler Tagblatt, Biel, 26. 7. 1949, S. 4; - 141) «Alte Fresken» in Freiburger Nachrichten, Freiburg, 12. 12. 1929, S. 4; - 142) „Schweizerischer Frauenalpenklub Sektion Biel» in Bieler Tagblatt, Biel, 13. 11. 1935, S. 2; - 143) A. Wyssen, «Kurze Geschichte der Kapelle Magglingen» in Bieler Tagblatt, 2. 12. 1960, S. 22; - 144) Hans Rickenbacher, 100 Jahre Kinderfreunde-Verein Biel und Umgebung 1922 - 2022, Festschrift, Verein Abenteuer Natur, Biel, 2022, S. 5 - 145) Albert Hofer, «Biel, die erste schweizerische Ortsgruppe des Arbeitervereins Kinderfreunde» in Berner Tagwacht, Bern, 9. 8. 1922, S. 6; - 146) R. P., «Seelsorger und Jüngling» in Schweizer Kirchenzeitung, Nr. 50, Luzern, 1928, S. 425; - 147) «Schweizerischer Verband zur Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaues» (SVW) in Schweizerische Bauzeitung, Nr. 13, Zürich, 1919, S. 164; - 148) Jakob Peter, «Ein halbes Jahrhundert Schweizer Verband für Wohnungswesen» in Zeitschrift Wohnen, Nr. 6, Zürich, 1969, S. 156f - 149) «Wohnungsbau für kinderreiche Familien» in Berner Tagwacht, Bern, 30. 11. 1926, S. 7
Postadresse: Altstadtleist Biel, Obergässli 11, 2502 Biel/Bienne. Lokal: Brunngasse 11, Tel. 032 323 42 84,
Öffnungszeiten auf Anfrage
Adresse postale: Guilde de la vieille ville, Ruelle du Haut 11, 2502 Biel/Bienne. Local: Rue des Fontaines 11, Tel: 032 323 42 84.
Heures d'ouverture sur demande.