- Brunngasse / Rue des Fontaines
- Burgplatz / Place du Bourg
- Burggasse / Rue du Bourg
- Jakob-Rosius-Strasse / Rue Jakob-Rosius
- Kanalgasse / Rue du Canal
- Kirchgässli / Ruelle de l'Eglise
- Obergasse / Rue Haute
- Obergässli / Ruelle du Haut
- Quellgasse / Rue de la Source
- Ring
- Römergässli / Rue des Romains
- Schmiedengasse / Rue des Maréchaux
- Untergasse / Rue Basse
- Untergässli / Ruelle du Bas
- Juravorstadt / Faubourg du Jura
- Mühlebrücke / Pont du Moulin
- General Dufour-Strasse / Rue du Général-Dufour
- Das Dufour Schulhaus - Überblick
- Das Dufour Schulhaus - Kloster und Spital
- Das Dufour Schulhaus 1818-1819
- Das Dufour Schulhaus - Abram-Emmanuel und Edouard Tièche
- Das Dufour Schulhaus 1818 - Louis Agassiz
- Das Dufour Schulhaus 1820-1827
- Das Dufour Schulhaus 1828-1835
- Das Dufour Schulhaus - Lehrer in geheimer Mission
- Das Dufour Schulhaus 1836-1838
- Das Dufour Schulhaus 1837 Jean Joseph Hisely
- Das Dufour Schulhaus 1839-1842
- Das Dufour Schulhaus 1843-1849
- Das Dufour Schulhaus 1845 Albert Friedrich Haller
- Das Dufour Schulhaus Kinder der Fabrik
- Das Dufour Schulhaus 1850-1869
- Das Dufour Schulhaus - Armin und Arnold Mueller
- Das Dufour Schulhaus 1870-1880
- Das Dufour Schulhaus 1881-1887
- Das Dufour Schulhaus 1885 - Hermann Aegler
- Das Dufour Schulhaus 1887 - Karl Walser
- Das Dufour Schulhaus 1888 Robert Walser I
- Das Dufour Schulhaus 1888 Robert Walser II
- Das Dufour Schulhaus 1888-1891
- Das Dufour Schulhaus 1891 Grock
- Das Dufour Schulhaus 1892 - Gottlieb Hauser
- Das Dufour Schulhaus 1892-1895
- Das Dufour Schulhaus 1896-1898
- Das Dufour Schulhaus 1893 - Eduard Amsler
- Das Dufour Schulhaus 1896 - Hermann Hubacher
- Das Dufour Schulhaus 1897 - Emil Meyer
- Das Dufour Schulhaus - Die Familie Lanz
- Das Dufour Schulhaus 1897 - Fritz Antenen
- Das Dufour Schulhaus 1899-1905
- Das Dufour Schulhaus 1902 Werner Bourquin
- Das Dufour Schulhaus 1902 - MAURICE UND ANDRÉ VAUCHER
- Das Dufour Schulhaus 1905 - Karl Schoechlin
- Das Dufour Schulhaus 1906-1908
- Das Dufour Schulhaus 1908 - Hans Schoechlin
- Das Dufour Schulhaus 1909-1910
- Das Dufour Schulhaus 1911-1950
- Das Dufour Schulhaus 1951-2011
Das Dufour-Schulhaus / L' école Dufour 1836-1838

Progymnasium / Progymnase
Im Schulhaus Dufour-Ost befanden sich bis jetzt das Johanniterkloster, der Freihof, das Spital, die Burgerbibliothek und das Gymnasium. Ab 1836 beherbergten die
Schulzimmer das Progymnasium.
Résumé : Le bâtiment scolaire Dufour-Est abritait jusqu'à présent le cloître des chevaliers hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, le Freihof, l'hôpital, la
bibliothèque des bourgeoisie et le gymnase. À partir de 1836, les salles de classe ont accueilli le progymnase.
Längst hatte man die Notwendigkeit eingesehen, das Progymnasium, zu dessen Unterhalt der Staat jährlich Fr. 5025.- entrichtete, zu verbessern;
denn im Herbst 1836 war die Schülerzahl dieser einst blühenden Anstalt auf 17 herabgesunken. Diese Reform fand im Oktober 1836 und im folgenden Jahr statt, namentlich durch Aufstellung eines
Reglements. (Rapport)
Ein neuer Schulplan
1836 entschloss sich der Verwaltungsrat vom Gymnasium einen Reorganisationsplan an das Erziehungsdepartement abzusenden. Am 12. September 1836 lautete der
Beschluss, dass der Regierungsrat der Republik Bern das Progymnasium in Biel mit den übrigen Lehranstalten der Republik in Einklang bringen möchte: «Das Progymnasium in Biel wird zu einer
Sekundarschule, welche die Schüler in den Stand setzen soll, entweder in das höhere Gymnasium oder in die höhere Industrieschule in Bern einzutreten.» Nachdem der Burgerrat am 16. September
zustimmte, fasste die Burgergemeinde am 12. Oktober folgende Beschlüsse:
1. Eine Sekundarschule ersten Ranges wird errichtet, in welcher vorzugsweise die Realien oder praktischen Fächer, aber auch nach Wunsch die alten Sprachen von 10. bis ins 16. oder 17. Altersjahr
gelehrt werden, und von wo die Schüler entweder in die höhere Gewerbeschule oder in das höhere Gymnasium in Bern eintreten können.
2. Der Staat gibt einen Beitrag von 5000 Franken.
3. Die Burgergemeinde der Stadt Biel deren Burgerkinder die Schule unentgeltlich benutzen können, liefert nach Bedürfnis ausser dem bisherigen Beitrag diejenige Summe, welche in der Burgerschule
verfügbar wird, und die nötigen Gebäulichkeiten.
4. Das Pensionat fällt als obrigkeitliche Anstalt im Schulgebäude weg. Uniform, Exerzieren und dergleichen sind freiwillig.
5. Zu den Schuldirektoren erwählt der Burgerrat die Hälfte der Mitglieder und wahrt sich also einen angemessenen Einfluss.
6. Die vom Burgerrat gewählten Mitglieder sollen zugleich die Schulkommission für die übrigen Stadtschulen bilden, damit stets eine gute Übereinstimmung und ein gutes Einverständnis mit der
Sekundarschule bestehe.
7. Es wird darauf gesehen werden, dass ein jeder erlerne, was ihm vom praktischen Nutzen in seinem künftigen Beruf sein kann, und dass in Betreff von Büchern und anderen Lehrmitteln den Eltern
keine unnötigen Kosten verursacht werden.
Die Lehrkurse dauern in der Regel 6 Jahre. Die Sekundarschule hat 4 Klassen; in den beiden unteren verbleiben die Schüler je ein Jahr, in den beiden oberen je zwei Jahre. Die Sekundarschule
verfolgt beide Richtungen, die realistische und die literarische; jedoch soll erstere vorherrschen. Beide Abteilungen geniessen den Unterricht teils gemeinschaftlich, teils getrennt. Das Maximum
der Stundenzahl in der literarischen Richtung ist 34 in der realistischen 40. Turnen, Schwimmen und Exerzieren sind fakultativ auf die Abendstunden zu verlegen.
Zum Eintritt in die 1. oder unterste Klasse des Progymnasiums wird gefordert:
a) das angetretene 10. Altersjahr
b) Kenntnis der 4 Spezies und Gewandtheiten im Kopf- und Zifferrechnen
c) Kenntnis des einfachen Satzes, wie auch Übungen im Bilden leichter Sätze, wenn die Satzteile angegeben sind
d) im allgemeine hinlänglich elementarische Entwicklung und Ausbildung des geistigen Kräfte.[1]
Die Lernziele der Anstalt sind:
1836
Latein
Griechisch
Deutsch
Französisch
Geschichte
Geographie
Mathematik
Geometrie
Kenntnis der Syntax des goldenen Zeitalters, so dass der Schüler im Stande ist, aus einem leichtern Historiker, z.B. Cäsar, ohne Hilfsmittel ein noch nie gesehenes Stück zu übersetzen und eine im Geiste der Alten gehaltene Erzählung ohne grobe Verstösse ins Lateinische zu übertragen.
Kenntnis der Formenlehre, besonders der irregulären Zeitwörter, so dass der Schüler leichtere deutsche Sätze ins Griechische übertragen und mit Hilfe eines
Wörterbuches im Stande ist, ein Stück aus einem leichtern Schriftsteller zu übersetzen. Kenntnis der homerischen Formen.
Formenlehre und Satzlehre. Anfertigung eines Aufsatzes.
Übertragen einer leichten Stelle aus einem Historiker in beide Sprachen.
Allgemeine Kenntnis der Hauptbegebenheiten.
Kenntnis der Erdoberfläche in orographischer, hydrographischer und topischer Hinsicht. Aus der alten Geographie insbesondere Kleinasien, Griechenland und Italien.
Arithmetik. Gleichungen des 1. und 2. Grades:
In Betreff der Realien werden die zum Eintritt in die Industrieschule aufzustellenden Erfordernisse als Lernziel angenommen.
Am November 1836 wurde das «Progymnasium in Biel», wie der offizielle Name lautete, mit 70 Schülern und 9 Lehrern eröffnet, die nun weltanschaulich und politisch unverdächtig waren.[5]
Militärischer Unterricht nicht mehr obligatorisch
Bei der Umgestaltung der Schule 1836 wurde das Obligatorium des militärischen Unterrichts aufgehoben, als Uniform für diejenigen, die sich freiwillig eine solche anschaffen, folgende
bestimmt: Ein Kleid von grauem Tuch nach bisherigem Schnitt, mit hellblauen Aufschlägen, doch ohne weisse Passepoils; Beinkleider nach Belieben, doch weiss für festliche Anlässe; als
Kopfbedeckung eine hellblaue, etwas aufgestellte Mütze. Die militärischen Übungen sollten sich auf den Samstagabend beschränken.[1]
1837 besuchten 68 Schüler das Progymnasium, davon 12 in der literarischen, 56 in der Realabteilung.
1837
Bilingualismus
Zur Abhilfe des Missstands, dass einige der deutschen Sprache nicht mächtigen Schüler den Lehrer nötigten, den Unterricht bald in deutscher bald in französischer Sprache zu erteilen, wurde 1838 dem Administrationsrat vorgeschlagen für diese Schüler entweder eine eigene Vorbereitungsklasse zur Erlernung der deutschen Sprache mehr auf praktischem Wege zu errichten, oder sie an den Privatunterricht zu weisen, bis sie dem Unterrichte genügend folgen könnten.
Personal
An die Stelle von Albrecht Jahn wurde 1838 August Hollmann zum Lehrer der deutschen Sprache ernannt und Pfarrvikar Appenzeller der Unterricht in der Religion übertragen. Dieser reichte kurze Zeit
später wegen Gesundheitsgründen die Entlassung ein. Herr Hollmann musste abberufen werden, worauf Kandidat Abraham Adolf Gerster, aus Twann, beide vakante Stellen übertragen wurden. Emanuel
Denner wurde für Naturkunde, Technologie und Buchhaltung definitiv als Lehrer gewählt. Einen nicht geringen Verlust erlitt die Anstalt durch den unerwarteten Austritt des Direktors Hisely, der
nach Lausanne als Lehrer am neu errichteten Gymnasium ernannt wurde.
Die Zahl der vorhandenen 60 Knabenflinten wurde auf 100 vermehrt und zur Wiederherstellung der etwas vernachlässigten Bibliothek des Progymnasiums die Summe von 200
Fr. bewilligt. Die Schülerzahl betrug bei der Frühlingsprüfung 69 und Ende Jahres stieg sie auf 81. (Rapport)
1838


Heinrich Albert Jahn (1811-1900), Archäologe, Historiker
Lehrer am Progymnasium in Biel von 1836 bis 1838.
Heinrich Albert Jahn wurde am 9. Oktober 1811 in Twann geboren. Er war der Sohn des aus Sachsen gebürtigen und seit 1804 in Bern niedergelassenen Karl Christian
Jahn (1777-1854), der an der Berner Akademie Professor der deutschen Sprache und Literatur war und der Wilhelmine Tourbier (1784-1843).[9] Er durchlief die Elementarschule und die Literarschule, inklusiv
Gymnasium, in Bern. Albert sollte, wie seine beiden älteren Brüder, Theologe werden. Er studierte 1831 bis 1834 Theologie und Philologie an der Akademie in Bern, absolvierte 1834 die theologische
Prüfung und wurde dann in den bernischen Kirchendienst aufgenommen. Im selben Jahr wurde er zum Privatdozenten für Philologie an der neu gegründeten Hochschule ernannt. Er setzte mit dem
Staatsstipendium seine philologischen Studien fort in Heidelberg und München 1835 und 1836. Dort interessierte er sich hauptsächlich für Archäologie.[21]
Von München weg wurde er 1836 als Lehrer an das neu gegründete Progymnasium in Biel berufen und unterrichtete dort
bis 1838.[23]
Dann wirkte er von 1838 bis 1846 an der Industrieschule in Bern eine Lehrerstelle für deutsche Sprache und
Geschichte. Unterbibliothekar der Stadtbibliothek 1840 bis 1847. Lehrer an der städtischen Realschule in Bern für Latein und Geschichte 1847 bis 1852. Gehilfe am eidgenössischen Archiv 1853 bis
1862. Bibliothekar und Kanzlist des eidgenössischen Departements des Innern 1862 bis 1868. Sekretär des eidgenössischen Departements des Innern 1868 bis 1878. Kanzlist des eidgenössischen
Departements des Innern 1879 bis 1900 (zuletzt beurlaubt).[21]
1836-
1838

Heinrich Albert Jahn widmete sich neben seinem Beruf und in den Ferien hauptsächlich der archäologischen Erforschung seiner Heimat. Seine Erkenntnisse veröffentliche
er ausführlich in Zeitschriften, archäologischen, historischen und philologischen Inhalts. Etwa der grosse Fund von römischen Kaisermünzen in der Bieler Brunnquellgrotte und die Pfahlbauten im
Moosseedorf, den er 1854 mit Professor von Morlot und Dr. J. Uhlmann erforschte.[23] Manche seiner
Artikel sind heute wissenschaftlich überholt, sind jedoch wertvolle Zeugen damaliger Erkenntnisse. Albert Jahn hatte beispielsweise die feste Überzeugung, dass sich bei Biel eine römische
Siedlung befand, die zerstört wurde. Heutige Kenntnisse behaupten genau das Gegenteil. Über die Münzen der Bieler Römerquelle berichtete Jahn: «Es war schon immer altertümliche Sitte,
Münzen in Quellen zu werfen, welche durch ihre heilsamen Kräfte zu Dank und Bewunderung anregten. Das Vorkommen der langen Reihe römischer Münzen in der Bieler Quelle kann man aus dieser
Superstition ableiten. So erklärt sich auch der Umstand, dass die Münzen eine so lange Reihe von Kaisern darstellen; sie sind im Lauf der Zeit, wohl meist gleichzeitig mit der Regierung der
einzelnen Kaiser, welche sie angehören, von Verehrern der Quellnymphe in den Schlund der Quellgrotte geworfen worden.
Ein Beweis für das Dasein einer römischen Niederlassung in der dortigen Umgebung finden wir in der Tatsache, dass im Umgang des heutigen Biels römische Münzen ausgegraben worden sind, welche die
Sammlung des Niklaus Heilmann aufbewahrt. Weniger Gewicht legen wir auf die unbestimmten Nachrichten bei Wetzel und Morel über römische Münzen aus der Zeit der ersten Kaiser, welche in der Gegend
um Biel gefunden worden seien. Römische Ansiedlungen in der Gegend um Biel können nicht für das römische Altertum von Biel geltend gemacht werden. Was die römische Bauart betrifft, welche Morel
von einem Teil der Burg zu Biel fest behauptet und Binder in der Ringmauer erkennen will, wissen wir, wie trügerisch die Merkmale sind, an welchen man gewöhnlich römisches Mauerwerk zu erkennen
meint, zumal die Kropfstein - oder Buckelstein-Bauart, das vermeintliche Hauptkennzeichen, in Nachahmungen der Römer auch bei älteren mittelalterlichen Befestigungsbauten festgehalten worden
ist.»
Pfahlbauten: «Eine wichtige Etappe in der Erforschung der Pfahlbauten am Bielersee wurde ab 1840 durch Ausgrabungen von Heinrich Albert Jahn auf der Kanincheninsel eingeleitet, die heute durch
den Heidenweg mit der St. Petersinsel verbunden ist. Jahn war der erste aus dem Seeland stammende und hier tätige Archäologe. Ein Fischer berichtete ihm von Pfählen bei Mörigen, die ihm beim
Fischfang Probleme bereiteten, und von einem Gefäss von rötlicher Erde. Jahn hielt den Fund für keltisch, wollte sich aber offensichtlich aus Zeitgründen nicht selber um die Fundstelle kümmern.
1843 informierte er den Nidauer Notar Emanuel Müller (1800-1858), der sich im Seeland durch Ausgrabungen von Grabhügeln und Forschungen über Römerstrassen in der Szene der Altertumsforscher ein
lokales Renommee erworben hatte. Müller baute mit den Funden von Mörigen die erste Pfahlbausammlung am Bielersee auf.»[22]
Mitglied des Vereins von Altertumsfreunden im Rheinland, der antiquarischen Gesellschaften von Zürich und Basel, der «Société d'histoire de la Suisse romande», der
historisch-theologischen Gesellschaft in Leipzig, der «Société jurassienne d'émulation», der allgemeinen schweizerischen geschichtsforschenden Gesellschaft, der stadtbernischen archäologischen
Kommission, der königlich-bayrischen Akademie der Wissenschaften, des Gelehrtenausschusses des germanischen Museums, des «Institut national genevois», Mitglied und Ehrenmitglied des historischen
Vereins des Kantons Bern, Ehrendoktor und Ehrenprofessor der Hochschule Bern.[21] Heinrich Albert Jahn
war viermal verheiratet: 1840 mit Louise Fischer, 1848 mit Elisabeth Sophie Niehans, 1852 mit Julia Wurstemberger und 1876 mit Amanda Odemann. Er starb mit 89 Jahren am 23. August
1900.[9]
Hauptschriften (Auswahl): «Der Kanton Bern» (Bern und Zürich, 1850), «Chronik oder geschichtliche, ortskundliche und statistische Beschreibung des Kantons
Bern» (Bern und Zürich, 1857), «Historische-archäologische Abhandlung über unteritalisch-keltische Gefässe in der Vasensammlung des bernischen Museums» (Bern, 1846), «Die in der Bieler
Brunnquellgrotte im Jahre 1846 gefundenen römischen Kaisermünzen» (Bern, 1847), «Die Pfahlbaualtertümer von Moosseedorf im Kanton Bern» (Bern, 1857), «Die keltische Alterthümer der Schweiz, zumal
im Kanton Bern» (Bern, 1860), «Emmenthaler Alterthümer und Sagen» (Bern, 1865), «Bonaparte, Talleyrand et Stapfer» (Bern, 1869), «Geschichte der Burgundionen und Burgundiens bis zum Ende der
ersten Dynastie», 2 Bände (Halle, 1874), «Biographie seines Vaters, Professor Karl Jahn» (Bern, 1898).
Ausgaben griechischer Texte, besonders von Kirchenvätern (Auswahl): Glycas; Methodius; Epiphanius; Aristides Quintilianus de musica; Gregorius; Palamas; Eustathius Antiochenus; Proclus;
Dionysius Areopagita; Chemica grueca etc. «Symbolae ad emendandum et illustrandum Philostrati librum de vitis sophistarum» (Bern, 1837), «Sanctus Basilius plotinizans» (Bern, 1838), «Dissertatio
platonica, de causa et natura mythorum platonicorum» (Bern, 1839), «Animadversiones in Sancti Basila Magni opera» (Basel, 1842), «Sanctus Methodius platonizans, sive platonismus sanctorum patrum
ecclesiae graecae Methodii exemplo illustratus» (Halle, 1865) [21]
Gottlieb König (geb. 1824),Oberförster der Burgergemeinde Biel von 1863 bis 1872
Schüler am Progymnasium Biel von 1836 bis 1841
Johann Gottlieb König kam am 16. August 1824 in Biel als Sohn des Bieler Ersparniskasseverwalters und Gemeinderats Johann Gottlieb König (gest. 1870) und der
Caroline Fridrike Moser zur Welt. Nach dem Gymnasium widmete er sich der Forstwirtschaft und wurde nach Studien in Hohenheim, Lorch und Heidelberg, Unterförster in Köniz und Riggisberg und später
burgerlicher Stadtförster von Biel. 1860 heiratete er Anna Hugi aus Oberwil. Ihre zwei Töchter hiessen Johanna Carolina Tièche-König und Anna Hader-König.[17]
Johann Schlup erstellte 1865 unter der Leitung von Oberförster Johann Gottlieb König den ersten definitiven Wirtschaftsplan für die Burgergemeinde Biel. Unter der Leitung von Oberförster König
führte die Forstkommission 1872 das Saumschlagverfahren ein, bei dem das Altholz, in der Regel von Ost nach West, wie beim Öffnen einer Strickarbeit Streifen um Streifen abgesäumt
wird.[18] Sein Bruder Florian Albert (geb. 1827), Verwalter der Ersparniskasse Biel, nahm sich 1875 zusammen mit seiner Frau das Leben. 1890 verkaufte Johann
Gottlieb König das von seinem Vater erworbene Hohemattgut.[9]
1836-
1841
Die Geschichte der Familie Denner
Emanuel Friedrich Denner (1808-1868), Burger- und Stadtschreiber,
Vater von «Denner»-Gründer Julius Cäsar.
Lehrer und Pensionsleiter am Progymnasium Biel von 1836 bis 1854.
Fächer: Naturkunde, Geographie, Technologie, Buchhaltung, Schreiben, Zeichnen
Emanuel Friedrich Denner wurde am 22. 11. 1808 in Cannstatt (Baden-Württemberg) geboren. Er unterrichtete zunächst als Privatlehrer in Nidau. 1835 leitete er einen
Wiederholungskurs für Primarlehrer. 1836 kam er nach Biel, wo er vom 1. Januar bis im September als Lehrer an der oberen Klasse der Burgerschule tätig war. Ab diesem Zeitpunkt trat er als
provisorischer Fachlehrer an das reorganisierte Progymnasium im Dufourschulhaus über und wurde am 10. Mai 1838 definitiv als Gymnasiallehrer angestellt. Dort unterrichtete er Geographie,
Naturkunde, Technik und Buchhaltung, Schreiben und Zeichnen.[16] In Biel heiratete er am 28. 9. 1837 Rosina Margarethe Huber (gest. 1874), Lehrerin der
unteren Mädchenklasse.[9]
Friedrich Denner war 1837 Mitbegründer der Kranken- und Hilfskasse des Stadtbezirks Biel (später Allgemeine Krankenkasse von Biel und Umgebung). Von 1838 bis 1843 war er deren Sekretär und von
1847 bis 1866 deren Kassierer.[27] 1840 erhielt er mit 77 gegen 18 Stimmen das Bieler Bürgerrecht.[24]
1836-
1854

1845 leitete Denner einen Fortbildungskurs als Lehrer für mathematische und physikalische Geographie. In diesem Jahr erschien sein in Biel gedrucktes Werk «Die Oberfläche der Schweiz: ein Beitrag zur gründlichen Behandlung der topographischen und physikalischen Geographie». Darin beschrieb er in 39 Kapiteln die Flüsse, Quellen und Seen der Schweiz und «das Ehemals und Jetzt der Erdoberfläche». Denner stellte darin fest: «Ein Erdbeben von 1755 trübte zum ersten Mal die berühmte Quelle bei Biel, die über 100 öffentliche und private Brunnen der Stadt mit klarem Wasser versorgt (…) Die Schüss teilt sich bei Bözingen in zwei Arme, von denen der westliche in den Bielersee, der östliche in die Ziel mündet (…) Der Neuenburger-, Murten- und Bielersee waren einst zusammenhängende, grosse Seen (…) Die Petersinsel im Bielersee ist 2000 Schritt lang und 800 Schritt breit und gehört dem Bürgerspital zu Bern.» Das Buch schloss mit Andeutungen zur politischen Geographie. Am 22. Mai 1847 wurde ihm die Stelle als Amtsschaffner von Biel und später auch die von Nidau übertragen. [16]
Leiter der Gymnasiums-Pension
Friedrich Denner leitete zusammen mit seiner Frau das Pensionat im Gymnasialgebäude. Er beschrieb es 1853 in der Zeitung «Der Bund» wie folgt:
«Dem Unterzeichneten ist von der betreffenden Behörde wiederum die Ehre zuteil geworden, das seit der Gründung des hiesigen
Gymnasiums in der Anstalt selbst bestehende Pensionat für die Schüler desselben zu leiten und fortzuführen, und er ergreift daher diese Gelegenheit, allen Eltern, die ihren Söhnen eine gute
Erziehung geben wollen, diese Anstalt aufs wärmste zu empfehlen. Von den 8 Lehrern des Gymnasiums wird Unterricht in Religion (in deutscher und französischer Sprache), in den klassischen
Sprachen, in der deutscher und französischer Sprache, in Mathematik, in den Naturwissenschaften, in der Geschichte und Geographie, in Schreiben und Zeichnen, in Buchhaltung, sowie in Gesang
erteilt. Der Unterzeichnet verpflichtet sich in Verbindung mit zwei anderen Lehrern der Anstalt, den Pensionanten bei ihren Wiederholungen und Vorbereitungen in den genannten Fächern zu helfen.
Da der aus Lausanne gebürtige Lehrer der französischen Sprache im Pensionat selbst wohnt, können sich die Schüler, welche die französische Sprache vortrefflich erlernen wollen, mündlich und
schriftlich vervollständigen. Für die rein französischen Schüler findet zur Einübung der deutschen Sprache die Vorbereitungsklasse statt. Auf den Musikunterricht wird besonders Wert gelegt. Auch
hier werden die Schüler bei ihren im Pensionat zu verrichtenden Übungen freundlich beaufsichtigt und unterstützt. Sollten Schüler in das Pensionat eintreten, welche das zehnte Lebensjahr noch
nicht vollendet haben und daher die auf den Eintritt in das Gymnasium vorbereitenden, gut eingerichteten Bürgerschulen besuchen müssen, so stehen diese noch unter der unmittelbaren, mütterlichen
Aussicht der Frau Denner. Nähere Auskunft erteilen nebst dem Unterzeichneten noch die im Pensionat selbst wohnenden Herren Grosjean, Lehrer der Religion und lateinischen Sprache, und Charles
Verrey, Lehrer der Religion und französischen Sprache.
Biel, den 12. Januar 1853.
Friedrich Denner, Lehrer am Progymnasium.»[15]
1854 wurde Friedrich Denner Abgeordneter der bernischen Schulsynode. Am 27. Januar 1856 trat er sein Amt als Schulgutsverwalter der Burgergemeinde Biel an und löste damit den bisherigen Verwalter Peter Schindler, Hafnermeister in Biel, ab. Bereits im Februar 1856 beantragte der Burgerrat die Reorganisation des burgerlichen Schulwesens von Biel. Von 1851 bis 1868 war Denner Stadtschreiber, von 1853 bis 1867 auch Gemeinderatsschreiber.[9] 1859 starb sein Sohn Emil Albert Denner im Alter von 16 Jahren und 9 Monaten.[25] Im Januar 1862 wurde im 2. Stockwerk des Rathauses die burgerliche Stadtbibliothek eingerichtet. Denner stellte sich jeden Mittwoch- und Samstagnachmittag von 13.00 bis 14.00 Uhr als Bibliothekar zur Verfügung. Der jährliche Abonnentenpreis betrug 5 Franken.[26] Als 1866 das von Karl Neuhaus gegründete neue Spital im Pasquart (Seevorstadt 71-73, heute Kunstmuseum) eingeweiht wurde, erlebte er als Besucher ein tragisches Ereignis. Während der Besichtigung kam die Nachricht, dass ein Bahnhofangestellter unter eine Lokomotive geraten war, die ihm beide Füsse zerquetscht hatte. Der Unglückliche war der erste Patient der ins neue Spital eingeliefert wurde, wo ihm beide Beine amputiert wurden. Die Stimmung der Anwesenden schlug in Trauer um. Sie spendeten der Familie des Verunglückten 125 Franken. Friedrich Denner war während 35 Jahren Organist in der Stadtkirche. Er starb am 30. Juli 1868 im Alter von 60 Jahren in Biel an einer Lungenentzündung. Sein Begräbnis fand am 1. August 1868 vor der Stadtkanzlei statt, wo seine Urne aufgestellt wurde.
Karl August Friedrich Denner (1840-1900), Notar, 1. Bieler Stadtpräsident
Schüler am Progymnasium Biel ab 1850
Karl August Friedrich Denner wurde am 24. 2. 1840 in Biel geboren. Nach dem Tod seines Vaters Emmanuel Friedrich Denner übernahm Karl, Amtsnotar in Biel, das Amt des
Burgerratsschreibers und Schulgutverwalters Er erklärte sich bereit, das Amt des Kassierers der Berghausanstalt unentgeltlich zu übernehmen. Am 23. August 1868 heiratete er Emma Ryffe aus
Bözingen. 1874 verlegte er sein Notariats- und Verwaltungsbüro vom Stadtkanzleigebäude in das kleinere Plainpied seines Wohnhauses am Ring Nr. 29 (alte Nummerierung). In diesem Jahr wurde er als
Vertreter des Gemeinderates in die Armenkommission gewählt.
Autor Fridolin schreibt im Bieler Tagblatt: «Der Notar Karl Denner amtete als erster Bieler Stadtpräsident in den damals primitiven Räumlichkeiten der Gemeindeverwaltung, wo er sich die
Schreibstube mit einem kleinen Stab von Mitarbeitern teilte. Im Erdgeschoss war das Archiv untergebracht.[34] An der Schützengasse besass er einen
ansehnlichen Rebberg, dessen Pflege zum Teil seinen Kindern anvertraut war, die ihn uns anderen Buben als Tummelplatz vor der Traubenlese überliess. Karl war aber auch Präsident der
Primarschulkommission, so dass wir unsere Traubengelüste im Zaum halten mussten, wenn er in der Nähe war.[32] Daneben wurde man regelmässig in die
Traubenlese am Tscheneyweg oberhalb von Bözingen gerufen, wo seine Frau das Zepter führte. Zu Beginn dieser Arbeit wurde man von ihr mit ‹Chinder, läset emel die Tribelbeeri uf, Tribelbeeri gäh
der Wii› instruiert, um deren Naschhaftigkeit zu bremsen. Manchmal fiel die Ernte mager aus und sie klagte ‹Mi het mit dene donners Busche nume viel Gschär›. In der Obstpresse der ehemaligen
Brennerei der Wildermethmühle an der Schüss wurde die magere Trüelte durch die Prozedur nochmals reduziert. Und so mag dem Besitzer seines kleinen Rebguts am Tscheneyweg nach und nach die
Einsicht gekommen sein, dass es klüger wäre, dasselbe anderen Zwecken dienstbar zu machen. Insgeheim war Karl der Stumpeschigger unter den Erstklässlern, zumal er seine Grandsons bis zum letzten
Stümpli rauchte. Wenn er aber bei einer Schulprüfung als Inspektor erschien, so sassen wir natürlich auf dem Mund, denn er konnte den Schülern und den Schulmeistern mit seinen Zwischenfragen
recht lästig werden.»[32]

Julius Cäsar Denner (1846-1914), Kaufmann, Gründer der Lebensmittelkette Denner
Schüler am Progymnasium Biel
Der Sohn von Emanuel Friedrich Denner, Julius Cäsar Denner, kam am 12. Juli 1846 in Biel zur Welt. Seine Lehrzeit verbrachte er in St. Sulpice.[14] 1860 gründete Heinrich Reiff-Schwarz in Zollikon die «Reiff-Schwarz, Mercerie und Spezereihandlung». Drei Jahre später wurde Jacob Pfister-Maag Teilhaber und die Firma wurde in «Consum-Gesellschaft Glarus-Rapperswil von Reiff-Schwarz & Comp.» umbenannt.[28] Hier trat Cäsar Denner nach seiner Lehre in das Unternehmen ein.
Als Heinrich Reiff 1870 starb übernahm seine Witwe Dorothea das Geschäft. Hans Denner lernte in Zürich Fanny Reiff kennen und heiratete sie 1880. Der Ehe entstammen die Kinder Elsa (geb. 1881) und Hans Heinrich (geb. 1883) und wurde 1887 geschieden. Dorothea trat 1881 als Teilhaberin zurück und wählte an ihrer Stelle ihren Schwiegersohn Cäsar, der nach elfjähriger Mitarbeit genügend Geschäftserfahrung gesammelt hatte.
Der junge Associé und der ältere Pfister schlossen eine Kollektivgesellschaft, vertrugen sich aber bald nicht mehr und beschlossen 1888, das Geschäft neu aufzuteilen. Mit den Filialen, die Cäsar Denner erhielt, gründete er zusammen mit seinem Vetter Carl Denner die «Denner-Reiff & Cie. Consum-Gesellschaft». Geschäftssitz wurde der neu erbaute «Glashof» an der Konradstrasse 17/19. 1889 wurde die Ehe von Cäsar und Fanny geschieden. 1895 erhielt er gegen eine Gebühr das Zürcher Bürgerrecht. Ab 1896 hiess die Firma «Consumgesellschaft Cesar Denner & Cie». [28] 1903 wurde Fritz Denner von Biel (wohnhaft in Strassburg i. E.) neuer Kommanditär und beteiligte sich mit 20,000 Franken an der Firma.

In der Zwischenzeit war Cäsars Sohn Hans Heinrich nach Amerika gereist. Er arbeitete auf den südamerikanischen Kaffeeplantagen, als Getreide- und Wolleinkäufer und
lernte den Diamantenhandel kennen.[31] In der Schweiz liess Cäsar Denner als erster eine elektrische Heissluft-Kaffeeröstanlage aufstellen. Kurz darauf
kaufte der frisch aus Amerika zurückgekehrte Hans den ersten Orion-Lastwagen, um die inzwischen auf 70 angewachsene Filialflotte schneller bedienen zu können. Der Geschäftsbereich erweiterte sich
1912 auf den Verkauf von Obst und Gemüse.[28] Die Kommanditgesellschaft bestand nun aus den Teilhabern Cäsar und Fritz Denner und den Prokuristen Hans Denner
und Daniel Staub. Neben den Lebensmittelgeschäften gründete Cäsar Denner mit seinem Bruder Carl August 1897 in Zürich die Versicherungsagentur «Gebrüder Denner», die bis 1908 bestand.
In zweiter Ehe glücklich verheiratet, baute sich Cäsar in den letzten Jahren ein schönes Haus am Zürichberg. Während 12 Jahren war er Stubenmeister der Zunft zum Widder, deren Lokal sich im Hotel
Central befand. Als passionierter Jäger und Mitglied des Zürcher Jagdschutzvereins war er viel in der Natur unterwegs. Er starb nach längerer Krankheit am 18. Februar 1914 im Alter von 68 Jahren
in Zürich.[14]

Hans Heinrich Denner (1883-1954)
Nach dem Tod von Cäsar Denner übernahm Hans die Leitung der «Consumgesellschaft Denner & Co.». Er wohnte in der ehemaligen Privatklinik von Dr. med. Sauerbruch an der Ecke
Hölderlinstrasse/Carmenstrasse/Sonnhaldenstrasse. In diesem Haus wuchsen seine drei Töchter Lucie Schaad-Denner, Elsa Hegnauer-Denner und Vera Denner auf.[30] Neben seiner beruflichen Tätigkeit wirkte er als Meister der Zürcher Freimaurerloge beim Lindenhof. Mitglieder der freimaurerfeindlichen «Nationalen Front»
beobachten wie Hans Denner in der Nacht vom 2./3. März 1934 die Loge verliess und mit seinem grünen Cadillac nach Hause fuhr. Vor seinem Haus an der Hölderlinstrasse riss einer der Männer Denners
Autotür auf und entwendete vom Fahrersitz eine Aktentasche, in der er Akten der Freimaurerbewegung vermutete. Als Denner die Verfolgung aufnahm, gab ein anderes Mitglied der «Nationalen Front»
zwei Schüssen auf Denner ab, ohne ihn zu treffen. Die Täter wurden kurze Zeit später gefasst und flüchteten später nach Deutschland.[29] Am Dezember 1935
wandelte Hans Denner seine Firma in die «Consum-Aktiengesellschaft Denner & Co.» um und verlegte den Hauptsitz an die Grubenstrasse in Zürich. Ein Jahr später schied Hans Denner aus dem
Unternehmen aus.
Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, stellte Hans Denner seine Fähigkeiten und Kenntnisse dem Roten Kreuz zur Verfügung, das ihn während der deutschen Besatzung als Verwalter des Schweizerischen
Roten Kreuzes nach Griechenland schickte; später war er noch Delegierter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz in der amerikanischen Zone Deutschlands. Nach Zürich zurückgekehrt, gründete
Denner 1947 im Alter von 65 Jahren eine neue Firma.[31] Er starb am 1. Oktober 1954 vor seinem 71. Lebensjahr. Das Grab der Familie Denner befindet sich auf
dem Friedhof Enzenbühl, in der Ecke rechts neben der Abdankungskapelle.[30] L

August Christian Hollmann (1806-1876), Erziehungssekretär, Förderer von Kindergärten,
von Biel vertrieben
Lehrer am Progymnasium Biel 1838
Fächer: Deutsch
Laut Schulrapport «liess sich August Hollmann ein höchst unwürdiges Benehmen zuschulden kommen, sodass er abberufen werden musste.» Doch was hatte er getan und wer
war dieser «ungezogene» Lehrer? In Wolfenbüttel im Herzogtum Braunschweig geboren, bezog Hollmann 1827 die Universität Jena und nahm dort Anteil an allem, was die Jugend jener Zeit bewegte.
Begeistert für die Idee von Deutschlands Einheit und Freiheit, wurde er eines der wichtigsten Mitglieder der Burschenschaft jener Universität. Als nach dem Frankfurter Putsch die Verfolgungen
wegen sogenannten revolutionären Umtrieben begann, wurde Hollmann 1833 genötigt, um einer Verhaftung zu entgehen, sich in die Schweiz zu flüchten, wo er seitdem, besonders seit seiner
Einbürgerung in Regensberg, auch auf dem Gebiet der Schule und Kirche tätig war. Bis dahin vorzugsweise mit dem Studium der Theologie beschäftigt, wandte er sich nun der Pädagogik und Philologie
zu. Den ersten Schauplatz für seine Wirksamkeit fand er bei seinem im gleichgesinnten Freund Fröbel, dem Gründer der Kindergärten, in einem von demselben geleiteten Institut in Willisau, dann
beim Erzieher Lippe in Lenzburg.[2]
Die Schulkommission von Langenthal wählte im August 1833 den ersten Sekundarlehrer für die erste Sekundarschule vom Kanton Bern: «Herr August Hollmann aus
Wolfenbüttel, wirklicher Lehrer der Erziehungsanstalt in Willisau». Mit August Hollmann wurde ein Schüler des deutschen Reformpädagogen Friedrich Fröbel als erster Sekundarlehrer engagiert. Als
dieser begann, Religionslehre durch Sittenlehre (Ethik) zu ersetzen und die Schule nicht mehr in der christlichen Religion, vielmehr in der Philosophie des Idealismus zu verwurzeln, wurde er von
Pfarrer Frank als Atheist verschrien. [6] Pfarrer Frank wachte eifersüchtig darüber,
dass der Religionsunterricht in streng orthodoxem Geist erteilt wurde. Dazu kam folgender Vorfall: Am Weihnachtstag 1835 war Hollmann in Gesellschaft anderer Lehrer in einem öffentlichen
Wirtschaftslokal. Dabei schien es etwas hoch hergegangen zu sein. Die Folge war eine Beschwerde an die Schulkommission, Hollmann sei am Weihnachtstag betrunken gewesen und habe unehrerbietige
Worte über die Religion gesprochen. Das war zu für den Pfarrer Zuviel. Hollmann, der nie definitiv angestellt war, erhielt auf Frühling 1836 die Kündigung. Vergebens war eine Bittschrift der
Schüler, vergebens eine Petition von zwölf Vätern von Schülern: Hollmann musste die Schule verlassen, nicht wegen des Trinkens, sondern weil er den Religionsunterricht nicht im Sinne und Geiste
des Pfarrers Frank erteilt hatte.[4]
Hollmann kam sozusagen vom Regen in die Traufe, als er ans Progymnasium Biel kam und dort Deutschstunden gab. Von dort wurde er 1838 schon nach
einigen Monaten wegen der Ungnade des damals allmächtigen Schultheissen Neuhaus vertrieben.[2] Die Zürcherische Freitagszeitung vom 10. August 1838 schrieb: «Hollmann, Lehrer in Biel, ist am 3. August seiner Stelle entsetzt worden, weil er, wie man sagt,
in einem Wirtshaus nicht gar artig über die Herren von der Regierung gesprochen habe.» Nach geraumer Zeit fand er erst wider eine Zuflucht in dem Dorf Bühler im Kanton Appenzell am Rhein, wo er
sich einige Jahre unter den kärglichsten Verhältnissen an der dortigen Sekundärschule durchschlagen musste. Von dort wurde er durch Vermittlung des im befreundeten Seminardirektor Augustin Keller
an die Bezirksschule nach Reinach im Aargau berufen und dann von hier 1858 nach Aarau als erster Sekretär an die Erziehungsdirektion versetzt. Dabei zeigte er sich auch nach andern Seiten hin
tätig, so namentlich in dem Verein für kirchliche Reform.[2]
1838-
1838
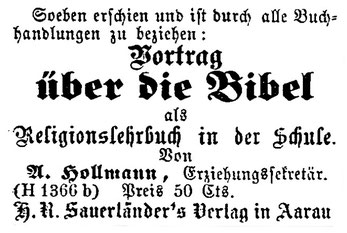
1866 hielt er an der kantonalen Lehrerkonferenz von Aargau einen Vortrag über die Erstellung eines gemeinsamen Lehrbuchs der biblischen Geschichte
für Katholiken und Reformierte. Eine Unzahl biblischer Geschichten seien in die katholischen Schulen eingeführt worden, ohne staatliche Genehmigung.[3] 1872 erschien im Buchhandel sein Werk «Vortrag über die Bibel als Religionslehrbuch in der Schule.»
Bis in die letzten Tage seines Lebens suchte er namentlich der Gründung von Kindergärten nach Fröbel'schem Muster Eingang zu verschaffen und zeigte sich in Wort und Schrift als
Förderer.[2]
«Für das Kind ist die wichtigste Lebenszeit die der ersten Jahre;
jeder neue Erzieher richtet weniger aus als sein Vorgänger,
bis schliesslich, wenn wir das ganze Leben als eine Schule betrachten,
ein Weltumsegler durch alle Nationen, die er sieht,
weniger beeinflusst wird, als durch seine Mutter.»
August Hollmann, Neue Zürcher Zeitung, 28. Februar 1874
In einem Vortrag in Aarau 1874, hob Hollmann unter den schweizerischen Kindergärten in St. Gallen, Frauenfeld, Genf und Lausanne denjenigen in St. Gallen hervor. Waisenvater Hirzel zur aktuellen
Lage der schweizerischen Kindergärten in der Neue Zürcher Zeitung vom 6. März 1874: «Da übergibt man der Leiterin 70 bis 80 Kleine, die in Schulbänke hineinzupferchen genötigt werden. Von
glücklichen Erfolgen bei Anwendung der aus Fröbels Kindergärten Spielbeschäftigungen kann keine Rede sein, da die Leiterin unmöglich zu Jedem kommen, auf Jedes sehen und Acht haben kann. Zu der
so unumgänglich nötigen Abwechslung mit Bewegungsspielen ist kein Raum vorhanden, und es hängt immer von der Jahreszeit und der Witterung ab, ob die Leiterin ihre lieben Kleinen mit stundenlangem
Stillsitzen abmartern müsse.» August Hollmann starb 1876 in Aarau.[2]
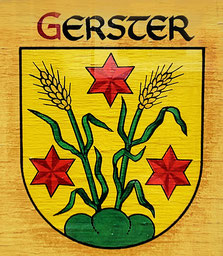
Abraham Adolf Gerster (1811-1875),
Philosoph, Pfarrer
Lehrer am Progymnasium von 1838 bis 1843
Fächer: deutsche Sprache und Religion
Adolf Gerster wurde am 4. Mai 1811 in Nidau geboren und war in Twann heimatberechtigt. Sein Vater war der Twanner Gerichtssäss Abraham Gerster. Zu seinen Geschwistern zählten: Samuel Friedrich,
Karl Ludwig, (später Pfarrer in Eriswil) und die Töchter Maria Carolina (heiratete Pfarrer Eduard Kistler in Bolligen) und Sophie Mathilde (heiratete Karl Ludwig Gerster, Architekt in
Bern). [7]
Er studierte am Gymnasium Biel. Dann begab er sich nach Bern, wo er von Lehrer Lutz Theologie studierte. 1835 wurde er ins Predigtamt aufgenommen und verbesserte seine Studien durch einen
Aufenthalt in Berlin. Einige Zeit leistete er Aushilfe als Vikar. Er trat in den Schuldienst über, als er 1838 ans Progymnasium Biel gerufen wurde, dem er einst als Schüler angehört hatte und nun
5 Jahre blieb. [8] Zu seinen Schülern gehörte unter anderem der bernische
Erziehungsdirektor Kummer.[12]
Gerster hatte hervorragende Kenntnisse in der Theologie, in mathematischer Wissenschaft (in der Jugend sein Lieblingsfach) und in alten Sprachen. Durch das Federzeichnen war er auch der Kunst
angetan, dies führte zur Mitgliedschaft der Berner Künstlergesellschaft. 1843 wurde er unter 18 Bewerbern zum Pfarrer von Ferenbalm gewählt, wo er 31 Jahre in diesem Amt wirken sollte.
Adolf Gerster heiratete dreimal. Seine erste Frau Maria Magdalena Klingenstein, die früh verstarb, heiratete er 1840 noch als Lehrer in Biel. Im
folgenden Jahr führte er Elise Engel vor den Traualtar von Twann, doch auch sie starb kaum ein Jahr später und hinterliess ihm das neugeborene Kind Adolf.[8]
Nur mit Mühe erholte er sich von seinen Schicksalsschlägen und erst 1852, nachdem er seine Mutter verloren hatte, heiratete er Karoline (Lina) Scheuermeister, Pfarrerstochter vom Madiswil. Sie
folgte ihm 1852 nach Ferenbalm, wo Adolf Gerster als Pfarrer wirkte. Lina wurde von Jeremias Gotthelf im Roman «Anne-Bäbi Jowäger» (1843/44) unter dem Namen «Sophie» verewigt. Gotthelf: «Sophie
war ein starkes, stolzes Mädchen, das nicht leicht sich bloss gab, seine Gefühle in sich zu verwenden wusste, mit seinen Grundsätzen aber nicht hinter dem Berg hielt. Sie war weich im Herzen.»
Ihre Mutter, Caroline Scheuermeister-Lüthardt, starb am 8. April 1853 im Pfarrhaus Ferenbalm. Sie war die Hauptfigur der Romangestalt aus Gotthelfs Werk «Die Frau Pfarrerin - Ein Lebensbild»
erschienen 1855.
Adolf Gerster erhielt durch seine dritte Ehe zwei Töchter: beim erstgeborene Kind Marie Elise war Gotthelf Taufpate. Der Schriftsteller trug sich am 21. Juli 1853 mit seinem bürgerlichen Namen
«Albrecht Bitzius von Bern Pfarrer in Lützelflüh» als Taufzeuge in den Taufrodel von Ferenbalm ein.[11] Die zweite Tochter starb bereits 1857 im Alter von 2 Jahren. Inzwischen studierte sein heranwachsender Sohn Medizin. Mit ihm unternahm er eine Reise nach
Sizilien. Im Pfarrhaus hatte sich noch der Grossvater einquartiert. Dieser war in Twann sozusagen heimatlos geworden, nachdem er seine Lebensgefährtin verloren hatte.
Gerster war Mitglied des bernischen protestantisch-kirchlichen Hilfsvereins. Oft wanderte er zu Fuss im Kanton Freiburg herum, abgelegene Schulhäuser reformierter Bewohner aufsuchend. Als
Mitglied der reformierten Kirchensynode von Murten beeinflusste er den protestantischen Teil des katholischen Kantons Freiburg als Berater einer freien Kirchenverfassung. Auch gehörte er während
einiger Jahre der bernischen Kirchensynode an. Hier musste er sich einmal für seinen Freund Pfarrer Chavannes von Motier einsetzten, der den damaligen kirchlichen Stürmen zum Opfer fallen sollte.
Für Gerster war es nicht einfach, da ihm nun plötzlich seine älteren Freunde als Gegner gegenüber standen. Am 22. April 1868 wurde er in Bern zusammen mit seinem Bruder Karl Ludwig, Pfarrer in
Eriswil, in die Gesellschaft der Möhren aufgenommen. Adolf Gerster erlebte noch, wie sein Sohn als Arzt amtete, als er mit 64 Jahren unerwartet an einer heftigen Krankheit am 5. Januar 1875
starb. Er wurde in seiner Kirche begraben.[8]
Schriften: «Das Gefecht in Ruhsel», eine Episode von einem Kampf gegen die Franzosen 1798 aus seiner Heimat am Bielersee. Der Ruhsel oder Nidauwald war ein zweigeteilter Fussweg von Biel
bis nach Neuenstadt. «Die Gesellschaft zum Mohren in Bern» erschien 1870 im Berner Taschenbuch.
Philipp Wilhelm K
1838-
1843
Quellen/Sources: 1) Jacob Wyss, Das Bieler Schulwesen 1815 - 1915, Band 2, Biel 1926; - 2) Schweizerische Lehrerzeitung, Nr. 19, 6. Mai 1876, S. 164; - 3) Neue Zuger Zeitung, 27. 10. 1866, S. 2; - 4) O. Graf, 100 Jahre Sekundarschule Langenthal in Der Bund, Bern, 20. Juni 1935, S.1; - 5) Bieler Tagblatt, 12. 1. 1952, S. 7; - 6) Arnold Gurtner & Simon Kuert, Die Anfänge der modernen Schule in Oberaargau, Schulplattform Oberaargau, S. 8, PDF; - 7) Werner Bourquin, «Die Gerster von Twann und das Gersterhaus» in Bieler Tagblatt, Biel, 12. 8. 1960, S. 3; - 8) Emil Blösch, «Abraham Adolf Gerster - Pfarrer in Ferenbalm» in Sammlung bernischer Biographien, Band 4, Bern 1902, S. 35; - 9) Werner und Marcus Bourquin, Biel Stadtgeschichtliches Lexikon, Büro Cortesi, Biel, 1999; - 10) Berner Taschenbuch, 1865, als Zusammenfassung im Bieler Tagblatt vom 16. 11. 1977; - 11) W. Aeberhardt, Der Bund, Bern, 19. 9. 1954, S. 5; - 12) Der Murtenbieter, Murten, 20. Januar 1875, S. 1; - 14) n. r., Chronik der Stadt Zürich, Zürich, 28. 2. 1914, S.101; - 15) Friedrich Denner, «Das Pensionat im Gymnasial-Gebäude zu Biel» in Der Bund, Bern, 16. 1. 1853, S. 64; - 16) «Friedrich Denner» in Tagblatt der Stadt Biel, Biel, 1. August 1868, S. 4; - 17) «Bielerisches» in Bieler Tagblatt, Biel, 29. Juni 1949, S. 2; - 18) Mirio Woern, Die Waldungen der Burgergemeinde Biel, Historisches Institut der Universität Bern, 2019, PDF, S. 34ff; - 21) Gustav Grunau, «Die Hallermedaille und ihre Geschichte» in Schweizerische Numismatische Gesellschaft, Nr. 12, Genf, 1904, S. 58f; 22) Albert Hafner, Das UNESCO-Welterbe prähistorische Pfahlbauten um die Alpen im Kanton Bern, in Jahrbuch des archäologischen Dienstes des Kantons Bern, Bern 2012, S. 239; - 23) «Albert Jahn - ein bernischer Altertumsforscher» in Die Berner Woche in Wort und Bild, Nr. 18, Bern, 1916, S. 209f; - 24) «Bürgerrecht für Immanuel Friedrich Denner» in Verhandlungen des Grossen Rathes der Republik Bern, 5. Sitzung, Erste Hälfte 1840, S. 5; - 25) Verstorbene in Seeländer Bote, Biel, 17. 2. 1859, S. 3; - 26) «Stadtbibliothek Biel in Seeländer Bote, Band 13, Biel, 28. 1. 1862, S. 3; - 27) Ed. Schaffner, «100 Jahre Allgemeine Krankenkasse von Biel und Umgebung» in Bieler Tagblatt, 23. 2. 1938, S. 4; - 28) Import- und Grosshandels AG. Zürich in NZZ, Zürich, 23. 10. 1948, S. 5; - 29) «Überfall auf Heinz Denner» in NZZ, Zürich, 23. 3. 1934, S. 2; - 30) Charles Geiger, «Privatklinik Dr. med. Sauerbruch im Kreis 7», Online auf Forum alt-Zürich.ch; - 31) hrb., «Hans Denner siebzigjährig» in NZZ, Zürich, 17. 10. 1953, S. 25: - 32) Fridolin, «Bieler Brief» in Bieler Tagblatt, Biel, 28. 10. 1941, S. 5; - 33) Fridolin, «Bieler Brief» in Bieler Tagblatt, Biel, 8. 10. 1943, S. 5; - 34) Fridolin, Bieler Brief, Bieler Tagblatt, Biel, 2. 1. 1936, S. 6
Postadresse: Altstadtleist Biel, Obergässli 11, 2502 Biel/Bienne. Lokal: Brunngasse 11, Tel. 032 323 42 84,
Öffnungszeiten auf Anfrage
Adresse postale: Guilde de la vieille ville, Ruelle du Haut 11, 2502 Biel/Bienne. Local: Rue des Fontaines 11, Tel: 032 323 42 84.
Heures d'ouverture sur demande.
