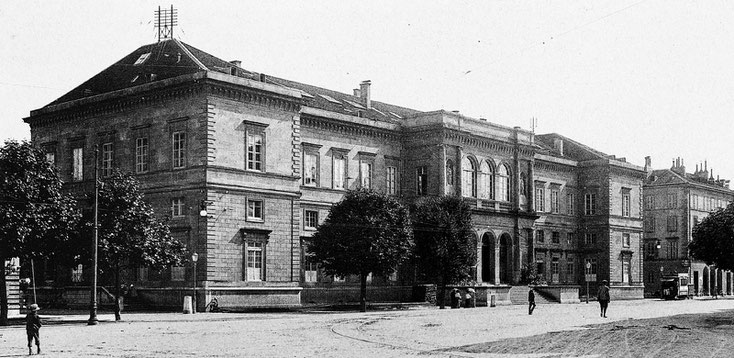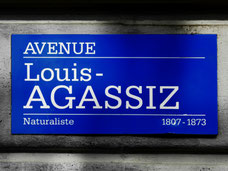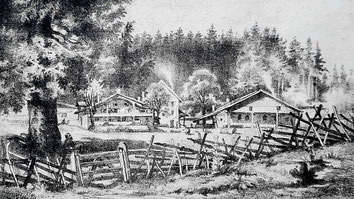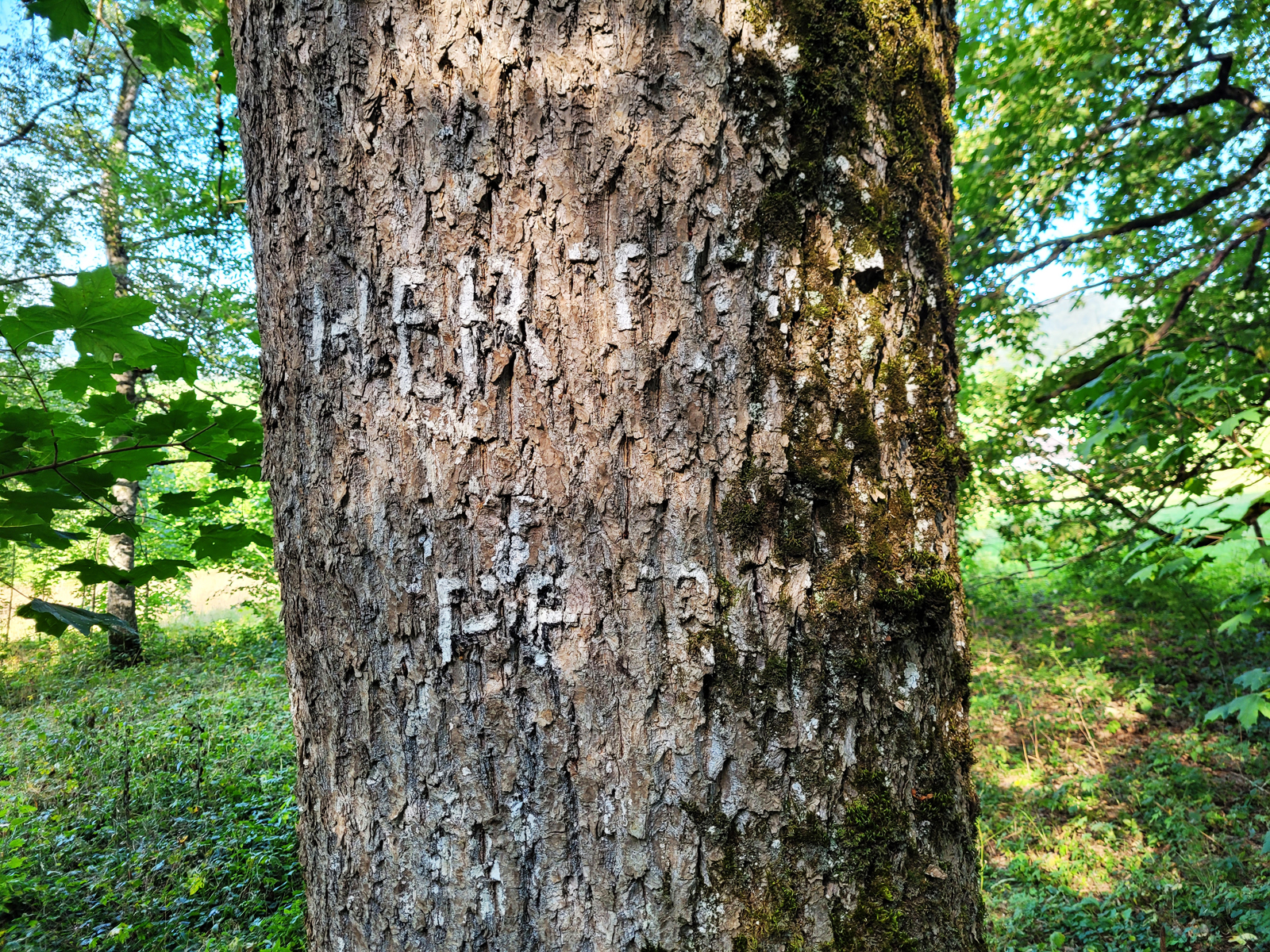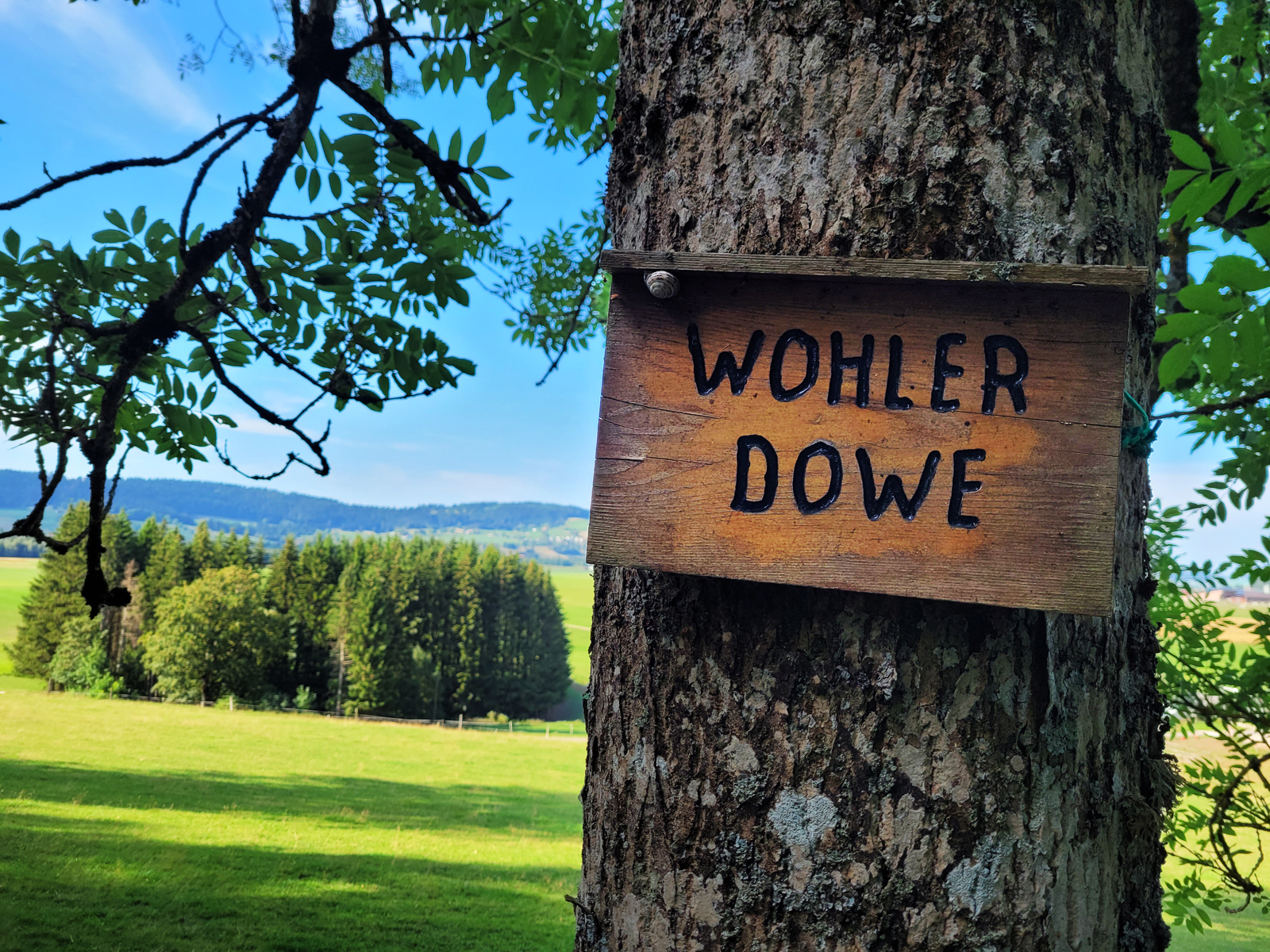- Brunngasse / Rue des Fontaines
- Burgplatz / Place du Bourg
- Burggasse / Rue du Bourg
- Jakob-Rosius-Strasse / Rue Jakob-Rosius
- Kanalgasse / Rue du Canal
- Kirchgässli / Ruelle de l'Eglise
- Obergasse / Rue Haute
- Obergässli / Ruelle du Haut
- Quellgasse / Rue de la Source
- Ring
- Römergässli / Rue des Romains
- Schmiedengasse / Rue des Maréchaux
- Untergasse / Rue Basse
- Untergässli / Ruelle du Bas
- Juravorstadt / Faubourg du Jura
- Mühlebrücke / Pont du Moulin
- General Dufour-Strasse / Rue du Général-Dufour
- Das Dufour Schulhaus - Überblick
- Das Dufour Schulhaus - Kloster und Spital
- Das Dufour Schulhaus 1818-1819
- Das Dufour Schulhaus - Abram-Emmanuel und Edouard Tièche
- Das Dufour Schulhaus 1818 - Louis Agassiz
- Das Dufour Schulhaus 1820-1827
- Das Dufour Schulhaus 1828-1835
- Das Dufour Schulhaus - Lehrer in geheimer Mission
- Das Dufour Schulhaus 1836-1838
- Das Dufour Schulhaus 1837 Jean Joseph Hisely
- Das Dufour Schulhaus 1839-1842
- Das Dufour Schulhaus 1843-1849
- Das Dufour Schulhaus 1845 Albert Friedrich Haller
- Das Dufour Schulhaus Kinder der Fabrik
- Das Dufour Schulhaus 1850-1869
- Das Dufour Schulhaus - Armin und Arnold Mueller
- Das Dufour Schulhaus 1870-1880
- Das Dufour Schulhaus 1881-1887
- Das Dufour Schulhaus 1885 - Hermann Aegler
- Das Dufour Schulhaus 1888 Robert Walser I
- Das Dufour Schulhaus 1888 Robert Walser II
- Das Dufour Schulhaus 1888-1891
- Das Dufour Schulhaus 1891 Grock
- Das Dufour Schulhaus 1892 - Gottlieb Hauser
- Das Dufour Schulhaus 1892-1895
- Das Dufour Schulhaus 1896-1898
- Das Dufour Schulhaus 1893 - Eduard Amsler
- Das Dufour Schulhaus 1896 - Hermann Hubacher
- Das Dufour Schulhaus 1897 - Emil Meyer
- Das Dufour Schulhaus - Die Familie Lanz
- Das Dufour Schulhaus 1897 - Fritz Antenen
- Das Dufour Schulhaus 1899-1905
- Das Dufour Schulhaus 1902 Werner Bourquin
- Das Dufour Schulhaus 1902 - MAURICE UND ANDRÉ VAUCHER
- Das Dufour Schulhaus 1905 - Karl Schoechlin
- Das Dufour Schulhaus 1906-1908
- Das Dufour Schulhaus 1908 - Hans Schoechlin
- Das Dufour Schulhaus 1909-1910
- Das Dufour Schulhaus 1911-1950
- Das Dufour Schulhaus 1951-2011
Das Dufour-Schulhaus / L' école Dufour 1818


Jean Louis Rodolphe Agassiz (1807-1833), Naturforscher, einer der ersten Bieler Gymnasiasten
Schüler des Gymnasiums von 1818 bis 1822
Das Geschlecht Agassiz, Agassis oder Agasse stammt ursprünglich aus Orbe und Bavois, zwei in der Nähe gelegene Waadtländer Bauerndörfer nahe Yverdon. Antoine Agasse war zwanzig Jahre lang Schlossherr von Orbe. Er wurde am 23. Juni 1531 abgesetzt weil er den Lutheranern feindlich gesinnt war und sich den Predigten von Hollard und Viret widersetzte. Er starb am 7. Juli 1551 in Orbe. Diese Familie stellte von da an zahlreiche Verwaltungs- und Gerichtsbeamte in der Stadt und der Vogtei Orbe.[118] In Bavois ist 1539 ein Pierre Agassiz nachweisbar. Einer seiner Nachkommen war Jean-François Agassiz, der 1681 als Pfarrer in Payerne starb. Er war der erste in der Kette von sechs Pfarrern, die der Geburt des Naturforschers vorausgehen.[119] Das Wappen der Familie Agassiz zeigt eine schwarze Elster auf silbernem Grund (Pie noire sur fond d'argent).[94]
Jean Louis Rodolphe Agassiz wurde am 28. Mai 1807 in Môtier-Vully am Murtensee geboren. Sein Vater Louis Benjamin Rodolphe (1776-1837) war dort Pfarrer, seine Mutter Marianne Rose (1783-1867) die Tochter des bekannten Cudrefiner Landarztes Jean-Daniel Mayor (1752-1830). Louis war der älteste seiner Geschwister, dem Bruder Auguste (1809-1877) und den Schwestern Cecile (1811-1891) und Olympe (1813-1886). Sein Vater, ein leidenschaftlicher Fischer, nahm ihn und Auguste oft mit sich aufs Boot, und machte aus den Brüdern perfekte Angler. Keine sieben Jahre alt, hatte Louis sein Aquarium im Brunnentrog des Gartens. Um schön präparierte Skelette zu erhalten, grub der kleine Forscher die Fische in Ameisenhaufen ein. Wenn er sie nach einigen Tagen wieder herausholte, waren die Gräte sauber abgenagt, und er konnte ihre Zusammensetzung genau erkennen.[32]
Während der Badesaison und weit entfernt vom Seeufer, in Môtier oder in Cudrefin, durchsuchten die Brüder Agassiz jeden Stein, unter dem sich ein Fisch verstecken konnte und jedes Mauerloch, das vom Wasser umspült wurde. Sie wurden so geschickt, dass sie kein Fanggerät mehr brauchten, um Fische zu fangen. Es gelang ihnen sogar, einige Arten im See mit der Hand und nur mit kleinen Hilfsmitteln zu fangen. Dies war der Anlass für die bemerkenswerte Veröffentlichung von Louis Agassiz «Histoire naturelle des poissons d'eau douce de l'Europe centrale.» (Naturgeschichte der Süsswasserfische Mitteleuropas)[1]
Links: Geburtshaus von Agassiz in Motier-Vully, abgedruckt in «Louis
Agassiz, his life and correspondence, Vol. 1», von Elizabeth Cabot Agassiz, Boston, 1885, S. 9. Foto: AEN, Louis Agassiz, 4.6
Rechts: Der steinerne Brunnen (Agassiz-Aquarium) im Garten, gezeichnet von Frau Elliot. Reproduktion aus «Louis Agassiz, his life and correspondence, Vol. 1», von Elizabeth Cabot Agassiz, Boston, 1885.
Am Bieler Gymnasium
Nachdem der junge Agassiz sein Elternhaus verliess, trat er als 11-jähriger Pensionär von 1818 bis 1822 ins Bieler Gymnasium ein. Zu seinen Mitschülern zählten
laut «Schülerverzeichnis vom Gymnasium Biel 1817-1834» [12] vom Stadtarchiv Biel u.a.:
1817-18 Alexander Schweizer (1808-1888), Theologe
1817-19 Emanuel Schwab (1804-1865), Politiker
1817-19 Jules Albert Morel (*1804)
1817-21 Cäsar Adolf Bloesch (1804-1863), Arzt
1817-21 Friedrich Schwab (1803-1869), Archäologe, Oberst
1817-23 Eduard Eugen Bloesch (1807-1866), Landammann
1818-19 Charles-Louis Verdan (1808-1863), Indienne-Fabrikant
1818-20 Alfred Emile Schaffter (1804-1884)
1818-21 Charles Amédée Schaffter (1802-1860), Arzt
1819-22 Auguste Agassiz (1809-1877), Uhrenfabrikant
Schüler erzählen
Alexander Schweizer: «Eine Bekanntschaft verdanke ich dem gastlichen Umgang meiner Grosseltern mit einer waadtländischen Pfarrersfamilie, welche bisweilen bei uns, oder wir, besonders zur
Weinlese, bei ihr zu Besuch waren. Von den beiden Knaben, die damals meine Spielgenossen waren, hat der ältere, Louis, den Namen Agassiz berühmt gemacht. In Biel wurde für den Kantonsteil sofort
ein Gymnasium gegründet, dessen Direktion samt der ersten Pfarrstelle dem schriftstellerisch bekannten Johann Konrad Appenzeller, spezieller Freund meines Vaters, zufiel. 1818 trat ich als
10-jähriger Knabe ins Bieler Gymnasium und in die Pension von Frau Bloesch. Dort traf ich Agassiz wieder. Ihn nahm ich gewöhnlich des Sonntags zum Mittagessen ins elterliche Pfarrhaus mit. Nicht
ohne Stolz sind wir in der graublauen Uniform der Bieler Gymnasiasten zu Nidau eingezogen, ich ohne zu ahnen, welche spätere Berühmtheit neben mir einherging. Zuletzt hatte ich Agassiz in Zürich
wiedergetroffen, wo er mit seinem früh verstorbenen Bruder August Medizin und Naturwissenschaften studierte.»[74]
Die Theologie und die Evolutionstheorie
Man kann nicht über Agassiz schreiben, ohne seine tiefe Religiosität zu erwähnen, die er mit seinen Forschungen verband und die ihn später in Amerika als «Prediger
der Naturwissenschaften» bekannt machte.
Die Naturwissenschaft hatte mit grossem Interesse begonnen, über die Schöpfungsgeschichte zu debattieren, es gab etwa 50 Theorien. Die einen glaubten an eine zusammenhängende und ununterbrochene
Erdgeschichte. Die anderen meinten, die bestehenden Arten seien die abgewandelten Nachfolger der letzten, die der Schöpfer jeweils durch eine planvolle Katastrophe vernichtet habe. Vertreter der
letzteren Theorie und Gegner Darwins war zu Agassiz‘ Bieler Gymnasialzeit der Rektor Johann Conrad Appenzeller. Ob Louis Agassiz und sein Mitschüler Cäsar Adolf Bloesch, die später an die gleiche
Theorie glaubten, von Appenzeller im Gymnasium beeinflusst wurden, ist möglich, aber nicht belegt.
- Johann Conrad Appenzeller (1775-1850) war in Biel erster Prediger an der deutschen Kirche und erster Direktor des Gymnasiums. Bei seiner Taufe erhielt er den Vornamen Johann Conrad, damit er
durch seine Initialen J. C. A. stets an «Jesus Christus, Amen» erinnert werde. [72] Zu seinen Schüler gehörte der ebenso fromme Louis Agassiz. Appenzeller
interessierte sich für Geologie und war Mitglied der Naturforschenden Gesellschaft. Der verstorbene Naturforscher Max Antennen berichtete im Bieler Jahrbuch 2008 über Appenzeller und zitierte
ihn: «Appenzeller erzählte: ‹Ich erblicke jene seit Jahrtausenden hier (in Biel) thronenden Granitblöcke, als Ruinen eines früheren Weltalters. Sie, diese Denkmäler einer ungeheuren
Erdrevolution, sollen zu einer Zeit hierher geflutet worden sein, wo sich aus der Nacht einer zertrümmerten Weltordnung, eine neue Erde gestaltete. Wo diese Bergwelle, der Jura selbst, zu einer
mit der hohen Alpenmauer gleichlaufenden hundert Stunden langen Schanze gerann.› Was Agassiz über die Bieler Erratiker etwa 20 Jahre später schrieb, erinnert an Appenzeller, welcher am
Bieler Gymnasium auch Religion unterrichtete. Beide, der Lehrer und der Student, denken an machtvolle Wasserwellen, hervor gerufen durch Erdkräfte, als sich aus den Trümmern einer zerstörten
Weltordnung eine neue geformt habe.»[71]
- Der Arzt Cäsar Adolf Bloesch war wie Agassiz ein Gegner Darwins. In seinem Buch «Unglaube und Aberglaube» erklärt Bloesch: «Durch die langen Forschungen eines Cuvier, Agassiz und Buckland beweisen die naturhistorischen Tatsachen: dass die Erde nicht immer von Lebewesen bewohnt war; dass verschiedene Schöpfungen vor der gegenwärtigen existiert haben; dass mehrere Schöpfungen durch ausserordentliche Naturereignisse plötzlich zugrunde gegangen sind; dass jede spätere Schöpfung eine grössere Vollkommenheit der organischen Wesen aufweist; dass die organischen Wesen erst in der letzten Schöpfung im Menschen die höchste Vollkommenheit gefunden haben. Durch vergleichende Anatomie wird der Beweis geführt, dass keine Übergänge von den vorsintflutlichen versteinerten Geschöpfen in die jetzt noch lebenden Arten stattfinden; dass die untergegangenen Arten als die jetzt noch lebenden Arten als etwas ganz Abgeschlossenes und Vollendetes betrachtet werden müssen; dass die Erschaffung aller Wesen kein Zufall war, sondern dass ein und derselbe Geist mit der höchsten Stufe der Weisheit immer nach den gleichen Grundsätzen gewirkt hat.»[76]
Zweisprachiger Aufsatz (Double leçon, français-allemand) von Agassiz, verfasst im Gymnasium Biel. Agassiz signierte seine Schularbeiten mit Louis oder Ludwig. Foto: AEN, Agassiz, IV. Etudes, A. Bienne, 12/1.1.
Ein talentierter Schüler
In der Schule galt Agassiz als besonders fleissig und begabt. Eine schöne Zeichnung, die er in dieser Zeit anfertigte und seinen Eltern zu Neujahr schickte, bewies seine genaue Beobachtungsgabe. 1818 gehörte er zu den 23 Preisträgern an der Solennität: Für seine herausragenden Leistungen erhielt er das Buch «Beauté de l’Histoire Sainte». Auch 1820 und 1821 wurde Agassiz als Preisträger aufgeführt. 1821 durfte er die Solennitätsrede halten.
Elisabeth Cary Agassiz berichtete in ihrem Buch «Louis Agassiz - Leben und Briefwechsel» über den Aufenthalt im Bieler Gymnasium: Die Schulbücher und die kleine Hausbibliothek genügten dem wissbegierigen Gymnasiasten bald nicht mehr. In einem Brief an seinen Vater bittet der 14-jährige Gymeler: «Ich wünsche in den Wissenschaften vorwärts zu kommen und dazu bedarf ich d’Anville, Ritter, ein italienisches Wörterbuch, einen griechischen Strabo, Mannert und Thiersch und ausserdem die Schriften von Malte-Brun und Senfert. Ich habe beschlossen, sofern es mir gestattet wird, ein Schriftsteller zu werden und gegenwärtig kann ich in folgenden Fächern nicht vorwärts kommen: 1) Zu alter Geographie, denn ich kann schon alle meine Notizbücher auswendig und habe keine anderen Bücher, als die, welche Rickly mir leiht; ich muss d’Anville oder Mannert haben; 2) in neuer Geografie habe ich nur den Osterwalde, welcher nicht mit den neuen Einteilungen stimmt; dafür müsste ich Ritter oder Malte-Brun haben; 3) für das Griechische brauche ich eine neue Grammatik und werde den Thiersch wählen; 4) fehlt mir ein italienischen Wörterbuch; 5) brauche ich für das Lateinische eine grössere Grammatik als meine bisherige und ich möchte gern die von Seyfert haben; 6) sagt mir Herr Rickly, dass er mir, da ich Geschmack an Geographie habe, eine griechische Stunde geben wolle (gratis), in der wir den Strabo übersetzen könnten, vorausgesetzt, dass ich mir einen verschaffen kann. Für all diese Anschaffungen müsste ich ungefähr 12 Louis’dor haben.»
Agassiz beeindruckte durch seine grosse Sprachbegabung, neben seiner Muttersprache Französisch sprach er Deutsch, Englisch, Italienisch, Latein und Griechisch. Im Zentrum seines Interessens standen jedoch die Naturwissenschaften. Diese Faszination teilte er mit seinem Mitschüler Cäsar Adolf Bloesch, den er später als Medizinstudent in Zürich wieder traf.[9] Agassiz behielt die Bieler Schule und ihre Lehrer zeitlebens in guter Erinnerung. Neben seinen Studien beschäftigte er sich mit Fischfangen und legte damit den Grundstein für seine späteren Werke.
Das erste Tattoo
Um die Bewunderung für seine Cousine auszudrücken, liess sich Agassiz ihren Namen mit Schwefelsäure auf den linken Arm tätowieren. Das Ergebnis war ein Fieberanfall und eine dreiwöchige
Ruhigstellung des Arms, der seine Tat vor der ganzen Familie verriet.[94]
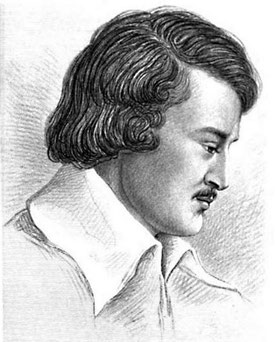
Portrait des 17jährigen Louis Agassiz als Pastel-Zeichnung von Cecile Braun. Reproduktion aus «Louis Agassiz, his life and correspondence, Vol. 1», von Elizabeth Cabot Agassiz, Boston, 1885.
Im Collège in Orbe
Die vier Jahre, die Agassiz auf Wunsch seiner Eltern in Biel verbringen sollte, gingen schnell zu Ende. Die Eltern lebten seit 1821 im mittelalterlichen Dorf Orbe, wo der Vater als Pfarrer und Aushilfslehrer tätig war. Louis Agassiz besuchte dort nun das Kollegium.
C.-F. Girard schreibt in seinem Tagebuch: «Das Collège in Orbe wurde nur von sechs bis acht Schülern besucht, die alle in einer Klasse zusammengefasst waren. Die einen übersetzten bereits ‹Cäsar› oder ‹Cornelius Nepos›, während die Jüngeren ‹Mensa› deklinierten. Mein älterer Bruder und Agassiz waren im selben Alter und bereiteten sich zusammen auf ihre Aufnahmeprüfungen an der Akademie in Lausanne vor. Das Studierzimmer befand sich im oberen Teil des Pfarrhauses. Wenn Agassiz zu Bett ging, befestigte er eine Schnur an seinem rechten Bein, die durch ein kleines Loch im Fenster bis auf einige Fuss über den Boden führte. Mein Bruder weckte ihn, indem er an der Schnur zog. Manchmal waren mehrere Anläufe nötig, weil die Mechanik nicht richtig funktionierte oder der Schläfer auf taube Ohren stiess.»[70]
Lausanne
Von 1822 bis 1824 setzte Agassiz seine Studien an der Akademie von Lausanne fort. Er freundete sich bald mit Daniel-Alexandre Chavannes (1765-1848) an, dem Direktor des kantonalen Naturhistorischen Museums, der grossen Einfluss auf die weitere Laufbahn des jungen Agassiz ausübte. Chavannes gab in seinem Haus Privatunterricht. Er verstand das Ausstopfen der Vögel und das Präparieren der Säugetiere und Skelette, schloss Reptilien und Fische in Spiritusgläser ein und ordnete seine Sammlung nach Cuviers «Règne animal». Die Wirbellosen klassifizierte er nach Lamarck, lehnte jedoch dessen Abstammungslehre ab. Die Reihe der Lebewesen betrachtete er als Ergebnis der fortgesetzten Arbeit des Schöpfers.[119] Agassiz fühlte sich mehr und mehr zum Studium der Naturwissenschaften hingezogen.
Kaufmann? Nein, Danke
Der junge Student sollte eine kaufmännische Lehre absolvieren, konnte sich aber beim besten Willen nicht dazu entschliessen. Agassiz flehte seine Eltern an, den
Lehrbeginn noch aufzuschieben und rief seinen Direktor und seine Lehrer zu Hilfe. Dank der Intervention seines Onkels Mayor, eines bekannten Lausanner Arztes, verzichteten die Eltern auf eine
kaufmännische Laufbahn und erlaubten Agassiz, ein Medizinstudium zu beginnen.
Doch schon wartete eine erste Enttäuschung auf ihn: Im Protokoll der Sitzung des Akademischen Rates vom 10. Juni 1823 hiess es: «Der junge Agassiz bittet, die Prüfungen für die Promotion in
Philosophie ablegen zu dürfen, obwohl er nicht das erforderliche Alter hat, und gibt als Grund an, dass er vorhat, Medizin zu studieren und nicht das Studium des Heiligen Ministeriums zu
absolvieren. Wir glauben nicht, dass wir ihm diese Gunst gewähren müssen, aber wir gestatten ihm, die Prüfungen für beide Studiengänge abzulegen und als Externer den Philosophieunterricht zu
besuchen.»[1] Im darauf folgenden Jahr verliess der zukünftige Naturforscher die Akademie in Lausanne.
Zürich
Mit 17 Jahren trat Agassiz 1824 als Medizinstudent in der Universität Zürich ein. Dort
interessierten ihn vor allem die Vorlesungen von Heinrich Rudolf Schinz (1777-1861), Lehrer der Naturgeschichte und Physiologie. Schinz gab Agassiz den Schlüssel zu seiner Privatbibliothek und zu
seiner Vogelsammlung. [8] Von 1824 bis 1825 war Agassiz Mitglied der Studentenverbindung Zofingia.[113] Am Dienstag den 13. September 1825 fand in Zürich das
«Schiessen der Herren Studenten des medizinischen Institutes» statt. Zu den Gewinnern in den Kategorien Stich und Kehrscheibe zählte Louis Agassiz.[117]
Fortsetzung der Studien in Deutschland
Im Frühjahr 1826 wechselte er an die Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, wo der berühmte Anatom Friedrich Tiedemann (1781-1861) wirkte.[1] Die naturwissenschaftlichen Institute mit ihrer reichen Sammlungen befanden sich im ehemaligen Dominikanerkloster. Der Hörsaal, in dem Tiedemann mit priesterlicher Stimme vorlas, war die frühere Klosterkirche.[119] Agassiz studierte weiter an der neu eröffneten Ludwig-Maximilians-Universität in München.[1] Hier wirkten Schelling, Oken, Martius, Döllinger, Wagler, Zuccarini, Fuchs, von Kobell u.a., die nicht nur seine Lehrer, sondern auch seine Freunde wurden.
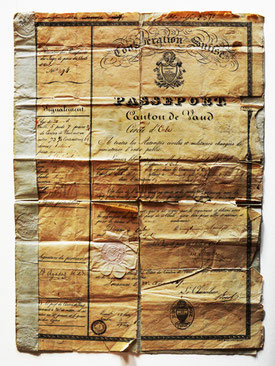
Pass Nr. 294 vom 22. 8. 1827 des Friedensrichters des Kreises Orbe für Louis Agassiz, der über Karlsruhe und Frankfurt nach München reist mit der Absicht, dort seine Studien fortzusetzen.
Foto/Text: AEN, Louis Agassiz I. Papiers personnels - Souveniers, 1/1.2
Mit Interesse las Agassiz das «Lehrbuch der Naturphilosophie» des deutschen Naturforschers Lorenz Oken (1779-1851). In seiner Naturgeschichte für Schulen teilte Oken die Menschenrassen nach ihrer Sensualität ein: in Fühlmenschen (Schwarze), Schmeckmenschen (Australier), Nasenmenschen (Amerikaner), Ohrenmenschen (Asiaten), und Augenmenschen (Europäer). Für Oken erhielt der Mensch alle organischen Formen der Natur, während die Tiere als Föten menschliche Züge annahmen. Der Mensch war somit die 17. Zunft der Säugetiere. Als Agassiz einmal Oken besuchte, zeigte ihm Oken das Laboratorium und die Studenten bei der Arbeit, sein Kabinett und schliesslich seine prächtige Bibliothek. Beim Abendessen sagte Oken: «Herr Agassiz, diese Bibliothek zusammenzustellen und zu erhalten, erfordert die grösste Schonung meiner finanziellen Mittel. Um dies zu erreichen, gönne ich mir keinen Luxus, daher beschränkt sich meine Tafel auf die einfachste Kost. Dreimal in der Woche gibt es Fleisch zum Abendessen, an den übrigen Tagen nur Kartoffeln und Salz. Ich bedaure sehr, dass Ihr Besuch auf einen Kartoffeltag fällt.»[110]
Die kleine Akademie
Agassiz richtete in einem Zimmer des Döllingerhauses einen Studenten-Treffpunkt ein, in dem regelmässig wissenschaftliche Debatten stattfanden. Er nannte diesen Treffpunkt «Kleine Akademie» und war ihr Präsident. Agassiz‘ Zimmer war Schlafzimmer, Studierzimmer, Museum, Bibliothek, Lesezimmer und Fechtsaal in einem. Döllinger demonstrierte hier seine embryologischen Untersuchungen, bevor er sie der wissenschaftlichen Welt bekannt gab, und lehrte Agassiz den Gebrauch des Mikroskops für embryologische Studien. Der Anatom Meckel kam hierher, um Agassiz‘ Sammlung von Fischskeletten zu bewundern, von der ihm Döllinger erzählt hatte. Michaelis stellte die Resultate seiner Forschungen in der Adria vor, Born zeigte seine schönen Präparate über die Anatomie der Lampreten, Rudolphi hielt Vorträge über die bayerischen Alpen und die Küsten der Ostsee. Die Botaniker Karl Friedrich Schimper (1803-1867) und Alexander Braun (1805-1877) diskutierten die Gesetze der Blattstellung. Während Braun von Agassiz Zoologie lernte, lernte Agassiz von Braun Botanik. Zwischen den beiden entstand eine langjährige Freundschaft. In den Ferien besuchte Agassiz die Familie Braun in Karlsruhe.
Alexander Braun schrieb am 12. Mai 1826 an seinen Vater: «Ich lerne sehr viel von Agassiz, denn er weiss in der Zoologie mehr als ich. Er kennt fast alle bekannten Säugetiere; die Vögel erkennt er schon von weitem am Gesang, und jeden Fisch, den er im Wasser sieht, weiss er zu benennen. Wir waren schon öfter des Morgens miteinander auf dem Fischmarkt, wo er mir alle Arten bestimmt und erklärt hat… Deutsch und Französisch spricht er gleich gut und auch ziemlich fertig Englisch und Italienisch… Auch die alten Sprachen kennt er gut. Er studierte auch Medizin nebenbei.»[119]

Kurse von Friedrich Wilhelm Joseph Schelling
Einen inspirierenden Eindruck auf Agassiz machten die Kurse von Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775-1854), der Philosophie lehrte. Die Titel seiner Kurse waren u. a. «Einführung in die Philosophie», «Die Zeitalter der Welt», «Die Philosophie der Mythologie» und «Die Philosophie der Offenbarung».
Eintrittskarte für Louis Agassiz zu den Schelling-Vorlesungen des Winter-Halbjahres 1828-29 in München. Foto: AEN, Agassiz, I. papiers personnels-Souveniers, 1/1.3
Viele Hypothesen, die in der modernen Physik eine grosse Rolle gespielt haben, wie die Metamorphose der Pflanzen, die Homologien des Skeletts, der Ursprung der Arten, fanden sich in den frühen Werken Schellings. In seiner Offenbarungsphilosophie unterteilte Schelling die Geschichte der Kirche in eine prähistorische, eine historische und eine nachgeschichtliche. Arnold Guyot: «Auf den Einfluss Schellings, dessen Vorlesungen Agassiz jedes Jahr hörte, ist seine tiefe Überzeugung von der immateriellen Natur des Lebensprinzips zurückzuführen, die ihn veranlasste, die Vielfalt der Tierformen als Ausdruck ebenso vieler Gedanken des Schöpfers zu betrachten.» [111] Alexander Brown ergänzt in einem Brief vom 18. 11. 1828: «Es war selten, dass man in seinem Leben eine Reihe von Vorlesungen hörte, die so lehrreich und mitreissend sind wie die von Schelling über die Philosophie der Apokalypse. Bis jetzt glaubte man nicht, dass die Apokalypse ein Thema sei, das man philosophisch behandeln könnte, weil sie den einen zu heilig, den anderen zu irrational erschien.» [112]
Doktor der Philosophie
Das Medizinstudium war für Agassiz nur noch ein Vorwand, um noch einige Semester in akademischen Kreisen zu verbringen, wo er sich seinen bevorzugten Forschungen
widmen konnte. Dennoch promovierte er 1829 in einem Abstecher in Erlangen zum Doktor der Philosophie. Längst dachte Louis Agassiz nur noch daran, seine naturwissenschaftlichen Studien
fortzusetzen, seine Sammlungen zu erweitern und zu diesem Zweck ferne Expeditionen zu unternehmen. Besonderes Interesse wendete er der bevorstehenden Reise Alexander von Humboldt’s nach Asien zu.
Er liess durch General Laharpe, Erzieher von Kaiser Alexander und Nikolaus, mit dem seine Familie befreundet war, bei Humboldt anfragen, ob er als Assistent an der Expedition teilnehmen dürfe.
Leider ohne Erfolg.
Während seines Aufenthalts in München wurde Agassiz von dem Botaniker Carl Friedrich von Martius (1794-1868), der drei Jahre in Brasilien verbrachte, eingeladen, zusammen mit dem Zoologen Johann
Baptist Spix (1781-1826), die während dieser Expedition gesammelten Fische zu beschreiben. Agassiz schrieb sein Erstlingswerk «Die Fische von Brasilien» nach dem Tod von Spix allein zu Ende. Es
erschien 1829 in lateinischer Sprache. In München beschäftigte sich Agassiz mit den fossilen Fischen, wozu ihn Rudolf Wagner (1805-1864), der spätere Göttinger Anatom, ermunterte und wobei ihm
Schubert und Wagner die Fischsammlung der Universität zur Verfügung stellten. Es entstanden die Werke über die «Süsswasserfische Europas» und die «Fossilen Fische». Wagner, der übrigens die
gleichen theologisch-wissenschaftlichen Ansichten wie Agassiz vertrat, schrieb 1860 «Louis Agassiz‘ Prinzipien der Klassifikation der organischen Körper, insbesondere der Tiere, mit
Rücksicht auf Darwins Ansichten». In der Freizeit unternahm er kleine Reisen zu den Museen der grösseren Städte Mitteldeutschlands, um deren paläontologische Bestände zu studieren.
Doktor der Medizin
Für Agassiz' Plan, Naturforscher zu werden, hatten die Eltern immer noch nichts übrig. «Wir können wirklich nicht einwilligen», schrieb die Mutter, und der Vater: «Erwirb das Arztdiplom; etwas anderes will ich vorläufig nicht hören.» Oder er sagt: «Meinetwegen steig mit der Naturwissenschaft wie mit einem Ballon in die Höhe; aber die Medizin brauchst du als Fallschirm.»[119]
1830 promovierte Louis Agassiz in München zum Doktor der Medizin. Danach hielt er sich längere Zeit in Wien auf, um in den kaiserlichen Museen die Sammlung der
Donaustöre und die fossilen Fische des Monte Bolca zu studieren. ein besonderes Interesse galt den Cyprinoiden der Donau, so dass er beschloss, ein Werk über die Süsswasserfische Mitteleuropas
herauszugeben. Allerdings wurden davon nur einige Probeexemplare an verschiedene Freunde versandt. Die Juli-Revolution von 1830 verhinderte das Erscheinen des Druckes, den Cotta, ein Gönner von
Agassiz, besorgen wollte.
Louis Agassiz: «Ich war Doktor der Philosophie und der Medizin, Autor eines Bandes über die Fische Brasiliens. Ich war zu Fuss durch ganz Süddeutschland gereist,
hatte Wien besucht und weite Teil der Alpen erkundet. Ich kannte jedes lebende und fossile Tier in den Museen von München, Stuttgart, Tübingen, Erlangen, Würzburg, Karlsruhe und Frankfurt, aber
meine Zukunft war düster, mir fehlten die finanziellen Mittel, um meinen Weg in der Welt zu gehen, ausser in der praktischen Laufbahn der Medizin.»[2]

Ferien in Orbe
1821 verliess sein Vater Môtier und wurde zum zweiten Pfarrer des
Städtchens Orbe am Jurafuss ernannt. Von 1821 bis 1830 verbrachte Louis Agassiz seine Ferien in Orbe. 1820 beschloss die Gemeinde Orbe, Versuche zur Torfgewinnung aus den Mooren zu unternehmen.
Es ist daher anzunehmen, dass Agassiz die Idee hatte, die Torfgewinnung in den Mooren von Orbe mit der in der Region Vully angewandten Methode zu versuchen. Louis Agassiz nutzte seine Ferien, um
in Orbe die lokale Fauna und Flora zu studieren. Seine Anfänge in dieser Richtung wurden von einigen Männern gefördert, die sich neben ihren üblichen Beschäftigungen dem Studium der
Naturwissenschaften widmeten und mit denen der junge Agassiz in Kontakt kam. Unter ihnen war Marc-Louis Fivaz (1792-1876), Minister des Heiligen Evangeliums, der von 1816 bis zum 1824 Suffragan
des ersten Pfarrers von Orbe war. Er war ein leidenschaftlicher Botaniker. Als er Agassiz kennen lernte, war dieser erst 15 Jahre alt. Fivaz wurde somit der erste Botaniklehrer des zukünftigen
Naturforschers. Gemeinsam durchstreiften sie das Mittelland und den Jura und sammelten zahlreiche Pflanzen. Agassiz pflegte von jeder Art zwanzig Exemplare mitzunehmen, und zurück im Pfarrhaus
von Orbe begannen sie mit der mühsamen Arbeit, die Pflanzen in einer Sammlung zu ordnen. Unter der Leitung von Minister Fivaz begann Louis Agassiz mit dem Herbarium, das er später in Lausanne,
Zürich und dann in Deutschland vervollständigte. Zwischen dem Suffragan und Agassiz entwickelte sich eine enge Freundschaft, und so war es für beide ein grosses Unglück, als Fivaz 1824 Orbe
verlassen musste, weil man ihn beschuldigte, einer Sekte anzugehören, die der nationalen Religion widersprach.[1] Es ging darum «sich von der wirklichen
Kirche des Landes zu trennen, und sich unabhängig von derselben und den Verordnungen, die sie regieren, zu konstituieren.» Im Januar 1924 erliess der Staatsrat ein Dekret, welches unter Androhung
einer Geld- oder Gefängnisstrafe jede ausserkirchliche Versammlung verbot. Fivaz, der eine solche Versammlung leitet wurde daraufhin misshandelt und für zwei Jahre aus dem Kanton verbannt. Man
fand ihn 1845 als ausserordentlichen Professor für Botanik an der Akademie von Lausanne wieder.[116]
Der zweite war Pfarrer Mellet, der damals in Vallorbe lebte und ein Freund von Pfarrer Agassiz war. Er beschäftigte sich ebenfalls mit Botanik, war aber vor allem ein ausgezeichneter Entomologe.
Agassiz und Mellet gingen täglich auf Insektensuche und sammelten vor allem Käfer und Schmetterlinge. Die wissenschaftliche Zusammenarbeit der beiden Freunde wurde auch nicht durch die Abreise
Mellets am Ende der Ferien unterbrochen. Sie führten einen regen Briefwechsel, in dem es fast ausschliesslich um wissenschaftliche Fragen ging. Pfarrer Agassiz teilte seinem Freund und Kollegen
in Vallorbe oft seine Sorge um die Zukunft seines Sohnes Louis mit: «Man kann ihn auf nichts festlegen», sagte er ihm, «er träumt nur von Naturgeschichte und hässlichen, ekelhaften Tieren.»
Pfarrer Mellet verteidigte daraufhin seinen jungen Freund und versuchte, seinen Vater zu überzeugen, dass es Louis Agassiz dank der von Cuvier gegebenen Entwicklung des Studiums der
Naturwissenschaften möglich sein würde, sich eine Stelle als Lehrer zu erlangen. Die Zeit, die Agassiz zwischen den Ausflügen mit seinen Freunden zur Verfügung stand, verbrachte er damit, alle
möglichen Tiere zu sezieren. Von Zeit zu Zeit fuhr er an den Neuenburgersee, um seine Fischbeobachtungen fortzusetzen. So verging die Zeit in den Ferien. Einer dieser Aufenthalte muss allerdings
weniger angenehm gewesen sein, nämlich der von 1827. Im Frühjahr dieses Jahres erkrankte Agassiz in Heidelberg an Typhus und wurde in Karlsruhe bei seinem Freund Braun behandelt, dessen Schwester
er sechs Jahre später heiratete. Auf Anraten der Ärzte verbrachte er den Sommer in Orbe. Im Protokoll der dortigen Gemeinderatssitzung vom 17. August 1827 ist zu lesen: «In einem Brief
teilt der Friedensrichter mit, dass der Sohn von Pfarrer Agassiz an den Pocken erkrankt ist und ordnet die Beschlagnahmung des Kranken und derjenigen, die ihn pflegen sollen, sowie eine
Veröffentlichung in der Stadt an, die das Verbot enthält, mit ihnen zu kommunizieren.» Die Beschlagnahmung dauerte nicht lange, denn im November konnte Louis Agassiz an der Universität München
weiterstudieren.[1]
Studieren im Pfarrhaus von Concise
Mittlerweilen war sein Vater von Orbe nach Concise am Neuenburgersee versetzt worden. Am 30. Dezember 1830 traf Louis Agassiz bei seinen Eltern ein. In ihrem Pfarrhaus verbrachte er ein Jahr mit ichthyologischen Studien, insbesondere mit der Fortsetzung seiner Arbeit über fossile Fische.
Aufenthalt in Paris von 1831-1832
In Paris zog ihn vor allem das «Muséum d'histoire naturelle» an, dessen zoologische, paläontologische und anatomische Sammlungen zu den reichsten und berühmtesten
Europas gehörten, sowie der botanische Garten «Jardin des Plantes», der nicht nur die damals bedeutendste Sammlung lebender Fische beherbergte, sondern auch die berühmte Sammlung fossiler Fische
vom Monte Bolea des Grafen Gazzola. Agassiz wohnte ganz in der Nähe in einem kleinen Zimmer des «Hôtel du Jardin des Plantes». Er trat in Kontakt mit dem berühmten Naturforscher Georges Cuvier
(1769-1832) und Alexander von Humboldt (1769-1859), Gesandter des auswärtigen Hofs und europäische Berühmtheit.
Cuvier hielt damals eine Reihe von Vorlesungen über die Geschichte der Naturwissenschaften und bekämpfte die auf der Veränderlichkeit der Arten beruhende Evolutionstheorie Geoffroys, die dieser
in den Sitzungen der Pariser Akademie verteidigte. Agassiz folgte von diesem Zeitpunkte an Cuvier's Ideen über die Klassifikation des Tierreichs und über die Schöpfungskatastrophen insbesondere
mit wenigen Abänderungen, und rechtfertigte sie in Lehre und Schrift bis zu seinem Lebensende.
Von Cuvier erhielt er die Erlaubnis, regelmässig in dessen Laboratorium zu arbeiten. Nach einiger Zeit übergab ihm Cuvier alle Notizen und Zeichnungen, die er über fossile Fische gesammelt hatte
und bat Agassiz, das Werk zu vollenden.[8]
Louis Agassiz: «Cuvier stellte mir alle Objekte zur Verfügung, die ich zu untersuchen wünschte. Er erlaubte mir alle existierenden Fischskelette und alle in den Galerien aufbewahrten Fossilien zu
beschreiben, zu vergleichen und zu zeichnen. Er überliess mir auch alles Material, das er selbst für sein Werk gesammelt hatte, und sogar alle Zeichnungen, die er im Britischen Museum und
anderswo hatte anfertigen lassen.»[101]
Das ihm anvertraute Material erwies sich für Agassiz als Vermächtnis, denn wenige Tage später starb Cuvier am 13. Mai 1832 an einem Anfall von Cholera. Finanzielle Probleme erschwerten es Agassiz
der Bitte Cuviers nachzukommen, bis ihm Alexander von Humboldt zu Hilfe kam. In Humboldt hatte Agassiz einen mächtigen Gönner, dessen Unterstützung ihm später die Veröffentlichung seiner
kostspieligen Publikationen wesentlich erleichterte. Agassiz konnte in Paris weiterarbeiten, wo er mit seinem Freund Braun gemeinsam die Forschungen betrieb. In einem Brief vom März 1832 schlug
seine Mutter Louis Agassiz vor, seine reiche Sammlung, die er in Paris nicht unterbringen konnte, dem zukünftigen Naturhistorischen Museum in Neuchâtel zur Verfügung zu stellen. Zu diesem Zweck
solle er sich mit Louis Coulon junior (1804-1894) in Verbindung setzen.[8]
Agassiz gefiel die Idee sich in Neuchâtel niederzulassen, da er so wieder näher bei seiner Familie sein konnte, die in Concise wohnte. Aus der Briefkorrespondenzen
geht hervor, dass es Louis Coulon junior zu verdanken war, dass Agassiz sich bald 14 Jahre in Neuchâtel niederlassen wird. Coulon wurde dabei von seinem Vater unterstützt, einem langjährigen
Kaufmann und Freund der Wissenschaft, welcher der Stadt Neuchâtel bedeutende Sammlungen geschenkt hatte. In einem Brief vom 27. 3. 1832 schrieb Agassiz aus Paris an Coulon jun.:
«Ich habe Ihnen gegenüber mehrmals den Wunsch geäussert, mich in Ihrer Nähe niederzulassen, und beabsichtigte, mich um den Lehrstuhl für Naturgeschichte zu bemühen, den Sie an Ihrem Lyzeum
einrichten wollen. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir einige Informationen darüber geben könnten. Auf meinen verschiedenen Reisen, habe ich eine hübsche naturhistorische Sammlung
zusammengetragen, welche die Lücken in den Sammlungen der Stadt Neuchâtel füllen und sie für einen vollständigen Kurs der Naturgeschichte mehr als ausreichend machen kann. Ich habe daran gedacht,
dass Sie in ihren Plan, den Sie für das Lyzeum zu verabschieden gedenken, die Vergrösserung Ihrer zoologischen Sammlungen einbeziehen könnten. Wenn dies der Fall ist, wage ich zu glauben, dass
meine Sammlungen den Zweck, den Sie zu erreichen wünschen, reichlich erfüllen würden. Sollte dies der Fall sein, so biete ich sie Ihnen an. Ich habe auch mit Humboldt über dieses Projekt
gesprochen, der sehr an der Sache interessiert ist und im Fall dieser Übertragung alle notwendigen Vorkehrungen mit der Regierung treffen wird. Sie werden mir einen Dienst erweisen, wenn Sie mir
mitteilen:
1. von wem die Ernennung auf den Lehrstuhl für Naturgeschichte abhängt
2. von wem der Ankauf meiner Sammlung abhängt
3. was ich Ihrer Meinung nach tun muss, um diese beiden Ziele zu erreichen. Sie können sich vorstellen, dass ich meine Sammlungen nicht aufgeben möchte, solange ich nicht die Aussicht habe, sie
frei konsultieren zu können.»[101]
Agassiz schrieb Coulon in einem weiteren Brief vom 20. 6. 1832: «Was mich für meine wissenschaftlichen Forschungen den Aufenthalt in Neuchâtel jeder anderen Position vorziehen lässt, ist, dass
ich bei Ihnen viel friedlicher leben kann und dass es mir leichter fallen wird, auf dem Land die Studien fortzusetzen, die ich von nun an vor allem zu betreiben gedenke. Im Übrigen ist der
Verzicht auf die Sammlungen nicht sehr empfindlich, wenn man sie von Zeit zu Zeit besuchen kann, und er wird durch die unmittelbare Betrachtung der Natur ausgeglichen».
Coulon ermutigte Agassiz, indem er ihm sagte, dass die Schaffung eines Lehrstuhls für Naturgeschichte nicht unmöglich sei, und fragte ihn, ob er sich mit 80 Louis pro Jahr für 10 Stunden
Unterricht pro Woche zufriedengeben würde.[102]
In einem nie veröffentlichen Brief vom 25. 7. 1832 schrieb König Friedrich Wilhelm an Louis Coulon jun.: «Wie glücklich wäre es für Agassiz und für die Vollendung seiner beiden Werke, wenn er
sich noch in diesem Jahr an den Grenzen Ihres Sees niederlassen könnte. Ich zweifle nicht an dem Schutz, den ihm Ihr würdiger Gouverneur gewähren würde, dem ich diesen Vorschlag wiederholen
werde.»[101]
Coulon vergass jedoch vor lauter Zukunftsideen die Zustimmung der Bürgerschaft. Diese war gegenteiliger Meinung und nicht an der Schaffung eines neuen Schulsystems interessiert. Sie fürchtete,
die Finanzen der Stadt zu gefährden, denn ein Defizit von Fr. 4000.-, verursacht durch den Bau eines neuen Schulgebäudes und die politischen Ereignisse, hatte sie vorsichtig werden lassen. Es
bedurfte der Intervention Coulons, um die Schwierigkeiten bei der Gründung der neuen Lehranstalt für Naturgeschichte zu überwinden. Er tat, was die Bürgerschaft nicht zu tun wagte. Er eröffnete
in Neuchâtel eine Subskription, die er nach und nach sammelte. Bald konnte er Agassiz das bescheidene Jahresgehalt von 80 Louis (2000 Franken) anbieten, das für drei Jahre gesichert
war.[102]
Wenig später erhielt er von Coulon die Nachricht, dass er eine Lehrerstelle an der vom preussischen König Friedrich Wilhelm III. gegründeten Akademie in Neuchâtel
erhalten könne. Coulon schrieb ihm: «Sie können nicht daran zweifeln, wie sehr uns die Aussicht, Sie in Neuchâtel zu haben, freut. Nicht nur wegen der Freundschaft, die viele Menschen hier für
Sie empfinden, sondern wegen des Glanzes, den ein von Ihnen besetzter Lehrstuhl für Naturgeschichte für unsere Institution haben wird.» [63] Bald darauf wurde Agassiz‘ Sammlung für 500 Louis
erworben, wovon die Stadt ein Drittel, der Fürst ein zweites Drittel und Louis de Pourtalés den Rest bezahlten. Mit diesem Betrag konnte Agassiz mit der Veröffentlichung seiner Geschichte der
fossilen Fische beginnen. Louis Agassiz: «In Neuchâtel ist man bereit, mich als eine Art Phänomen zu betrachten, und ich muss alle Anstrengungen unternehmen, damit die Wirklichkeit meinen Ruf
nicht Lügen straft.»[63]
Der Beginn vom höheren Bildungswesen der Stadt Neuchâtel
Über 100 Jahre umfasste der Lehrplan des damaligen Kollegiums aus Religion, Lesen, Schreiben, Rechtschreibung, Latein, Griechisch, Arithmetik und Kalligrafie. Die
Lehrer hatten freie Wohnung in einem der alten Chorherrenhäuser und nutzten das grösste Zimmer für den Unterricht. Allmählich nahm der Gedanke Gestalt an, in Neuchâtel den Unterricht
interessanter zu gestalten in Dingen infiniment plus utiles, plus précieux et plus nécessaires. Als sich Preussen 1707 Neuchâtel anschloss, versprach Friedrich I. die Stadt mit einer Akademie
auszustatten, was aber nicht umgesetzt wurde.
Die Entstehung der Universität Neuchâtel basierte auf die Einrichtung akademischer Kurse in Hörsälen, den sogenannten Auditorien. Sie gehörten zum Kollegium und waren an verschiedenen Standorten
der Stadt untergebracht. Die Stadt machte die höhere Bildung attraktiver, indem sie berühmte Geologen auf die Lehrstühle setzte. Ab 1732 besetzte Louis Bourguet (1678-1742), der der Aufhebung des
Edikts von Nantes entkommen war, den ersten Lehrstuhl für höhere Bildung. Er unterrichtete im Waisenhaus Naturphilosophie und Mathematik. Seine Antrittsrede kündigte an, dass dieser Lehrstuhl den
Anfang einer Akademie sein sollte. Der Pädagoge Jean-Elie Bertrand (1737-1778), Lehrer vom Kollegium und von 1757 bis 1759 dessen Rektor, beklage 1766 im Journal Helvétique den Mangel an
intellektuellen Ressourcen: «Wir Neuenburger haben keine Akademie». Bertrand wurde später zum Minister des Heiligen Evangeliums ernannt. Eine weitere Entwicklung der damaligen preussischen
Schulen, war dem Nachlass von Baron David de Pury zu verdanken. Er starb 1786 in Lissabon und vermachte beinahe sein gesamtes Erbe der Stadt Neuchâtel.
Am 26. Juli 1787 erstellten der Stadtrat und die Pfarrer einen Plan für das öffentliche Schulwesen. Von nun an gab es zwei getrennte Collèges, ein französisches und ein lateinisches.[114] In Etappen entstanden Lehrstühle für Literatur und Geschichte, Recht, Philosophie, Mathematik, Physik und Chemie.[103]
Zuhörer waren viele begeisterte Studenten. Durch den Besuch der Auditorien konnten sie den Vorlesungen an ausländischen Universitäten besser folgen.
Weitere Lehrer der Auditorien waren u. a. der Arzt und Naturforscher Abraham Gagnebin, der mit Rousseau befreundet war und in seinem eigenen Haus ein naturhistorisches Museum für Besucher
einrichtete. Henri de Meuron (1752-1813) unterrichtete Schöne Wissenschaft und Philosophie und wurde 1790 zum ersten Bibliothekar der Stadt ernannt. Mit dem Aufschwung des Handels, der
Indienneherstellung, Uhrmacherei und des Finanzwesens verlor die Jugend zwischenzeitlich das Interesse für Literatur, Philosophie und Wissenschaft. Ab 1805 versuchte Professor Henri Willemin, die
höhere Bildung zu fördern, trat aber sechs Jahre später zurück, da er nur zwei Studenten hatte. Ab 1813 wirkte Abram-François Pettavel (1791-1870), erster Doktor der neuen Universität Berlin, auf
dem Lehrstuhl für Schöne Wissenschaften. Er lehrte griechische und lateinische Literatur und war von 1840-1842 Rektor der 1. Akademie. Das Kollegium verfügte bis 1835 über neun Professuren und
das Pfarrkollegium über zwei.
Allerdings liessen alle schulischen Einrichtungen zu wünschen übrig und verteilten sich auf das Kollegium in der Nähe der Stiftskirche und auf die niederen Schulen der Stadt: In den Hörsälen im
Gebäude der Schatzkammer, im Hôtel-de-Ville (Rathaus), über den Metzgereien; in von der Verwaltung gemieteten Räumen in der Nähe des Hafenbeckens (Place du Gymnase); in den Häusern Bachelin und
Courvoisier, im ersten Stock einer Waschküche (zwischen dem Schweineschlachthof und dem Misthaufen der Stadt) und im Gebäude Les Bercles (Rue de la Raffinerie), das 1864 abgerissen
wurde.[114]
1816 schlug der Stadtsekretär George-Frédéric Gallot dem Rat vor, die verstreuten Schulen in einem Gebäude zusammenzufassen. Die Umsetzung dieser Idee dauerte 12 Jahre. In der Zwischenzeit lernte
man auf dem Kollegium Sprachen, Geographie, Geschichte, Zeichnen und Kirchengesang. Die Realisierung eines neuen Schulgebäude erschien dringend notwending, um der 1789 gegründeten Stadtbibliothek
mit ihren 10.600 Bänden, der theologischen Bibliothek und dem 1795 gegründeten Naturhistorischen Kabinett angemessene Räumlichkeiten zu bieten.
1826 begann das Vorhaben zum Bau des Gymnasiums oder Collège Latin, der sich einige Jahre hinziehen sollte. Am 21. Mai 1828 konnte unter der Herrschaft von Friedrich Wilhelm III., König von
Preussen, der Grundstein für das Gebäude gelegt werden. In den Räumen brachten die Behörden die Lateinklassen, die Auditorien, die Bibliothek und das naturhistorischen Kabinett unter. Der
Solothurner Architekt Anton Fröhlicher schuf einen imposanten Bildungspalast. 1829 war das Erdgeschoss mehr oder weniger fertiggestellt. 1830 erfolgte die Gründung eines 7-klassigen Gymnasiums
mit Auditorien für schöne Literatur (Belles Lettres) und für Philosophie. Durch von der Stadtverwaltung unterhaltenen Hörsäle sollte Neuchâtel auch für Louis Agassiz attraktiv machen. Sie wurden
ab 1835 im neu errichteten Gymnasium, dem «Collège latin», untergebracht. Deren Studenten traten der Zofinger Gesellschaft bei oder gründeten 1832 die Société de Belles-Lettres.
Professor der Naturgeschichte von 1832 bis 1846
1832 fand Agassiz unter dem Schutz einer Gruppe wohlgesonnener Bürger durch die Auditorien vom Kollegium, auch «Lyceum» genannt, eine Stelle als freier Lehrer für
Naturwissenschaften und einen Ort, an dem er ungestört an seinem Werk über die Beschreibung fossiler Fische arbeiten konnte.[2] Agassiz musste für seine Schüler das Lehrmaterial selbst
organisieren. Den Mangel an Lehrmaterial glich er aus, indem er mit seinen Schülern Exkursionen unternahm. Agassiz zeigte ihnen im Jura die Bodenformen und an Seen, Flüssen und Bächen die
Bedeutung des Wassers als geographisches Element. Die Exkursionen veröffentlichte er in dem Büchlein «Tableau synoptique des principales familles naturelles des plantes» (1833).[102] Neben seiner Lehrtätigkeit und um die Öffentlichkeit an seiner Arbeit teilhaben zu lassen, hielt Agassiz öffentliche Vorlesungen und Vorträge (auch bei sich zu
Hause), deren Erlös für den Ausbau des Naturhistorischen Museums verwendet wurde. Agassiz gab Kurse in Mineralogie im Auditorium für Schöne Literatur und Kurse in Geologie im Auditorium für
Philosophie.[102]
Am 12. November 1832 hielt Louis Agassiz im Hôtel-de-Ville von Neuchâtel, in Angesehenheit der Erziehungskommission und vielen Zuhörer, seine Eröffnungsvorlesung
über «die Beziehungen zwischen den verschiedenen Zweigen der Naturgeschichte und über die aktuellen Tendenzen in allen Wissenschaften». Der Erfolg war überwältigend. Unter den Zuhörern war auch
sein Vater. Die Fragen, welche den Naturforscher beschäftigten, drangen bis in die Salons vor.[63]
Louis Agassiz beschäftigte ständig zwei Künstler, J. C. Weber und Joseph Dinkel (1806-1891), und einen Maler, Jacques Burkhardt (1808-1867), der sein Studienkollege in München gewesen war und sein lebenslanger Begleiter blieb. Stahl, der als bester Modelleur des Pariser Jardin des Plants bekannt wurde, war ebenfalls in Neuchâtel tätig. Der aus Paris herbeigerufene Hercule Nicolet (1801-1872) wurde überredet, in Neuchâtel eine grosse lithographische Anstalt einzurichten, in der die letzten Tafeln der «Poissons fossiles», der «Poissons d'Eau douce», der «Embryologie des Coregonus», der Arbeiten über die Gletscher und der Stachelhäuter veröffentlicht wurden.
«Die Gründung der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft von Neuchâtel,
war der Idee und Initiative von Louis Agassiz zu verdanken.»
Louis Favre, Bulletin de la Société des Sciences Naturelles de Neuchâtel, Band 13, 1883
Gründung der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft von Neuchâtel
In der Schweiz wurde die erste naturwissenschaftliche Gesellschaft 1746 in Zürich gegründet. Es folgten 1768 die Berner Gesellschaft und 1790 die Genfer Gesellschaft für Physik und
Naturgeschichte. 1815 initiierten Henri-Albert Gosse, Apotheker in Genf, und Samuel de Wyttenbach, Pfarrer und Professor in Bern, ein Treffen von Schweizer Naturforschern in Genf, bei dem die
«Société helvétique des sciences naturelles» gegründet wurde. 1817 eröffnete Basel eine naturwissenschaftliche Gesellschaft, 1819 St. Gallen, 1822 Schaffhausen, 1823 Solothurn und 1832
Freiburg.[103]
Am 6. Dezember 1832 gründete Agassiz in Neuchâtel eine Naturforschenden Gesellschaft (Société des Sciences Naturelles de Neuchâtel), mit dem Zweck, dem Studium der Wissenschaften ein aktiveres
Leben zu verleihen. Zu den Mitbegründern gehörten der Physik- und Chemielehrer Henri Ladame, der Mathematiklehrer Henri de Joannis, Forstverwalter und Naturwissenschaftler Louis Coulon, Geologe
Auguste de Montmollin und der Arzt Jacques-Louis Borel.[119] In der ersten Sitzung wurden Paul-Louis-Auguste Coulon sen. (1777-1855) zum Präsidenten und
Louis Agassiz zum Sekretär der Sektion für Naturgeschichte ernannt. Eine weitere Sektion umfasste mathematische Wissenschaften, Physik, Chemie usw. Die Sitzungen fanden bis Januar 1837 alle 14
Tage im Haus des Präsidenten (Coulon sen., später jun.) statt, danach im neuen Gymnasium.[63] Die Gesellschaft bestand aus in Neuchâtel wohnhaften und aus
korrespondierenden Mitgliedern. Artikel 12 lautet: «Es dürfen keine Diskussionen über Themen geführt werden, die nichts mit der Arbeit der Gesellschaft zu tun haben.» Dies war eine gute
Vorsichtsmassnahme in einer Zeit, in der die politischen Probleme durch die republikanischen Aufstände ihren Höhepunkt erreichten. Der Artikel wurde stets gewissenhaft befolgt.[103] Der erste Band der «Memoires» der Gesellschaft erschien, von Agassiz betreut, 1835. Der schöne Quartband enthielt 14 Abhandlungen, darunter drei von
Agassiz.[119]
Ende 1832 erhielt Agassiz einen Ruf von der Universität Heidelberg, wo er einen Teil seines Studiums absolviert hatte. Er lehnte ab. Neuchâtel bot ihm unerwartete
Möglichkeiten: «Zu meinem grossen Erstaunen fand ich hier alles, was für die Veröffentlichung eines Werkes über fossile Fische notwendig ist, zwei gute Lithographen und zwei Drucker. Unsere
Magistrate und auch Privatpersonen interessieren sich sehr für die öffentliche Bildung und ich bin überzeugt, dass meine Sammlung früher oder später gekauft wird». Tatsächlich war das Geschäft
einige Monate später abgeschlossen. Der preussische König stellte einen Teil der benötigten Summe bereit.[63]
Ab Januar 1833 hält Agassiz einen Kurs in allgemeiner Naturgeschichte, in dem er die wichtigsten Züge der Entwicklung, der Organisation, der Klassifikation und der Geschichte der Tiere und
Pflanzen darlegte und den er mit einer Skizze der Revolutionen abschloss, die nacheinander die Oberfläche der Erde und ihre Bewohner verändert haben. Dieser Kurs umfasste 25 bis 30 Lektionen und
fand zweimal wöchentlich statt. Der Preis betrug einen Louis.
Hochzeit mit Cecilie Braun
1833 heiratete er Cecilie Braun aus Karlsruhe, die Schwester seines langjährigen Freundes Alexander Braun, Direktor des Botanischen Gartens in Berlin. Sie schenkte ihm 1835 den Sohn Alexander und
später die Töchter Ida und Pauline. Als Künstlerin fertigte Cecilie für Agassiz mehrere Zeichnungen von Fossilen und Süsswasserfischen an.[8]
Auf Entdeckungsreise
1834 reiste Agassiz nach England, wo er in Museen und Privatsammlungen 300 neue fossile Fischarten entdeckte. Dann bereiste er Wales, Schottland und Irland.

Mary Anning
Mary Anning (1799-1847) war eine englische Fossiliensammlerin, -händlerin und Paläontologin, die durch ihre Entdeckungen von Meeresfossilien aus dem Jura an den Klippen entlang des Ärmelkanals
bei Lyme Regis in der Grafschaft Dorset im Südwesten Englands weltberühmt wurde. Annings Entdeckungen trugen dazu bei, das wissenschaftliche Denken über prähistorisches Leben und die Geschichte
der Erde zu verändern. 1834 besuchte Louis Agassiz Lyme Regis und arbeitete mit Anning zusammen, um die in der Region gefundenen Fischfossilien zu sammeln und zu untersuchen. Er war von Anning
und ihrer Freundin Elizabeth Philpot so beeindruckt, dass er in sein Tagebuch schrieb: «Miss Philpot und Mary Anning waren in der Lage, mir mit absoluter Sicherheit zu zeigen, welche der
Ichthyodorulit-Rückenflossen von Haien den verschiedenen Arten entsprechen.» Er dankte beiden für ihre Hilfe in seinem Buch «Studies of Fossil Fish». Agassiz war auch die einzige Person, die zu
Annings Lebzeiten zwei fossile Fischarten nach ihr benannte, «Anning - Acrodus anningiae» und «Belenostomus anningiae» und eine weitere Art nach Elizabeth Philpot.[14]
Agassiz wird ordentlicher Professor
1835 fand in Neuchâtel die Einweihung des Gebäudes des Collège latin (Gymnasium) und endgültige Einrichtung des Museums statt.[17] Bei dieser Zeremonie befand sich Agassiz vorübergehend in London. Erst in diesem Jahr beschloss der Bürgerrat die Schaffung eines Lehrstuhls für Naturgeschichte, und Agassiz wurde von einem freien Lehrer zu einem ordentlichen Professor. Die Stadt Neuchâtel und nicht mehr die private Initiative bot dem jungen Gelehrten die stabile Position, die er brauchte, um sich seinen bevorzugten Studien zu widmen.[102]
Die Nordfassade vom Collège Latin, das zuerst Gymnasium Latin genannt wurde. Anton Fröhlicher erbaute es von 1827 bis 1835. Das Gebäude beherbergte die Auditorien und im oberen Stock das Naturhistorische Museum und immer noch die Bibliothek (BPU). Ab 1840 war es als 1. Akademie von Neuchâtel bekannt. Foto: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv, Public Domain

Mitbegründer vom Naturhistorischen Museum Neuchâtel
1795 legte General Charles-Daniel de Meuron den Grundstein, als er der Stadt sein «naturhistorisches Kabinett» überliess. 1815 planten der Kaufmann Paul Louis Auguste Coulon Senior (1777-1855)
und der Botaniker Baron Albert de Büren (1791-1815), im Hôtel Du Peyrou ein richtiges Museum einzurichten. Coulon Senior brachte 1817 von seinen Exkursionen mit dem Botaniker de Büren, Muscheln,
Krustentiere und Fische aus der Umgebung von Nizza mit. Aus politischen Gründen scheiterte das Projekt, für das sie bereits 25000 Livrēs gesammelt hatten.[91] Um 1832 den neu eingeführten
Naturkundeunterricht zu veranschaulichen, wurde in einem Raum im Erdgeschoss vom Waisenhauses (später Rathaus), ein kleines provisorisches Museum eingerichtet.[103] Dort konnte die umfangreichen Sammlungen, die Louis Agassiz aus Frankreich und Deutschland mitgebracht hatte, so gut es ging untergebracht werden.
Als der Saal im Erdgeschoss des Waisenhauses überfüllt war, stapelte Coulon seine Neuerwerbungen in seinem Haus im Faubourg. Weitere Standorte der naturhistorischen Objekte waren die Bibliothek
und das Schloss. Es gab weder eine Einheit noch eine methodische Klassifizierung. 1835, als die Einrichtung des Lateinischen Gymnasiums abgeschlossen war, transportierte Louis Coulon all diese
Schätze in die neuen Räumlichkeiten und kümmerte sich selbst um die Aufstellung in den Vitrinen und die Anfertigung der Etiketten. An diesem Ort befindet sich heute die öffentliche Bibliothek.
1836 kaufte Coulon dank einer Spende des Königs, die Agassiz-Sammlung für das Museum. Agassiz erklärte, dass alle seine zukünftigen Lieferungen die er bekäme an das Museum gehen würden. 1837
konnte nun im westlichen Teil des Obergeschosses vom Collège Latin ein permanentes naturhistorisches Museum eingerichtet werden. Es wurde von Louis de Coulon (1804-1894) als eigentlichem Schöpfer
eröffnet, der die Sammlung seines Vaters und die von Agassiz unterbringen konnte. Im Gymnasium befanden sich damals das naturhistorische, ethnographische und archäologische Museum, die
Stadtbibliothek mit etwa 60‘000 Bänden und die Bibliothek der Predigergesellschaft.[91]
Naturforscher Paul Godet (1836-1911), zweiter Direktor des Naturhistorischen Museums Neuchâtel: «Als Agassiz nach Neuchâtel kam, war unser Naturhistorisches Museum sehr arm. Einige ausgestopfte
Tiere, Muscheln und andere Dinge standen in unseren Vitrinen. Dass die Sammlung so umfangreich geworden ist, verdanken wir in erster Linie den Gründern Louis Agassiz und Louis de Coulon
(1804-1894), dem ersten Direktor des Museums. Agassiz erkannte, wie sehr naturhistorische Sammlungen den Unterricht unterstützen können und wie wichtig sie für die wissenschaftliche Arbeit sind.
Agassiz selbst hatte viele Sammlungen als Grundlage für seine Arbeit zusammengetragen. Es handelte sich um Fossilien, Mollusken, Fische und Stachelhäuter (Seesterne, Seeigel). 1838 trat eine kurz
zuvor ernannte Verwaltungskommission beim Vorsitzenden Louis de Coulon zusammen. Sie teilten die Arbeit untereinander auf, dabei kümmerte sich Agassiz besonders um die Fossilien und
Mollusken. Louis Agassiz verdanken wir den Impuls, der dem Studium der Naturgeschichte in unserem Land gegeben wurde. Während seines Aufenthalts in Neuchâtel wurden seine Vorlesungen von
einem grossen Publikum besucht, in dem es nicht an Damen mangelte. Agassiz, der sich leidenschaftlich für die Wissenschaft einsetzte, verstand es, sie attraktiv zu machen, ohne dabei ihre
Ernsthaftigkeit zu opfern. Als Louis Agassiz nach Amerika ging, dachte er daran, sich von diesen Sammlungen zu trennen, aber da er sie in Neuchâtel behalten wollte, stimmte er zu, sie unserem
Museum für einen Preis zu überlassen, der weit unter ihrem Wert lag, nämlich Fr. 6000.- Eine sehr grosse Anzahl von Etiketten des Museums trägt die Aufschrift ‹Collection Agassiz›. Am
Eingang vom Naturhistorischen Museum Neuchâtel wurde von der Kommission für Louis Agassiz eine Gedenktafel angebracht.»[75] Die Inschrift
lautet:
A LOUIS AGASSIZ
L’un des fondateurs du musée
D’histoire naturelle.
Digitale Fischsammlung
Die fossilen Fische der «Agassiz-Sammlung» vom Naturhistorischen Museums Neuchâtel
umfasst 820 Referenzen und 2‘500 Stücke. Sie diente als Grundlage für die Beschreibung zahlreicher neuer fossiler Fischarten. Seine Sammlung ist digitalisiert auf Wikipedia Commons (CC BY-SA 4.0)
frei zugänglich.[97]
Caturus heterurus (Agassiz 1839)
Caturus furcatus (Agassiz 1833)
Caturus angustus (Agassiz 1844)
Die Stadt erweiterte ihre wissenschaftlichen Interessen 1837 mit dem Zusammenschluss der Helvetischen Naturforschenden Gesellschaft.[17]
Im «Collège Latin» fand 1841 die Einweihung der «ersten Akademie» statt, die bis 1848 bestand. Auf Initiative des 1859 in Neuchâtel eingebürgerten Geologen Edouard Desor, ehemaliger Assistent von Agassiz und Mitglied des Grossen Rates, wurde am 24. März 1866 ein erstes kantonales Hochschulgesetz verabschiedet. Desor unterrichtete seit 1852 an den Auditorien. Das Gesetz führte 1866 zur Eröffnung der «zweiten Akademie». 1886 zog diese in einen Neubau, heute Universität (siehe Fotos). Am 12. Mai 1887 erfolgte die Einweihung der Louis Agassiz-Büste durch die Société de Belles-Lettres, ein Werk des Bildhauers Iguel. Im grossen Saal wurde ein Ganzkörperporträt von Agassiz ausgestellt. Im Mai 1909 wandelte man die Akademie in eine Universität um. Im Gebäude befinden sich Erinnerungsstücke, verbunden mit der Gründung der Akademie.

Lehrer und Direktor an der ersten Akademie
Auf Drängen Alexander von Humboldts unterzeichnete Friedrich Wilhelm III. am 17. März 1838 eine Kabinettsorder, in der er in Neuchâtel die Gründung einer Akademie beschloss. Zu diesem Zweck erfolgte eine königliche Spende. Die erste Akademie bestand von 1841 bis 1848. Darin integriert waren einen Teil der Hörsäle (Auditoires) und drei Fakultäten: die Philosophische Fakultät, welche Philosophie, Geschichte, alte und moderne Literatur umfasste, die Juristische Fakultät und die Naturwissenschaftliche Fakultät. Den Unterricht gaben hochrangige Gelehrte.
Ein Professor mit vielen Auszeichnungen
Zum Zeitpunkt der Einweihung der Akademie von Neuchâtel am 18. November 1841, war Louis Agassiz: Doktor der Philosophie, Medizin und Chirurgie, Doktor der Rechtswissenschaften der Universitäten
Edinburgh und Dublin; Mitglied der Königlichen Gesellschaften von London und Edinburgh, der Königlichen Akademien der Wissenschaften von Berlin, Stockholm, Turin und Paris, der Luchsakademie von
Rom, der Kaiserlichen Akademie der Naturforscher, der Kaiserlichen Gesellschaft der Naturforscher von Moskau, der Königlichen Akademie der Naturforscher von London und Edinburgh, der Königlichen
Zoologischen Gesellschaft von Irland, der Philomatischen Gesellschaft von Paris, der Akademien von Philadelphia und Val-d'Arno, des Lyzeums von New-York, des Instituts von Bristol, der
Philosophischen und Literarischen Gesellschaft von Leeds, der Geologischen Gesellschaft von Frankreich, der von London, der British Association for the Advancement of Science, der Helvetischen
und der Deutschsprachigen Gesellschaft für Naturwissenschaften und Medizin, der Nordischen Antiquitätengesellschaft in Kopenhagen, der Gesellschaft für Physik, Chemie, Landwirtschaft und
Industrie in Frankreich, der georgophilen Gesellschaft von Florenz, der naturhistorischen Gesellschaften von Berlin, Frankfurt, Prag, Heidelberg, Strassburg, Schlesien, Halle, Freiburg,
Saint-Louis (USA), Hamburg, Northumberland, Durham, New-Castle, Zürich, Basel, etc. Ritter des preussischen Roten Adlerordens, Ehrenprofessor an der Akademie von Lausanne und Professor für
Naturgeschichte an der Akademie von Neuchâtel.[115]
Eröffnungsvortrag
Louis Agassiz war Lehrer und von 1842 bis 1843 Rektor der Akademie. Auch Arnold Guyot, der Agassiz 1825 in Deutschland kennengelernt hatte, lehrte hier. Im ersten
Jahr hielt Agassiz zwei Vorlesungen über vergleichende Anatomie und über Naturphilosophie.
Louis Agassiz sprach an der Einweihung der ersten Akademie über «Die Abfolge und Entwicklung der organisierten Wesen auf der Erdoberfläche in den verschiedenen Zeitaltern der Natur» in der er
auch Thesen von Cuvier erwähnt. Er erzählte: «Auf welche Einflüsse man in der Welt auch immer zurückgreifen mag, niemals wird man sich die spontane Entstehung von Lebewesen allein durch die
Wirkung oder das Zusammenwirken physikalischer Kräfte vorstellen können. Hier ist es wichtig, von vornherein einen Unterschied zu machen zwischen der Herstellung der Ordnung der Dinge, die die
gesamte Natur von Anfang an beherrscht hat und die durch alle Zeiten hindurch erhalten geblieben ist, und den besonderen Akten des schöpferischen Willens, die sich nur auf die Herstellung
bestimmter Teiltatsachen beziehen, die in den allgemeinen Plan passen und gewissermassen nur die Folge davon sind. Die Zeit ist gekommen, in der auch die Wissenschaft in der Natur einen Gott als
Schöpfer und Urheber aller Dinge erkennen kann. Die Geschichte der Erde verkündet ihren Schöpfer. Sie sagt uns, dass das Ziel und das Ende der Schöpfung der Mensch ist. Er wird in der Natur seit
dem ersten Auftreten der organisierten Wesen angekündigt, und jede wichtige Veränderung in ihrer Gesamtheit ist ein Schritt in Richtung des endgültigen Endes der Entwicklung des organischen
Lebens. In unserem Zeitalter ist daher nur noch eine vollständige Manifestation der intellektuellen Entwicklung zu erwarten, die die menschliche Natur mit sich bringt. Möge die Einrichtung, zu
deren Einweihung wir uns heute versammeln, eines Tages zu denjenigen gehören, die zu diesem grossen Ziel beigetragen haben.» [115]
Ehrenbürger von Neuchâtel
Genf versuchte Agassiz anzuwerben und bot ihm ein Gehalt von etwa 4000 Fr. an. Einige Monate später kam ein Angebot von Lausanne. Doch er blieb seiner Stelle treu, und die Neuenburger wussten ihm ihre Dankbarkeit auszudrücken. Louis Coulon schrieb ihm in ihrem Namen einen Brief, in dem er ihm mitteilte, dass die Stadtverwaltung ihm als Zeichen ihrer Wertschätzung und Dankbarkeit jährlich 2.000 Francs aus Frankreich zusichern würde.[63] Agassiz erhielt das Ehrenbürgerrecht.
Neuchâtel wird Stadt der Wissenschaft
Durch die intensive wissenschaftliche Tätigkeit von Louis Agassiz wurde Neuchâtel innert kürzester Zeit zur Stadt der Wissenschaft. Um Agassiz herum hatte sich ein
beachtlicher wissenschaftlicher Stab gruppiert: Die Lehrer der ersten Akademie Arnold Guyot (Glaziologe), Léo Lesquereux (Bryologe), Henri Ladame (Chemiker und Mathematiker), Henri de Joannis,
(Mathematiker), Frédéric DuBois de Montperreux (Geograf). Desweiteren die Coulons Vater und Sohn, Auguste de Montmollin (Geologe), F. de Rougemont senior und Ch.-Ph. deBosset (Archäologen),
Jean-Frédéric d’Ostervald (Kartograph); Louis Favre (Schriftsteller) und die bekannte Ärzte Jacques-Louis Borel, de Castella, H. de Purry und Léopold de Reynier.[17]
Die reichhaltige Sammlung fossiler Conchylien der Schweiz, welche der Geologe Gressly von seinen Reisen zurückgebracht hatte, veranlasste Agassiz zu einer
Bearbeitung der fossilen Conchylien des Jura und der Kreide, welche unter dem Titel «Études critiques sur les Mollusques fossiles du Jura et de la Craie» in 4 Lieferungen mit 100 Tafeln erschien,
welchem Werke er noch mehrere ähnliche ergänzende Publikationen über fossile Conchylien folgen liess, von denen die «Iconographie des Coquilles tertiaires, reputées identiques avec les espèces
vivantes ou dans différens terrains de l'époque tertiaire» und ,«Mémoire sur les moules de Mollusques vivans et fossiles» die bedeutendsten sind.
1839 begann er in Zusammenarbeit mit Carl Vogt ein grosses Werk über die Naturgeschichte der Flusswasserfische Mitteleuropas vorzubereiten, das sich auch auf die Anatomie und Embryologie der
Fische erstrecken sollte. Die erste Lieferung enthielt auf 24 Farbtafeln die Abbildungen der Gattungen Salmo und Thymallus mit kurzen erläuternden Texten. In der zweiten Lieferung gab Carl Vogt
unter Mitwirkung von Agassiz die Entwicklungsgeschichte der Salmonen. Als dritte Lieferung folgte eine Abhandlung über die Anatomie der Lachse, die Agassiz und Vogt 1845 im dritten Band der
Mémoires de la Société des Sciences Naturelles de Neuchâtel veröffentlichten.

Päpstliches Verbot
Am Oktober 1839 wollte Agassiz an der Versammlung des Naturforscher-Vereins in Pisa teilnehmen. Die päpstliche Regierung verbot jedoch den Anlass. Kardinal Lambruschini (1776-1854) teilte in
Rundschreiben allen Kanzlern der römischen Universitäten mit, dass der Heilige Stuhl den päpstlichen Untertanen nicht nur die Teilnahme, sondern auch den Briefwechsel mit diesem Verein verbietet.
Als Strafe drohte die Vermögenskonfiskation.[98] Agassiz, empört über dieses Verbot, wollte eine Übersetzung des von Lambruschini unterzeichneten
Rundschreibens mit sachkundigen Bemerkungen an eine Neuchâteler Zeitung schicken. Aber diese lehnte ab. Agassiz war genötigt, seine Bemerkungen in den Nouvelliste Vaudois zu publizieren. «Vor
zwei Jahrhunderten», sagte Agassiz, «war der 70-jährige Galilei gezwungen, vor einem römischen Inquisitionsgericht kniefällig die Ketzerei abzuschwören, dass die Erde um die Sonne sich bewege.
Heute verbietet man, und zwar abermals in Rom, Männern der Wissenschaft den Besuch eines Vereins von Gelehrten, der sich um nichts, als um Förderung naturhistorischen Wissens
bekümmert.»[99]
Lord Francis Egerton
Um Agassiz in seinen Forschungen zu unterstützen, kaufte Lord Francis Egerton 1841 die Originalzeichnungen zu Agassiz‘ Werken über die Fische. Der Naturforscher durfte die Zeichnungen in Neuchâtel aufbewahren, solange er sie benötigte.
Agassiz Portofrei
1842 erhielt Agassiz vom Kanton Neuchâtel das Privileg der Portofreiheit, um seine umfangreiche wissenschaftliche Korrespondenz zu erleichtern.[95]
Ab März 1842 erhielt Agassiz eine jährliche Summe von 3000 Franken vom König von Preussen, «als Entschädigung für die bedeutenden Opfer, welcher dieser Gelehrte für seine wissenschaftlichen
Forschungen bringt.» Das fürstliche Geschenk soll auf den Vorschlag von Alexander von Humboldt erfolgt sein.
Im Juli 1842 ernannte die Akademie von Neuchâtel Louis Agassiz zu ihrem Rektor und beschloss, dass der Lehrkurs alljährlich mit einer öffentlichen Sitzung beginnen sollte, in welcher der Rektor
eine Rede zu halten und ein Professor eine wissenschaftliche Abhandlung vortragen sollte.
Königlicher Besuch in Neuchâtel
Am 25. September 1842 besuchte das preussische Königspaar, Friedrich Wilhelm IV (1795-1861) Elisabeth Ludovika von Bayern (1801-1873), zunächst den Gottesdienst in der Kirche Notre-Dame. Danach
gab der König, der die neuchâtelische Medaille trug, eine Audienz und besuchte das Kollegium und die Lehrerschaft. Agassiz und Coulon, die auch dort waren, erhielten grosse Anerkennung und
begleiteten Seine Majestät durch die Säle des Naturhistorischen Museums. Die Schüler/innen waren ebenfalls versammelt und empfingen den König mit einem «Dieu sauve le roi!». Was die Dekoration in
der Stadt betraf, so schmückte Agassiz sein Haus mit dem Transparent vom Hotel des Neuchâtelois auf dem Aaregletscher und mit dem eidgenössischen Banner auf dem Felsen. Darauf stand die
Inschrift: «Unter seinem Schutz blühen die Wissenschaften.» Für seine künstlerischen und wissenschaftlichen Verdienste erhielt Agassiz vom König eine Goldmedaille.
1844 schloss Agassiz die Publikation seines Riesenwerkes über die fossilen Fische ab, das in 5 Quartbänden mit 311 Tafeln in Folio in Neuchâtel erschienen war. 80 der grössten Museen Europas hatten das Material dafür geliefert, und die Zahl der beschriebenen und angeführten Arten belief sich auf 1700 in etwa 20.000 Exemplaren. Diese ,«Recherches sur les poissons fossiles» (1833-1844) war unbestritten Agassiz' bedeutendstes Werk und bildeten mit Cuvier's und Valenciennes' «Histoire naturelle des poissons» (1828) und Johann Müller's anatomischen Abhandlungen die Grundlage der Kenntnisse im Reiche der Fische (1844), indem sie sich nicht allein auf das Gebiet der Ichthyolithen beschränken, sondern über das ganze Feld der Anatomie und Systematik der Fische ausdehnen und insbesondere den letzteren Zweig wesentlich umgestalteten. Die weiteren Forschungen führten den Gelehrten nacheinander zur Herausgabe der «Beschreibung der schweizerischen fossilen Echinodermen», «Monographie der lebenden und fossilen Echinodermen» (Seetierformen), «Kritischen Studien über die fossilen Mollusken» und der «Monographie der fossilen Fische im roten Sandstein».
Literaturverzeichnis für Naturgeschichte
Agassiz erstellte mehrere bibliographische Werke, wie die «Matériaux pour servir à une Bibliothèque zoologique et paléontologique», ein beeindruckender Folioband, 1842 bis 1845, ein Literaturverzeichnis für Naturgeschichte. Der Nomenclatur «Zoologicus» (1842 bis 1846) ist ein systematisches Verzeichnis der Genera sämtlicher Tiere, an welchem sich die bedeutendsten Fachleute der Zeit beteiligten, wie H. von Meyer, A. Wagner, Q. Waterhouse, Strickland, Duméril, C. L. Bonaparte, Kaup und viele andere.
Forschungen über die Eiszeit
Nachdem Louis Agassiz durch seine Veröffentlichungen über fossile Fische und Seeigel berühmt geworden war, beschäftigte er sich in Neuchâtel intensiv mit der Eiszeit. Er war der eifrigste Verfechter von Charpentiers Theorie über die frühere Ausdehnung der Gletscher und den Transport von Findlingen durch das Gletschereis.
«Wo Menschen schweigen, müssen Steine reden. Und sie reden zu uns, die Steine und Felsen, die Berge und
Täler, aber ein Jedes hat seine besondere Sprache. Es kam eine Zeit, wo der grösste Teil der Erde plötzlich
bedeckt war von einer ungeheuren Masse gefrorenen Wassers, die alles Leben vernichtete: die Eiszeit. Der
Rückzug der Eiskruste erfolgte durch die Wärme der Sonne und des Erdinneren, nach dem Norden und den
Alpen hin. Von dort wurden die (erratischen) Blöcke nach ihren jetzigen Lagerstätten bewegt. Es entstanden
einzelne Gletscherzüge, welche nicht mehr ein zusammenhängendes Ganzes bildeten.»
Louis Agassiz in «Eine Periode der Geschichte unseres Erdballs», 1841, S. 1ff
Luzern zur Eiszeit. Gemälde von E. Hodel, 1927, im Gletschergarten Luzern.
Nach einer wissenschaftlichen Skizze von Professor A. Heim.
Die ersten Pioniere
Bereits 1802 hatte der schottische Gelehrte John Playfair die Idee, dass die Findlinge von Gletscher transportiert worden sein könnten. Der Bergführer Jean-Pierre
Perraudin (1767-1858) lieferte 1815 den Anstoss zu dieser Theorie. Der Walliser Strasseninspektor Ignaz Venetz (1788-1859) erläuterte seine Forschungen zur Gletscherlehre 1821 in seinem Werk über
die Wanderungen der Gletscher «Mémoire sur lés Variations de la Température dans les Alpes de la Suisse». 1829 stellte er dazu eine eigentliche Eiszeit-Theorie auf die ihn zum Begründer der
Eiszeit-Theorie machte. Die Alpenklubsektion Monte Rosa weihte 1869 den Ignaz Venetz-Findling auf dem Hügel von Valère in Sitten mit der Jahreszahl «1821» ein. Sie sieht in Venetz auch den
ersten Begründer der Glaziologie. Die Ansichten von Venetz überzeugten auch Jean de Charpentier (1786-1855), Direktor der Saline von Bex. Sie wurden danach von Charpentier und Agassiz
weiterentwickelt.
Auch Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) sei hier erwähnt. Er notierte am 7. November 1779 in seinen Briefen aus der Schweiz: «An dem Weg (bei St. Maurice)
betrachten wir die vielen Granit- und Gneisstücke, die trotz ihrer Verschiedenheit doch alle von einem Ursprung zu sein scheinen.» In «Wilhelm Meisters Wanderjahre» nimmt Goethe darauf mit den
folgenden Bezug, die in den früheren Auflagen nicht erhaltenen sind: «Zuletzt wollten zwei oder drei stille Gäste sogar einen Zeitraum grimmiger Kälte zu Hilfe rufen und aus den höchsten
Gebirgszügen, auf weit ins Land hineingesenkten Gletschern, gleichsam Rutschwege für schwere Ursteinmassen bereiten und diese auf glatter Bahn, fern und ferner hinausgeschoben, im Geiste sehen.
Sie sollten sich bei eintretenden Epochen des Auftauens niedersenken und für ewig in fremdem Boden liegen bleiben.»[73]
Die naturwissenschaftlichen Aspekte der Eiszeittheorie wurden später von Karl Schimper (1803-1867), Naturforscher und Dichter, eingehend untersucht. Er war mit
Agassiz seit dessen Studienzeit in Heidelberg und München befreundet und hielt sich von Dezember 1836 bis Mai 1837 in Neuchâtel auf. 1836 waren Agassiz und Schimper bei Charpentier zu
Gast, lernten dessen Beobachtungen näher kennen und Schimper besang bald die Eiszeit in einem Gedicht. Schimper war ein Kenner des Eises und seiner Bewegungskräfte, die er bereits in seinen
Münchner Vorlesungen von 1835/36 erläutert hatte. Er stand in regem Kontakt mit Agassiz und übermittelte ihm auch das entsprechende Heft seiner Münchener Vorträge, woraufhin Agassiz das Thema
vertiefte. Agassiz, der sein Schüler wurde, hatte einige Anregungen Schimpers zunächst falsch interpretiert und in der Öffentlichkeit verbreitet. Agassiz war das Wesen der Blockverschleppung
durch die Gletscher noch fremd, so dass er sie als Gleitbewegung erklärte, in die die Blöcke bei der Hebung der Alpen auf der glatten Oberfläche der nun geneigten Eismassen gerieten. Am 15.
Februar 1837 verfasste Schimper in Neuchâtel seine Ode: «Die Eiszeit», die er an die Zuhörer der öffentlichen Vorträge von Agassiz in Neuchâtel verteilen. Damit erschien das Wort «Eiszeit»
erstmals in gedruckter Form (Die Eiszeit, wissenschaftliches Document, zum ersten Mal abgedruckt und in fliegenden Blättern aufgeteilt in Neuchâtel am Geburtstag Galilei's, 15. Febr.
1837).[66]
Agassiz macht Gletscherkunde weltweit bekannt
Agassiz machte die neuen Erkenntnisse der Gletscherforschung einem breiten Publikum bekannt, als er am 24. Juli 1837 in Neuchâtel vor der Versammlung der Schweizerischen Naturforschenden
Gesellschaft den Vortrag «Discours sur les glaciers» hielt. Er erklärte, dass Eismassen den Grundstock der Alpen bedeckten und dass es deshalb in Europa eine Eiszeit gab, in der Mammuts lebten.
Zum ersten Mal wurde eine Eiszeit in Europa wissenschaftlich diskutiert. Dabei erregte er den Zorn von Leopold von Buch, dem berühmtesten Geologen seiner Zeit, der den Saal mit dem Ausruf
verliess: «O ehrwürdiger de Saussure, bete für uns!». De Saussure, der Begründer der rationalen Geologie, vertrat die Ansicht, dass die Findlinge durch die Stoss- und Fallkraft von Wasserströmen
transportiert wurden. Dieser Meinung schlossen sich damals die meisten Gelehrten an.[17] Alexander von Humboldt hatte die Eiszeittheorie überhaupt nicht
verstanden.
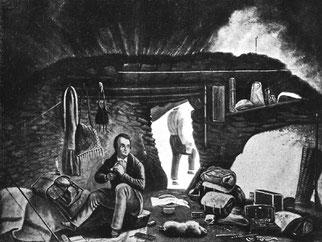
Expeditionen in den Schweizer Alpen
Um weitere Beweise für seine Gletschertheorie zu sammeln, unternahm Agassiz im Sommer 1838 Reisen ins Haslithal und zu den Gletschern des Montblanc. Die Gletscher wurden zum Hauptgegenstand seiner Forschungen, die weltweit Beachtung fanden.[8] Louis Agassiz beteiligte sich hauptsächlich mit Arnold Guyot, dem politischen Flüchtling Edouard Desor (1811-1882), dem Zeichner Dinkel und Carl Vogt an den Untersuchungen über die Alpen und ihrer Gletscherphänomene. Vogt beschrieb das Verhältnis so: «Es war eine wissenschaftliche Fabrik mit Gütergemeinschaft. Unten in dem an der Promenade am See gelegenen Haus waren zwei Magazinräume, vollgestopft mit Fossilien und sonstigen Materialien. Später stiess dann der Forscher Amanz Gressly (1814-1865) zu uns.»
Auf dem Aaregletscher hielt sich sein Expeditionsteam ab 1840 längere Zeit im berühmt gewordenen, selbst errichteten «Hôtel des Neuchâtelois» auf. Es handelte sich
um einen mächtigen Felsblock, der von den Höhen des Schreckhorns niederfiel und eine Vertiefung im Gletscher bildete. Der mit Steinen ausgelegte Boden wurde mit Heu und einem Wachstuch bedeckt
und diente zusammen mit einigen Decken als Lager. Die Küche befand sich ausserhalb des höhlenartigen Baus, die Lebensmittel wurden vom Grimselhospiz bezogen. Der Zugang zu dieser
Naturforscherwohnung war so schmal, dass man sich gerade so hindurchzwängen konnte.[33] Die ersten Bewohner des Hotels waren Louis Agassiz, Edouard Dessor,
Karl Vogt, Francois von Pourtalès, Celestine Nicolet und Henri de Coulon.[8]
Agassiz als Leiter der Arbeiten führte die physikalischen Untersuchungen durch und machte thermometrische, hydrometrische, psychometrische und barometrische
Beobachtungen, Desor untersuchte die feinere Struktur des Eises und ihre Veränderungen unter verschiedenen Bedingungen, die Moränen und ihre Entstehung, Vogt beobachtete die Tierwelt, Nicolet die
Pflanzenwelt der Hochlagen.
Die Naturforscher des Aaregletschers schufen nicht nur die Grundlagen der Glaziologie, sondern wurden auch zu Pionieren des Alpinismus: Erstbesteigung des Grossen
Lauteraarhorns (das sie für das Schreckhorn hielten), Erstbesteigung des Rosenhorns, Erstbesteigung des Galenstocks, Zweitbesteigung des Wetterhorns, Viertbesteigung der Jungfrau etc.[17]
Das Benennen von Berggipfeln
Von den Gipfeln, die sich südöstlich des Finsteraarhorns erheben, trug nur einer den Namen Oberaarhorn, und Agassiz empfahl, die anderen zu Ehren der Naturfoscher Studerhorn, Scheuchzerhorn, Altmann, Grunerhorn und Escherhorn zu nennen. Desor schlug seinerseits vor, den 3956 m hohen Gipfel nördlich des Finsteraarhorns Agassizhorn zu taufen. Diese Vorschläge wurden von der damaligen Landestopographie angenommen.[20]
Publikationen
Die Gletscheraufenthalte von 1840 bis 1846 wurden in mehreren Publikationen veröffentlicht.[34] Ein erfolgreiches Werk schrieb Agassiz 1841 unter dem Titel «Etudes sur les Glaciers», in dem er jedoch Karl Schimper, den Namensgeber der Eiszeit, mit keinem Wort erwähnte. Das «Hôtel de Neuchâtelois» diente noch viele Jahre als Touristenattraktion. Agassiz beabsichtigte, die Ergebnisse der vereinigten Arbeiten der Gletscherforschung der Aare, am Schreckhorn, am Finsteraarhorn, an der Jungfrau etc. in einem grossen, dreibändigen Werk zusammenzufassen. Der erste Band, bearbeitet von Agassiz, sollte die Gletscher behandeln, der zweite, bearbeitet von Guyot, die Findlinge in den Alpen, der dritte, bearbeitet von Desor, die Findlinge ausserhalb der Schweiz, in Europa und Amerika. Nur der erste Band des umfangreichen Werkes erschien 1847 in Paris unter dem Titel: «Nouvelles recherches sur les glaciers». Das weitere Erscheinen unterbrach das stürmische Jahr 1848, in welchem der revolutionäre Grossrat Neuchâtels die Akademie am 13. Juni aufhob und die Professoren am 30. Juni ohne irgendwelche Entschädigung auf die Strasse setzte.[18]
Wie aktuell sind Agassiz‘ Thesen?
Geowissenschaftler Martin Schwarzbach (1907-2003): «Es muss betont werden, dass die damaligen Vorstellungen der Eiszeitforscher zwar revolutionär wirkten und eine neue Epoche der paläoklimatologischen Forschung einleiteten, aber in mancher Hinsicht längst überholt sind. Das gilt auch für den neu geschaffenen Begriff ‹Eiszeit› selbst, der bei Schimper und Agassiz eine andere Bedeutung hatte als heute.»[93]
Agassiz hatte auch eine Meinung über das Alter vom grössten Gletscher der Schweiz. Die Neue Zürcher Zeitung vom 27. April 1843 berichtete: «Louis Agassiz hat
der französischen Akademie der Wissenschaften einen Brief zugesandt, worin er die Frage behandelt: Welches ist das Alter des grössten Gletschers der Schweiz? Bei der Beantwortung dieser Frage ist
er so vorgegangen: Der Schnee, der jährlich fällt, bildet eine auch später noch zu unterscheidende Schicht, deren Grenze auf der Oberfläche des Gletschers sich sehr scharf zeichnet. Die
Grenzlinien dieser Schichten bewegen sich nach unten, so dass man, ähnlich wie bei den Jahrringen der Bäume, zählen kann, wie viele Jahre vergangen sind, bis eine solche Schicht eine gewisse
Strecke zurückgelegt hat. Aus seinen Beobachtungen in der Neuenburger Herberge auf dem Lauteraargletscher hat er gefunden, dass zwischen diesem Punkt und dem unteren Ende des Gletschers, d. h.
auf einer Entfernung von 25.000 Fuss, die jährliche durchschnittliche Bewegung des Gletschers 238 Fuss beträgt und dass folglich die Neuenburger Herberge in 105 Jahren (also 1949) bei dem unteren
Rand des Gletschers angelangt sein wird. In weniger als 200 Jahren müssten also die obersten Teile des Gletschers zuunterst sich befinden, denn die ganze Länge desselben ist ungefähr 37,000 Fuss.
In eben dieser Zeit, glaubt Agassiz, werde demnach auch der Gletscher sich gänzlich erneuert haben. So dass der Aletschgletscher im Wallis, der grösste in der Schweiz, wenn man von einem
Gletscher auf den anderen schliessen könnte, nur 300 bis 400 Jahre alt wäre.»
Wilfried Haeberli, Prof. em. Universität Zürich, stellte über Agassiz‘ Erkenntnisse zum Thema grösster Schweizer Gletscher 2023 folgendes fest: «Die geschätzten Zahlen sind richtig und immer noch
gültig. Dies lässt sich auch mit modernen Gletscherfliessmodellierungen stützen. Für temperierte Gletscher (Gletscher, in denen die Eistemperatur am Druckschmelzpunkt ist und die deshalb nicht am
Untergrund angefroren sind) ist der Zusammenhang qualitativ einfach: Das Alter ist weitgehend unabhängig von der Grösse. Grosse Gletscher sind lang (mehrere km), aber auch dick (hunderte Meter),
haben einen grossen Massenumsatz und fliessen deshalb schnell (Zehner bis wenige Hunderter Meter pro Jahr), kleine Gletscher sind kurz (bis km), aber auch dünn (Zehner von m), haben einen kleinen
Massenumsatz und fliessen deshalb langsam (m/Jahr). Ein paar Jahrhunderte alt ist das Eis am unteren Ende all dieser Gletscher, nachdem es seine Reise in der Nähe des Gletscherbettes absolviert
hat - was zuoberst abgelagert wird, kommt zuunterst wieder heraus. Die entscheidenden Unsicherheiten der Modellrechnungen liegen bei den Annahmen über das Gleiten des Gletschers und über das
zeitabhängige Klima-Forcing (bei Erwärmung/Gletscherrückgang schmelzen die untersten/ältesten Eispartien zuerst ab). Viel älter ist das Eis von kleinsten, kalten Eisflecken. Diese sind dünn
(Meter), können sich im Sommer nicht über 0°C erwärmen, im Winter aber weit unter 0°C abkühlen, sind deshalb kalt (< 0°C) und am Untergrund (Permafrost) angefroren, fliessen kaum (Millimeter
bis Zentimeter pro Jahr) und können Jahrtausende alt sein. Oetzi war in einem solchen kalten Eisfleck über 5000 Jahre lang konserviert. Allerdings sind wohl die meisten dieser Eisflecken im
Hitzesommer 2003 und danach verschwunden.»

Initiant vom Uhrenmuseum (MIH) La Chaux-de-Fonds
Louis Agassiz war von 1837 bis 1847 Mitglied der «Société d'Emulation patriotique de la Principauté de Neuchâtel et Valangin» (patriotische Emulationsgesellschaft). Er zeigte bei den
Versammlungen dieser Gesellschaft eine ausgeprägte Vorliebe für Fragen zur Uhrenindustrie. Dort griff er 1839 einen Vorschlag wieder auf, den er schon mehrmals gemacht hatte, der aber in der
Öffentlichkeit kein Gehör gefunden hatte: die Abfassung spezieller Schriften über den Zustand und die Fortschritte unserer Uhrenindustrie. Bald vervollständigte Agassiz seine Gedanken und betrat
neues Terrain, indem er seine Kollegen aufforderte, sich mit ihm anzuschliessen, um einen von ihm entworfenen allgemeinen Studienplan zu verwirklichen. Dieser sah vor:[80]
1) Die Einrichtung von Bibliotheken, die alles enthalten, was sich auf die Uhrmacherei und die Wissenschaften bezieht, die das Erlernen dieser Kunst erleichtern
können.
2) Die Einrichtung von Uhrenmuseen, welche die verschiedenen Arten der Uhrenteile und die Instrumente, mit denen diese Gegenstände hergestellt werden, ausstellt. Objekte von heute und aus anderen
Epochen zu beschaffen und vollständige Stücke verschiedener Arten auszustellen. Diese Sammlungen würden dazu dienen, die Entdeckungen unserer Industrie zu dokumentieren und die Erinnerung daran
aufrechtzuerhalten.
3) Die Bildung von Gesellschaften, die sich mit allem, was die Uhrmacherei betrifft, sowie mit der Erhaltung und Vermehrung dieser Sammlungen befassen sollen.
4) Die Einrichtung einer jährlichen Ausstellung der Produkte der Uhrmacherei und die Verteilung von Preisen zur Ermutigung.
5) Die Bildung eines allgemeinen Komitees, das seine Untersuchungen fortsetzt, Verbesserungen vorschlägt und seine Ermittlungen nach aussen ausdehnt.
6) Die Einrichtung einer Uhrmacherschule als aktivstes Mittel.
7) Das Projekt könnte mit Spenden verwirklicht werden.
Die Société d'Emulation wollte ihren Teil dazu beitragen und befürwortete zu diesem Zweck eine Summe von 100 Louis d'or (1839). Und da man die
baldige Gründung einer Gesellschaft in den Bergen ankündigte, um den Fortschritt der Uhrmacherei zu fördern, wurde Louis Agassiz spontan auch damit beauftragt, sich mit dieser Gesellschaft über
die Verwendung der Spende der Gesellschaft zu einigen. 1841 zweifelte der Bürgermeister Nicolet am Erfolg des Projekts der Uhrengesellschaft und riet sogar, es aufzugeben.[80] Die Uhrmacherei in den Neuchâteler Bergen war weit verstreut. Die Werkstatt war eine Familienwerkstatt, und der Lehrling konnte, wenn er sich auf einen bestimmten
Teil der Uhrmacherei beschränkte, leicht bei seinem Meister eine Pension und eine Lehre finden. Er hatte die Möglichkeit sich von Werkstatt zu Werkstatt weiterzuentwickeln. Mit zunehmender
Arbeitsteilung wurde es jedoch für Jugendliche, die zwar eine Vorliebe für die Uhrmacherei hatten, aber nicht aus einer Uhrmacherfamilie stammten, immer schwieriger, eine vollständige Lehre zu
absolvieren. Vor allem in La Chaux-de-Fonds nahmen die Vorschläge von Agassiz konkrete Gestalt an. Es dauerte nicht mehr lange, bis sie verwirklicht wurden. Ein grosszügiger Bürger,
Philippe-Henri Matthey, schenkte der Stadt La Chaux-de-Fonds ein Grundstück unter der Bedingung, den Erlös für die Ausbildung armer Kinder zu verwenden.
Dank dieser Schenkung konnte 1865 in der Rue du Progrès 40 eine Uhrmacherschule eröffnet werden. Bei der Eröffnung umfasste der Lehrauftrag auch das Sammeln von Uhren zu didaktischen Zwecken. Die
Uhrensammlung wurde im Laufe der Jahre immer umfangreicher. 1883 gründete die Schule eine Unterkommission, um die Kollektion zu präsentieren. Der Umfang und die Reichhaltigkeit der gesammelten
Objekte veranlassten eine kleine Gruppe von Uhrenliebhabern, die Eröffnung eines offiziellen Museums vorzuschlagen.[78] Paul Berner, Lehrer der
Uhrmacherschule in Biel, übernahm am 1. Juli 1884 die Leitung der Uhrmacherschule in La Chaux-de-Fonds, die er 44 Jahre lang innehatte.
Für die Bedürfnisse der Stadt genügte das bescheidene Museum nicht mehr. Die Kommission wollte die Uhren von Jean Richard, Berthoud, Courvoisier, Perrelet, Breguet und anderer Pionieren der
Uhrmacherkunst aufnehmen, aber auch Werkzeuge, Bücher, Schriften und geschichtliche Urkunden. Eben alles, was der alte Plan von Louis Agassiz vorgesehen hatte. Dank einem neuen Plan von Maurice
Picard und der Zustimmung des Gemeinderates konnte das «Uhrenmuseum von La Chaux-de-Fonds» am 24. März 1902 in den bescheidenen Räumen der Uhrmacherschule eingeweiht werden.[79] Erster Präsident der Museumskommission war Maurice Picard, der dem Museum Objekte aus zwei Sammlungen präsentierte. Es handelte sich um Werke des Historischen
Museums und der Uhrmacherschule. Am Eröffnungstag waren 600 Exponate ausgestellt, die in ihrer Gesamtheit ein anschauliches Bild der Geschichte der Uhrmacherei vermittelten. Sie reichten von sehr
alten Uhren aus den Anfängen der Uhrmacherei über Werke berühmter Meister bis hin zu den neuesten Erzeugnissen der Uhrmacherei, darunter hervorragende Präzisionsarbeiten. Auch Maschinen zur
Herstellung von Taschen- und Grossuhren sowie Bücher und Zeichnungen waren zu sehen. Finanzielle Unterstützung erhielt das Museum durch die Uhrenhersteller. Das Museum wurde 1907, 1952 und 1967
erweitert und 1968 in «Musée international d'horlogerie» (MIH) umbenannt. Nachdem die Räumlichkeiten in der Uhrmacherschule nicht mehr ausreichten, wurde es 1974 in das heutige Gebäude
verlegt.[77]
Hohe Schulden und Schliessung der 1. Akademie
Die Einkünfte von Louis Agassiz reichten nicht aus, um die Kosten zu decken, die seine wissenschaftlichen Tätigkeiten für die Gletscherforschung verursachte. Sein Werk über die fossilen Fische
kostete ihn viel Geld. Seinem Bruder Auguste Agassiz soll er deshalb 100‘000 Franken geschuldet haben.
Der König von Preussen stellte durch Kabinettsorder vom 4. März 1845 Louis Agassiz während 2 Jahren eine jährliche Summe von 8000 Neuchâteler Livres zur Verfügung. Damit sollte er eine
wissenschaftliche Reise in die Vereinigten Staaten von Nordamerika unternehmen. Daher beschloss Louis Agassiz 1846 in die Vereinigten Staaten zu ziehen, wo er innerhalb von zwei Jahren seine
Schulden zurückzahlen konnte.[5] Die Aufregung in Neuchâtel war gross. Um zwei Uhr morgens im März 1846 verliess er Neuchâtel. Die Studenten kamen in einer
Fackelprozession, um ihm ein Abschiedsständchen zu bringen.[63] Agassiz' Abreise war der Auftakt zu einer Reihe von Auswanderungen, die der Neuenburger
Wissenschaft einen Rückschlag versetzten, aber auch bewiesen, wie sehr das junge Amerika die Naturforscher schätzte. Vor und nach der Revolution überquerten Arnold Henry Guyot, Edouard Desor,
George Auguste Matile (1807-1881) und Léo Lesquereux (1849-1853) das Meer.
Kritische Stimmen
Louis Agassiz war vor allem ein Unternehmer und Organisator mit einem unwiderstehlichen
Drang zu sammeln. Dazu liebte er es, vor einem Publikum Vorträge zu halten und im Mittelpunkt zu stehen, was besonders in Neuchâtel der Fall war. Er eignete sich zu diesem Zweck oft Werke seiner
Mitarbeiter und Freunde an. J. Marcou schrieb in seiner 1896 erschienenen Agassiz-Biografie: «after 1837 he always made too much use of others in the work of writing and too often of
observation.» (Band 1, S. 115). Dies führte zu Streitigkeiten mit einigen Mitarbeitern und über die Ansprüche der Einzelnen.[67]
Der Naturforscher Karl Schimper hatte Agassiz auf dessen Bitte hin beim Antritt seines Lehramts seine systematisch geordnete Mineraliensammlung geliehen. Agassiz benutze sie sechs Jahre lang für
seine Vorträge. Von Schimper endlich daran gemahnt, an die Rücksendung zu denken, leugnete er zuerst den Empfang derselben. Eine Kiste mit dem von Agassiz handschriftlich als «Minéraux»
bezeichneten Frachtbrief traf 1838 doch noch in München ein. Schimper öffnete sie im Beisein seiner gelehrten Freunde. Man fand darin Papierschnitzel, Moosklumpen, Rindenstücke und alles
mögliche, aber keine Mineralien. Die Sammlung von Schimper verblieb im Naturhistorischen Museum von Neuchâtel. Der Vorfall erregte 1842 auf der grossen Naturforscher-Versammlung in Mainz grosses
Aufsehen.[68]
Auch der Jura-Geologe Amanz Gressly wurde von Agassiz überredet, seine Funde dem Museum von Neuchâtel zur Verfügung zu stellen, wo das Material systematisch geordnet, Gressly jederzeit zugänglich
sein sollte. Agassiz stellte ihm in Aussicht, ihn nach Amerika mitzunehmen. Aber als Gressly eines Tages von seiner Exkursion zurückkehrte, war Agassiz bereits abgereist. Die geologischen Funde
von Gressly hatte er mitgenommen und später für viel Geld in England verkauft.[69]
Coming to America
Agassiz lebte ab 1846 in Nordamerika. Louis Agassis: «Als ich 1846 in dieses Land kam, hatte ich nicht vor, hier zu bleiben. Ich war auf Einladung von John A. Lowell
gekommen, um vor dem Lowell Institut eine Vorlesung zu halten. Ich hatte mich für anderthalb Jahre von der Hochschule in Neuchâtel beurlauben lassen, mit der ich damals verbunden war, und es
hatte dem König von Preussen gefallen, mir die Mittel für eine wissenschaftliche Erkundung einiger Teile dieses Kontinents zu gewähren.»[86]
Im Sommer 1847 bezog er ein kleines Haus östlich von Boston in der Nähe eines Sees, wo er einen idealen Platz zum Sammeln von Seetieren fand. Bald besuchten ihn seine ehemaligen Kollegen Francois
François de Poutalès, Edouard Desor und Jakob Burkhardt. Die Zimmer seines Zuhauses nahmen die Form eines Laboratoriums an. Sie dienten entweder als Aquarien oder als Arbeitsraum.[8]

Erste Erfolge mit Vorlesungen
Auch in den Vereinigten Staaten trug Agassiz zur Förderung des Studiums der Naturwissenschaften bei. Ab 1847 konzentrierte er sich auf Vorträge, mit denen er seinen Lebensunterhalt bestreiten konnte. Der erste Erfolg stellte sich am Lowell-Institut in Boston ein, wo Agassiz seine ersten Vorträge hielt: Ein riesiger Saal des ehemaligen Theaters diente als Auditorium, in dem über 2000 Menschen Platz fanden. Die Gelehrten erhielten für ihre Vorträge ein Honorar von 1200 bis 2000 Dollar. Es kam vor, dass der Saal zu klein war und der Vortrag im folgenden Abend wiederholt wurde. Bei Agassiz hatten sich für einen Vortrag bis zu 7000 Personen angemeldet. Er verstand es, seine streng wissenschaftlichen Vorlesungen mit verständlichen Worten Menschen aller Schichten nahezubringen. Eine vornehme Dame sprach zu Agassiz: «Wissen Sie, dass ich ihretwegen seit zwei Monaten jede Woche zweimal Hausarrest habe?». Als Agassiz sein Erstaunen darüber ausdrückte, erzählte sie ihm, dass ihre zwei Kammerfrauen unbedingt seine Vorlesungen über Naturgeschichte anhören wollten.[7]
Ein «Hum-bug»
In Amerika wurde das altenglische Wort «bug» für alle Käfer verwendet. Einmal wurden seine Insektenkenntnisse auf die Probe gestellt. Einige Spassvögel von Studenten übergaben ihm einen
sonderbaren Käfer, der aus dem Körper, den Flügeln und den Beinen verschiedener Arten zusammengesetzt war. Der Professor betrachtete den Fremdling ernsthaft und sagte: «Meine Herren, diese
Spezies kommt weder in Europa noch in andern Teilen der Welt vor. Sie gehört ausschliesslich zu Amerika. Es ist ein Hum-bug!»
Agassiz‘ Tafelzeichnungen erscheinen in der Presse
1848 hielt er zoologische Vorträge in den Grossstädten New York, Albany, Philadelphia und Charleston. Die Zeitung «Tribune» reproduzierte seine Figuren, die er
an die Wandtafel zeichnete. In den Strassen wurde verkündet: «Professor Agassiz 6th Lecture with fine drawings, only two Cents». Ausser seinen zoologischen Vorlesungen, gab er in der
medizinischen Schule spezielle Vorlesungen über Entwicklungsgeschichte, die von einer grossen Anzahl von Ärzten angehört wurden. Dabei ging es vor allem um die Embryologie, über die die
Amerikaner nur wenig wussten.[13] Neben seinen faunistischen Studien und Forschungen widmete sich Louis Agassiz mit Vorliebe mit Gletscherkunde.
Neues Eheglück
Nachdem Agassiz Frau Cecile Braun Agassiz 1848 in Deutschland an Schwindsucht gestorben war, heiratete er Elisabeth Cabot Cary am 25. April 1850 in der King's Chapel in Boston, Massachusetts. Agassiz organisierte den Haushalt und kümmerte sich um die Finanzen und die Kinder. Elisabeth entwickelte enge Beziehungen zu ihren Stiefkindern Alexander, Ida und Pauline sowie zu ihren Enkelkindern. Eigene Kinder hatte sie nie.[89]
Das damalige Schulsystem der Vereinigten Staaten
Um Agassiz' Umfeld besser zu verstehen, werfen wir zunächst einen Blick auf das amerikanische Schulsystem der damaligen Zeit: In Amerika gab es nur wenige staatliche
Schulen. Die Schüler erhielten dort keinen Religionsunterricht und es herrschte in fast allen Staaten herrschte Rassentrennung. In den Staaten mit Schulpflicht konnten die Eltern wählen, ob sie
ihre Kinder auf eine öffentliche oder private Schule schicken wollten. Privatpersonen sorgten für Mittel- und Hochschulen, die religiös geprägt waren.
1868 gab es in den USA 200 Colleges und Universitäten. 80 wurden vom Staat gegründet und waren konfessionslos. 59 gehörten den Methodisten, 39 den Baptisten, 32 den Presbyterianern, 15 den
Episkopalen, 12 den Lutheranern, 11 den Kongregationalisten, und 2 den Unitariern an.[15] Boston hatte das fortschrittlichste Schulsystem überhaupt. Weisse
und Schwarze konnten, in Gegensatz zu New York, dieselben Institutionen besuchen. Viele Frauen studierten an en höheren Schulen (girls high and normal school). Die Schulen wurden auf Kosten der
Stadt Boston unterhalten und der Unterricht unentgeltlich erteilt. Neben den eigentlichen Lehranstalten bestand in Boston noch das bereits erwähnte Lowell-Institut. Es setzte sich zum Ziel, die
gesamte Bevölkerung durch Vorträge bedeutender Akademiker zu belehren.
Wenn Louis Agassiz auf seine Schulzeit zurückblickte, fragte er sich oft, ob es am Klima oder an der Lehrmethode lag, dass das Leben in den öffentlichen Schulen der Vereinigten Staaten so viel
angreifender für die Gesundheit der Kinder war, als dasjenige, in dem er aufgewachsen war. In den öffentlichen Schulen Amerikas hielt man die Knaben und Mädchen mit einer Unterrichtszeit von fünf
Stunden und einer Hausarbeit von ein- bis zwei Stunden für überlastet. In der Bieler Schule mussten die Knaben neun Stunden arbeiten und waren dabei gesund und vergnügt. Vielleicht lag das
Geheimnis in der häufigen Unterbrechung des Unterrichts; nach zwei bis drei Stunden Lernen gab es immer eine Pause zum Spielen oder Arbeiten.

Louis Agassiz, fotografiert von A. Sonrel in Boston, 1863. Foto: AEN, Louis Agassiz, 4.4
Lehrer an der Universität Harvard
Von 1847 bis 1851 lehrte Louis Agassiz an der Harvard Universität in Cambridge bei Boston. Die von einem Geistlichen gegründete Universität schrieb in ihren Statuten
das tägliche gemeinsame Morgengebet vor. Sie verpflichteten alle Studierenden zum sonntäglichen Gottesdienstbesuch.[15] Agassiz hätte seine
Forschungen in Amerika nie vorantreiben können, wenn er ihnen nicht einen religiösen Anstrich gegeben hätte.[16] Die Studenten in Harvard waren in zwei
Kategorien eingeteilt, die «under-graduates» oder Collegestudenten und die «professional students» oder Vollstudenten, die Jura, Medizin, Theologie, Naturwissenschaften oder technische Fächer
studierten. Die Studenten machten vier Jahrgänge durch und hiessen «Freshmen», «Sophomores», «Juniors» und «Seniors».
Die Freshmen lernten Griechisch, Latein, griechische Geschichte, Geometrie und Trigonometrie; die Sophomores zusätzlich zu diesen Fächern Französisch, Rhetorik, Chemie und Mathematik; die Juniors
Griechisch, Latein, Philosophie, englische Geschichte, Astronomie und Physik. Die Seniors hatten Nationalökonomie, Rhetorik, Deklamation, Physik, Geschichte der Union und die Verfassung Englands
und der vereinigten Freistaaten.
Nachdem zahlreiche Besucher von Agassiz‘ Vorlesungen am Lowell-Institut begeisterten waren, dauerte es nicht lange, bis der Bostoner Bürger Abbott Lawrence spendete 50.000 Dollar für die Gründung
einer naturwissenschaftliche Schule spendete.
Louis Agassiz: «Eines Tages besuchte mich Abbott Lawrence, der mir seine Pläne zur Gründung einer wissenschaftlichen Schule in Cambridge erläuterte. Er erklärte, dass es für ihn ein
zusätzlicher Grund wäre, seine Absicht sofort in die Tat umzusetzen, wenn ich eine Professur an dieser Schule annehmen würde. Ich fühlte mich nicht in der Lage, eine Entscheidung zu treffen,
bevor ich eine reguläre Entlassung aus dem College von Neuchâtel erhalten hatte, mit dem ich fünfzehn Jahre lang verbunden gewesen war. Diese Entlassung wurde gewährt, und im Frühjahrssemester
1848 trat ich mein Amt als Professor der wissenschaftlichen Schule an.» [86]
Die naturwissenschaftlichen Studien (science studies) der Uni Harvard wurden unter dem Namen «Lawrence scientific school» geführt. Unterrichtet wurden Mineralogie,
Geologie, Botanik, Zoologie, vergleichende Anatomie, Physiologie, Chemie, höhere Mathematik und Ingenieurkunde. Agassiz war als Professor für Zoologie und Geologie sowohl beim Lehrpersonal als
auch bei den Studenten beliebt.[13]
Der grosse Einfluss, den Agassiz auf die Lehranstalten ausübte, machte ihn bald zu einem der populärsten Männer Amerikas. Ständig erhielt er Aufträge, die ihn zeitweise von der Universität
fernhielten. Im Winter 1850/51 untersuchte Agassiz für die Küstenvermessung das Wachstum der Riffe Floridas.
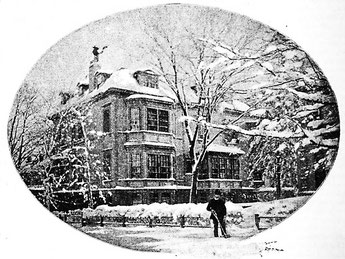
Intermezzo in Charlston und Rückkehr nach Harvard
Von 1851 bis 1853 unterrichtete Agassiz als Professor für Zoologie und vergleichende Anatomie an der medizinischen Fakultät von Charleston in Süd-Carolina. Danach
kehrte er als Professor für Geologie und Zoologie an die Harvard Universität zurück. 1854 bezog Agassiz das neue Haus, das die Universität für ihn gebaut hatte. Nun konnte er zum ersten Mal seine
tausende Bücher in einem Zimmer geordnet unterbringen. Im Haus der Familie Agassiz, das an die Universität angrenzte, richtete Louis Agassiz von 1844 bis 1863 eine «Privatschule für junge Damen»
ein. Clara Conant Gilson, ehemalige Schülerin: «Es war ein nicht zu unterschätzendes Privileg, dass die Studentinnen im Hause des Naturforschers Agassiz zu Gast sein und täglich mit ihm und
seiner Familie unter einem Dach leben durften.»[11]
1855 begann er die Publikation eines gross angelegten Werkes vorzubereiten, es hiess «Contributions of the Natural History of the United States.» 1855 lehnte er
einen Ruf nach Berlin ab, ebenso im selben Jahr einen Ruf nach Edinburgh, wo ihm ein verlockendes Gehalt von 50.000 Francs angeboten wurde. 1857 wurde ihm im naturgeschichtlichen Museum in Paris
ein Lehrstuhl für Paläontologie angeboten, den er jedoch ablehnte. Er blieb der Harvard-Universität in Cambridge treu.[5]
Kampf gegen den Spiritualismus
1857 hatte sich der sogenannte «Spiritualismus» so weit verbreitet, dass Wissenschaftler gegen ihn mobilisiert werden mussten. Louis Agassiz trat zusammen mit dem Mathematiker Pierre in Boston,
dem Astronomen Goud u.a. gegen das Tischrücken und die Geisterbeschwören auf. Zeremonielle Versuche fanden statt, aber die Toten antworteten nicht und bewegten keine Möbel. Mit dem von den
Gelehrten unterzeichnet Protokoll dieser mehrtägigen Versuche konnten nun die Spiritualisten angegriffen werden. [82]
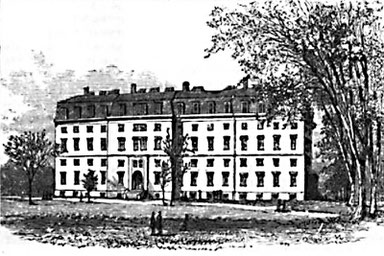
Das Agassiz-Museum von Harvard
Agassiz' naturkundliche Sammlung war zuerst in einem kleinen Bootshaus untergebracht. Später, als sie in einem grossen, alten Holzgebäude in der Nähe der Universität untergebracht war, hatte er ständig Angst vor Feuer oder anderen Unfällen, die sie so leicht hätten zerstören können. An die Wände genagelte Bretter dienten als Kästen und ein oder zwei Tische zum Sezieren. Agassiz widmete sich ununterbrochen seinem bescheidenen Museum und gab sein ganzes Geld dafür aus. Sein Privatleben war ein ständiger Kampf mit der Armut, die er freiwillig auf sich nahm. Die finanzielle Belastung wurde durch die Mädchenschule gemildert, die er mit seiner Frau erfolgreich eröffnete und in der er die Schülerinnen in den Naturwissenschaften unterrichtete. Die Gründung eines eigenen Nationalmuseums nach dem Vorbild der grossen europäischen Institute war Agassiz‘ Lieblingsidee.
Louis Agassiz: «Da ich an der Spitze einer neuen Abteilung für öffentliche Bildung stand, musste ich die für meinen Unterricht notwendigen Sammlungen anlegen, die an
der Universität nicht vorhanden waren. Zu diesem Zweck besuchte ich in meinen Ferien unsere Süd- und Weststaaten und hielt unterwegs Vorlesungen, um die Kosten für die erforderlichen
Ausgaben der umfangreichen Sammlungen aufzubringen. 1852 erhielt der Schatzmeister des Harvard College die Summe von 12.000 Dollar, die den Ausgaben entsprach, die ich bis dahin getätigt hatte,
um die von mir zusammengetragenen Sammlungen als Eigentum der Universität zu sichern. Mit diesen neuen Mitteln, die mir zur Verfügung standen und einigen Ergänzungen, habe ich die Sammlung weiter
vergrössert, bis durch eine Reihe glücklicher Umstände eine Bewegung zur Gründung eines öffentlichen Museums in Gang kam. William Gray stiftete der Universität Harvard die Summe von 50.000
Dollar, die ihm sein Onkel, der verstorbene Francis C. Gray, zur Gründung eines Museums für vergleichende Zoologie hinterlassen hatte. Mit diesem Grundstock war klar, dass eine grosse Institution
geschaffen werden konnte. Ein Komitee wurde gebildet und in erstaunlich kurzer Zeit wurden 75.000 Dollar durch private Spenden aufgebracht, um ein geeignetes Gebäude für die Aufnahme und
Aufbewahrung der vorhandenen Sammlungen zu errichten. Auf Empfehlung Seiner Exzellenz, Gouverneur Banks, in seiner Botschaft an den General Court, bewilligte die Legislative zuätzlich einen
Zuschuss von 100.000 Dollar. Damit war die im Aufbau befindliche Institution mit 225.000 Dollar ausgestattet. Nach einer Vereinbarung mit der Universität überliess das College dem Kuratorium
seine Sammlungen und (im Juni 1859) ein etwa fünf Hektar grosses Grundstück, auf dem das Museumsgebäude errichtet werden sollte. Es übertrug dem Professor für Zoologie und Geologie die Verwaltung
der Sammlungen unter der Leitung einer besonderen Fakultät, während das Ganze als unabhängige Einrichtung unter der Leitung des Kuratoriums in öffentliches Eigentum überging.»[86]
Mit Louis Agassiz als Konservator und seiner Sammlung als Starthilfe konnte ein geeignetes, feuerfestes Gebäude errichtet werden. Es erhielt den offiziellen Namen «Museum für Zoologie und
vergleichende Zoologie», war aber in der Bevölkerung unter dem Namen «Agassiz-Museum» bekannter. Im Dezember 1859 konnte bereits der grösste Teil der Sammlung von Agassiz ausgestellt werden,
darunter die reichste und vollständigste Fischsammlung der Welt.[6] Er hatte für das Museum eigene Assistenten um sich versammelt und ausgebildet. Sein
Lieblingssaal war der «synoptischen Saal», den er für einen allgemeinen Überblick über das Gebiet der Zoologie einrichtete. Es zeigte den Übergang von den ersten fossilen Lebewesen über die
Wirbeltiere bis hin zum Menschen. Der Saal stand abseits von allen anderen Exponaten und galt als der lehrreichste Teil des Museums. Der grösste Teil der riesigen Sammlung war in vielen
miteinander verbundenen Sälen untergebracht, um nach dem Plan von Agassiz die «zeitliche Abfolge und räumliche Verteilung» der Lebensformen zu veranschaulichen. Jeder Teil des Tierreichs war
reich illustriert. In Räumen, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich waren, befanden sich Laboratorien. In Verbindung mit der Universität organisierte er viele wissenschaftliche Expeditionen.
Tagelang erkundeten er und seine Studenten die Umgebung und sammelten Naturgegenstände. Abends versammelten sie sich am Lagerfeuer, wo Agassiz ihnen in lockerer Runde Vorträge über die
gesammelten Objekte hielt. Etappenweise wurde das Museum erweitert. Mit Agassiz begann in Amerika die praktische akademische Ausbildung in den Naturwissenschaften. In diesem Sinne galt das
Museum für vergleichende Zoologie als erste amerikanische Universität.

Ein erfolgreiches Buch
Das populärste und erfolgreichste Buch, das Agassiz in Amerika geschrieben hatte, war «Methods of Study in Natural History», das 1863 erschien, nachdem es zwei Jahre lang im Atlantic Monthly zu
lesen war, etwa zwanzig Auflagen erlebte und einen enormen pädagogischen Einfluss ausübte. Dies ist wahrscheinlich das einzige Werk, in dem Agassiz, der Autor, und Agassiz, der Redner, am engsten
miteinander verbunden sind.[121] Im Vorwort schreibt er: «Die Reihe der in diesem Band gesammelten Abhandlungen können als Ergänzung oder Kommentar zu meinem
Essay on Classification betrachtet werden. Ich habe mich bemüht, bei der Behandlung der Themen technische Details so weit wie möglich zu vermeiden. Das Schlusskapitel des Buches, das in den Band
aufgenommen wurde, aber nicht im Atlantic Monthly erschien, ist das einzige, das sich speziell an den professionellen Naturforscher wendet. Ich wollte diese Gelegenheit auch nutzen, um meinen
ernsthaften Protest gegen die Transmutationstheorie einzubringen, die in letzter Zeit mit so viel Geschick wiederbelebt und so allgemein angenommen wurde.»[122]
Femina humana superior mare
«Agassiz hatte die These ‹femina humana superior mare› (die Frau steht höher
als der Mann), die bei den Männern immer mehr auf Widerstand stiess.»
Alexander Braun, Brief vom 17. Juni 1831 an August Emanuel Fürnrohr (1804-1861)

Vortrag von Louis (Ludovico) Agassiz, München, 3. 4. 1830.
Foto: AEN, Agassiz, IV. Etudes, 16/2.1.
Louis Agassiz war der Ansicht, dass es in jeder aufgeklärten Gemeinschaft unerlässlich sei, der Frau alle politischen und erzieherischen Privilegien einzuräumen, auf die jeder Mann Anspruch habe. Er sah nicht, dass es bestimmte Themen der intellektuellen Tätigkeit gäbe, die dem einen Geschlecht mehr zustünden als dem anderen. Als er 1830 in München zum Doktor der Medizin promovierte, lautete seine Dissertation «Femina humana superior mare». Als er dann zum Professor in Harvard ernannt wurde, öffnete er die Tür seines Hörsaals auch für Frauen. Bei der Gründung des Museums sicherte er allen Lehrern, Männer wie Frauen, den Zugang. Mit der Gründung der Anderson School of Natural History ergab sich eine weitere Chance. Die erste Frage, die sich stellte, war: Wer soll aufgenommen werden? Louis Agassiz: «Ich habe bei dieser Frage nie gezögert, sondern sofort gehandelt und gesagt: Da die Organisation ganz in meinen Händen liegt, sollen Männer und Frauen gleichberechtigt aufgenommen werden. Wir brauchen eine Verbesserung in allen Bildungseinrichtungen, sowohl was die Erziehung der Jungen als auch was die Erziehung der Mädchen betrifft. Es ist eine Frage des menschlichen Fortschritts und nicht mehr nur eine Frage des Geschlechts.»[92] 1869 gründete der New Yorker Erziehungsrat eine höhere Schule für Frauen, die mit 1068 Schülerinnen eröffnet wurde. Eine ehemalige Schülerin von Louis Agassiz unterrichtete Zoologie, Latein und Stereometrie.
Die Website «History of American Women» zählt Pauline Agassiz Shaw (1841-1917) zu den Begründerinnen der Frauenrechtsbewegung in Amerika. Die Tochter von Louis und
Elizabeth Agassiz studierte an der von den ihren Eltern gegründeten Mädchenschule in Harvard. Pauline war eine leidenschaftliche Verfechterin der Frauenrechte und 16 Jahre lang Präsidentin der
von ihr 1901 gegründeten «Boston Equal Suffrage Association for Good Government». Sie unterstützte das Woman's Journal, eine wöchentliche Wahlrechtszeitung. Pauline spendete grosse Summen für das
Frauenwahlrecht, da sie davon überzeugt war, dass das Wahlrecht auch die Frauen in die Reformbewegungen einbeziehen würde.[104] Pauline nahm auch grossen
Einfluss auf die Kindergärten in den Vereinigten Staaten. 1884 besass Boston 30 Kindergärten, die von ihr gegründet und erhalten wurden.
Paulines Stiefmutter Elizabeth Cary Agassiz war eine selbstbewusste Frau. Sie begleitete Louis Agassiz auf seiner Reise nach Brasilien und auf der Hassler-Expedition. Über beide Reisen
veröffentlichte sie Berichte. Weitere Werke von ihr sind «A First Lesson in Natural History» (1859), «Geological Sketches» (1866) und nach dem Tod von Louis Agassiz «Life and Correspondence»
(1885). Das Online «Wander Women Project» erwähnt: «Elizabeth machte es sich zur Lebensaufgabe, Frauen den gleichberechtigten Zugang zu höherer Bildung zu ermöglichen. In einem ersten Schritt
gründete sie 1855, im Alter von 33 Jahren, eine Heimschule für Studentinnen, an der Dozenten der Harvard-Fakultät unterrichteten.»[105] Unter den
Studentinnen befand sich auch Pauline Agassiz. 1872 wurde Elizabeth Mitglied der Woman's Education Association und nahm zwei Jahre später an den Harvard Examinations for Women teil. Das WWP
berichtet weiter: «1894 gründete Elizabeth das ‹Woman’s College Radcliffe› und war dessen erste Präsidentin. Damit gilt sie in Amerika als Pionierin für die Gleichberechtigung von Frauen im
Bildungswesen. Ihr aussergewöhnlicher Ansatz bestand darin, dass sie auf eine Fusion des Colleges mit Harvard drängte. Diese Vision wurde erst 1999, mit der Gründung des Radcliffe Institute for
Advanced Study in Harvard verwirklicht. Im Jahr 2007 ernannte die Harvard Universität ihre erste weibliche Präsidentin, Catharine Drew Gilpin Faust.»[105]
Ehrenmitglied vom Alpenklub
1864 wurde Louis Agassiz zum Ehrenmitglied vom 1863 in Olten gegründeten Schweizerischen Alpenklub (SAC) ernannt.

Tod von Zeichner Jacques Burkhardt
Jacques (Jakob) Burkhardt, bekannt als ständiger Begleiter von Louis Agassiz, starb im Januar 1867 in der Nähe von Cambridge bei Boston auf dem Landgut von Pauline
Agassiz Shaw, der Tochter von Louis Agassiz. Burkhardt von Sumiswald wurde am 18. November 1808 in Hasle bei Burgdorf getauft, wo sich sein gleichnamiger Vater (die Mutter hiess Anna Barbara,
geborene Lanz) als Gastwirt niedergelassen hatte. Da Letzterer in der Folgezeit einen Gasthof in Neuchâtel übernahm, besuchte Jacques mit seinen Geschwistern die dortigen Schulen. Er entwickelte
sein künstlerisches Talent im Zeichnungsunterricht bei Fräulein de Lapierre und Maximilian de Meuron. Mit 17 Jahren ging er nach München, wo er mit Louis Agassiz kennenlernte. In Rom
studierte er in Verbindung mit Leopold Robert und Aurele Robert Kunst, vorzugsweise Landschaftmalerei. Nach Neuchâtel zurückgekehrt, nahm er als Zeichner von Agassiz an Gletscherexkursionen teil,
wo er ein Panorama des Unteraargletschers anfertigte. Er fertigte auch den Atlas zum berühmten Werk, «Les poissons fossils». Als Agassiz nach Boston übersiedelte, folgte ihm Burkhardt als sein
Zeichner nach. Dort begleitete er Agassiz auf mehreren Reisen, unter anderem nach Brasilien.[106]
Frank Stephan Kohl: «Burkhardt hatte während der 5 ½-monatigen Expedition auf dem Amazonas mehr als 800 aquarellierte Fischzeichnungen und mehrere
Landschaftsaufnahmen hergestellt. Während der Brasilienreise hatte er über 2.000 Aquarelle der gesammelten Fische angefertigt. Seine Zeichnungen sind auf der Webseite der Ernst Mayr Library of
the Museum of Comparative Zoology der Universität Harvard in Boston einzusehen.»[108] Burkhardt wurde während seinem Aufenthalt durch Fieber geschwächt
und starb daran.[106]
Louis Agassiz schrieb im Vorwort zur Reise nach Brasilien: «Mein langjähriger Freund und Begleiter, Herr Burkhardt, starb etwa zehn Monate nach seiner Rückkehr an
einer Krankheit, die er sich zwar nicht in Brasilien zugezogen hatte, da sie schon einige Jahre zurücklag, die aber zweifellos durch das heisse Klima verschlimmert worden war. Sein grosser
Wunsch, mich zu begleiten, veranlasste ihn, gegen meinen Rat eine Reise zu unternehmen, die in seinem Fall gefährlich war. Während unseres Aufenthaltes auf den Amazonen litt er sehr, aber ich
konnte ihn nicht überreden, seine Arbeit aufzugeben.»
Fische als Nahrungsmittel
Louis Agassiz hielt 1868 in Boston einen Vortrag über die Fischzucht in den Neuenglandstaaten. Er prophezeite, dass jeder, der über Wasser verfüge, Fische für den
Eigenbedarf züchten solle. Unter dem Gesichtspunkt der Gesundheit erklärte er die Steigerung der Fischproduktion für äusserst wichtig und bemerkte: «Fische enthalten eine beträchtliche Menge
Phosphor, ein chemisches Element, dessen das Gehirn bedarf, um gesund und kräftig zu bleiben».[85]
Spende für Schweizer Hochwasser-Opfer
1868 traten in der Schweiz innerhalb einer Woche zwei sehr starke Niederschlagsereignisse auf. Das erste vom 27. und 28. September betraf vor allem die Kantone Tessin, Graubünden und St. Gallen,
das zweite vom 1. bis 5. Oktober das Tessin, das Wallis und Uri. Die Niederschläge führten auf beidseits des Alpenkamms zu Überschwemmungen. Zahlreiche Flüsse traten über die Ufer. Das Rheintal
und die Magadinoebene standen unter Wasser. Die Schäden des Ereignisses waren enorm. Insgesamt starben 51 Menschen. Zahlreiche Brücken wurden weggeschwemmt, Teile des Dorfes Vals bis zu einem
Meter hoch mit Geschiebe bedeckt. Umfangreiche Spenden, auch aus dem Ausland, ermöglichten den Gemeinden den Wiederaufbau.[87] Im April 1869 überreichte der
nordamerikanische Ministerpräsident als Ergebnis einer von Louis Agassiz in Verbindung mit amerikanischen Bürgern in Boston und Umgebung veranstalteten Sammlung, den Betrag von Fr. 5900.- zu
Gunsten der schweizerischen Wassergeschädigten.
Reformer der Staatsschulen
Louis Agassiz waren die konfessionslosen Staatsschulen, die von Jungen und
Mädchen gemeinsam besucht wurden, ein Dorn im Auge. Er beschloss 1871 diesem «sozialen Übel» durch Forschungen entgegenzuwirken. In Boston und New York untersuchte er mehrere dieser Schulen,
befragte die Jugendlichen und hielt alles in sein Notizbuch fest. Er kam dann zu dem vernichtenden Urteil, dass diese Schulen unmoralisch seien und insbesondere das freche Verhalten der Jungen
gegenüber den Mädchen unterbunden werden müsste. Die «Baltimorer Katholische Volkszeitung» schrieb am 16. Dezember 1871 «dass man diese Bengel aus der Schule jagen müsse» und gab Agassiz Recht,
wenn er die Staatsschulen eine Schande nannte. Der «New York Herald» vom 20. Oktober 1871 berichtete Agassiz‘ dramatisches Urteil: «Indem er den Abgrund der moralischen Verkommenheit untersuchte,
in den viele Menschen gesunken sind, gelangte er dazu, an der gerühmten Zivilisation des 19. Jahrhunderts zu verzweifeln. Die Schulen Bostons bedürfen daher eine gründlichen Reform.» Unter dem
Druck der öffentlichen Empörung stellte Agassiz schliesslich seine Nachforschungen ein. Zur Freude der Eltern erreichte er jedoch, dass die Schüler/innen der Staatsschulen besser beaufsichtigt
wurden.
Abenteuerliche Reisen
Louis Agassiz unternahm auf Kosten des Kaufmannes Nathaniel Thayer zwei grosse und kostspielige Reisen. Die erste (1865) führte nach Brasilien zur Erforschung des Amazonas. Agassiz wurde auf
dieser Expedition von den folgenden Assistenten des Museums für vergleichende Zoologie begleitet: Jakob Burkhardt (Maler), John G. Anthony (Muschelforscher), Frederick C. Hartt und Orestes St.
John (Geologen), John A. Allen (Ornithologe), George Sceva (Präparator). Dazu kamen die Volontäre Newton Dexter, William James, Edward Copeland, Thomas Ward, Walter Hunnewell und S. V. R. Thayer.
Ferner Elisabeth Cary Agassiz, Dr. Cotting, Direktor vom Lowel Institut Boston und seine Frau. Auf der Reise von Para nach Manaos konnten bereits 300 Fischarten gesammelt werden. Ende November
1865 besass Agassiz schon 1143 Arten, mehr als man zu Beginn des Jahrhunderts in der ganzen Welt bekannt waren. Insgesamt betrug die Ausbeute an Fischen allein im Amazonasbecken über
1800.
Elizabeth Agassiz schrieb mit Louis zusammen ein Reisetagebuch mit dem Titel: «A journey in Brazil by Professor and Mrs. Louis Agassiz. London 1868.» Das Buch
erlebte in kurzer Zeit sechs Auflagen und wurde 1869 ins Französische übersetzt. Nach seiner Rückkehr aus Brasilien hielt er zwei grosse Vorträge in Philadelphia und schilderte «die wilden
Völkerschaften», die er auf seiner Reise kennengelernt hatte. In New York bildete sich bereits eine Gesellschaft, welche Fahrten für Touristen zum Amazonas organisierte. Seine populären Auftritte
wurden in New York mit 5 Dollar pro Minute gut bezahlt.
Die zweite Reise (1871), für die die Regierung den Kriegsdampfer «Hassler» zur Verfügung stellte, diente hydrographischen Interessen, insbesondere Tiefenmessungen.
Sie führte von Boston durch den Atlantischen und Pazifischen Ozean und endete 1872 in San Francisco beendet wurde. Während dieser Zeit verbrachte die Expedition zehn Tage auf den Galapagos-Inseln
und einen Monat in Panama, wo das Schiff repariert werden musste.[6]
Gründung vom Agassiz-Institut
In Sacramento, der Hauptstadt Kaliforniens, war die Ankunft von Louis Agassiz der Anlass für die Gründung einer naturkundlichen Gesellschaft mit dem Namen «Agassiz-Institut».
Sommerschule für Naturgeschichte
In seinem letzten Lebensjahr erhielt Louis Agassiz von dem reichen Bostoner Tabakhändler John Anderson 50‘000 Dollar und die Insel «Penikese Island» in der Bucht von Massachusetts zur Verfügung
gestellt, um dort eine «Sommerschule für Naturgeschichte» einzurichten. Sie wurde am 8. Juli 1873 mit einem neuen Lehrsystem eröffnet. Die Schule, die sowohl Frauen wie Herren besuchen konnten,
löste am Kongress für Sozialwissenschaften in Boston eine Debatte über die Zulassung von Frauen an Universitäten aus. Agassiz erklärte, dass er für die Zulassung von Frauen sei, weshalb er sein
naturwissenschaftliches Museum (unabhängig von der Harward-Universität) für beide Geschlechter öffnete, ebenso wie den Besuch der neu gegründeten Anderson-Schule. [10] Später übernahm sein
Sohn Alexander Agassiz die Leitung, hatte aber nicht den gleichen Erfolg, so dass die Schule bereits 1876 wieder geschlossen wurde.
Der Hör- und Speisesaal der Anderson-Schule, unter der Leitung von Louis Agassiz. Er befand sich in einem alten Stallgebäude. Während die Studierenden assen,
waren um sie herum Tier- und Menschenpräparate ausgestellt. Nicht sehr einladend, aber informativ.
Reproduktion aus Frank Leslie’s Illustriere Zeitung, New York, 24. 8. 1873 S. 92.
Die «Summer School of Science in Penikese» war Schauplatz des religiösen Gedichtes «The Prayer of Agassiz» von John
G. Whittier.[90]
«The Prayer of Agassiz»
On the isle of Penikese,
Ringed about by sapphire seas.
Fanned by breezes salt and cool,
Stood the Master with his school.
Over sails that not in vain,
Wooed the west wind’s steady strain,
Line of coast that low and far
Stretched its undulating bar,
Wings aslant along the rim
Of the waves they stooped to skim,
Rock and isle and glistening bay,
Feel the beautiful white day.
Said the Master to the youth:
«We have come in search of truth,
Trying with uncertain key
Door by door of mystery;
We are reaching, through His laws,
To the garment-hem of Cause,
Him, the endless, unbegun,
The Unnamable, the One,
Light of all our light the Source,
Life of life, and Force of force.
As with fingers of the blind
We are groping here to find.
What the hieroglyphics mean
Of the Unseen in the seen,
What the Thought which underlies
Nature's masking and disguise,
What it is that hides beneath
Blight and bloom and birth and death,
By past efforts unavailing,
Doubt and error, loss and failing,
Of our weakness made aware,
On the threshold of our task
Let us light and guidance ask,
Let us pause in silent prayer!»
Then the Master in his place
Bowed his head a little space,
And the leaves by soft airs stirred,
Lapse of wave and cry of bird
Left the solemn hush unbroken
Of that wordless prayer unspoken,
While its wish, on earth unsaid
Rose to heaven interpreted.
As, in life's best hours, we hear
By the spirit's finer ear
His low voice within us, thus
The All-Father heareth us;
And his holy ear we pain
With our noisy words and vain.
Not for Him our violence
Storming at the gates of sense,
His the primal language, his
The eternal silences!
Even the careless heart was moved,
And the doubting gave assent,
With a gesture reverent,
To the Master well-beloved,
As thin mists are glorified
By the light they cannot hide,
All who gazed upon him saw,
Through its veil of tender awe,
How his face was still uplit
By the old sweet look of it,
Hopeful, trustful, full of cheer,
And the love that casts out fear.
Who the secret may declare
Of that brief, unuttered prayer?
Did the shade before him come
Of th' inevitable doom,
Of the end of earth so near,
And Eternity's new year?
In the lap of sheltering seas
Rests the isle of Penikese;
But the lord of the domain
Comes not to his own again;
Where the eyes that follow fail,
On a vaster sea his sail
Drifts beyond our beck and hail;
Other lips within its bound
Shall the laws of life expound;
Other eyes from rock and shell
Read the world's old riddles well;
But when breezes light and bland
Blow from Summer's blossomed land,
When the air is glad with wings
And the blithe song-sparrow sings,
Many an eye with his still face
Shall the living ones displace,
Many an ear the word shall seek
He alone could fitly speak.
And one name for evermore
Shall be uttered o'er and o'er
By the waves that kiss the shore,
By the curlew's whistle sent
Down the cool, sea-scented air;
In all voices known to her
Nature own her worshiper,
Half in triumph, half lament.
Thither Love shall tearful turn,
Friendship pause uncovered there,
And the wisest reverence learn
From the Master's silent prayer.
Tod von Louis Agassiz
Am 2. Dezember 1873 trat Agassiz zum letzten Mal öffentlichen auf. Es war eine Rede vor dem Massachusetts State Board of Agriculture in Fitchburgh. Während er im Museum für vergleichende Zoologie
arbeitete, erlitt er am 6. Dezember einen Schwächeanfall und musste sich in sein Haus in Cambridge zurückziehen. Dort starb er am Sonntagabend, dem 14. Dezember 1873. Die schlichte Beerdigung
fand am 18. Dezember ohne Zeremonie in der Appleton Chapel der Harvard Universität statt. Die Kirche war mit Blumensträussen und Girlanden geschmückt. Vor der Kanzel stand ein grosses Kreuz aus
Rosenknospen, weissen Blumen und Efeublättern. Während der Trauerfeier wurden die Flaggen Bostons auf halbmast gesetzt und die Glocken geläutet. Eine Trauerrede wurde nicht gehalten, aber die
Stimme des amtierenden Geistlichen, S. P. Peabody, durchbrach die Stille mit den Worten: «Ich bin die Auferstehung und das Leben». Unter den Klängen des «Totenmarsches in Saul» verliessen die
Familie und einige enge Freunde zusammen mit der Universitätsleitung die Kapelle in Richtung Mount Auburn Friedhof. Man begrub ihn dort neben seinem Freund Cornelius Conway Felton (1807-1862) auf
dem Grundstück 2640, Bellwort Path.[109] Felton war der 20. Präsident von Harvard und ein Schwager von Louis Agassiz.
Sein letzter Wille
Louis Agassiz besass alle Ehrungen, die Universitäten und Gelehrtengesellschaften zu
vergeben hatten, machte aber keinen Gebrauch davon. Auf den Titelblättern seiner Werke signierte er nur mit «Louis Agassiz». In seinem Testament bezeichnete er sich selbst als «Louis Agassiz,
Lehrer». Er trug den Titel eines Lehrers mit Stolz und zog ihn dem eines Professors vor. Er betrachtete den Beruf des Lehrers als den edelsten aller Berufe, schloss aber alle ein, die sich mit
der Verbreitung oder Vermehrung von Wissen befassten. Sein letzter Wille lautete:[88]
«Der letzte Wille und das Testament von Louis Agassiz, aus Cambridge, in der Grafschaft Middlesex und dem Commonwealth von Massachusetts, Lehrer:
Erstens. - Ich vermache meinem Sohn, Alexander E. R. Agassiz, alle meine wissenschaftlichen Bücher, die er aus meiner Bibliothek auswählt, in der Hoffnung, dass er
sie, wenn er keine weitere Verwendung für sie hat, dem Rest meiner Bibliothek wissenschaftlicher Bücher hinzufügt, die ich hiermit dem Museum für vergleichende Zoologie in Cambridge
vermache.
Zweitens. - Ich vermache und übertrage den gesamten Rest meines Vermögens, das ich jetzt besitze und in Zukunft erwerben werde, meiner geliebten Frau Elizabeth C.
Agassiz, um es ihr, ihren Erben und Bevollmächtigten für immer zu überlassen. Ich treffe keine Vorkehrungen für meine beiden Töchter Ida und Pauline, nicht aus mangelnder Zuneigung, sondern aus
dem Grund, dass mein Haus in Cambridge (das mit einer Hypothek belastet ist) das einzige verbleibende Stück Eigentum ist, über das ich zu verfügen habe. Ich ernenne meine Frau zur alleinigen
Testamentsvollstreckerin und bestimme, dass sie von der Bürgschaft für ihre Kaution befreit ist.
Zu Urkund dessen setze ich meine Hand an diesem 29. November im Jahre unseres Herrn 1869.»
L. Agassiz [88]

Sein Wunsch um Bestattung in seinen geliebten Berner Alpen ging nicht in Erfüllung. Dafür bedeckt ein Schweizer Felsblock aus massivem Granit, sein Grab. Er stammt
vom Unteraargletscher nicht weit von der Stelle, an der einst das «Hôtel Neuchâtelois» stand. Am 22. November 1874 wurde er vom Bahnhof Interlaken nach Neuchâtel transportiert. Am April 1875 traf
er in Cambridge ein und im Friedhof von Mount Auburn aufgestellt. Die daneben gepflanzten Tannenbäume stammten aus Neuchâtel. Die Grabstelle vereint sein Heimatland mit seinem Adoptivland. Auf
dem Findling steht:
Auf einer Seite eingraviert: JEAN LOUIS RODOLPHE AGASSIZ.
Auf der anderen Seite: GEBOREN IN MOTIER, SCHWEIZ, 28. MAI 1807. GESTORBEN IN CAMBRIDGE, MASS., 14. DEZEMBER 1873.
Und am Rand: Felsbrocken vom Aargletscher (Boulder from the Aar Glacier).[96]
Grab von Louis Agassiz und seiner Frau auf dem Friedhof von Mount Auburn.
Foto: AEN, Louis Agassiz, 4.6
Eine umfangreiche Lebensbeschreibung von Louis Agassiz wurde 1885 von seiner Witwe in Boston veröffentlicht. Das zweibändige Werk «Agassiz his life and
Correspondence edited by Elis. C. Agassiz» bezeichneten amerikanischen Zeitschriften als sehr gelungen. Es gliedert sich in zwei Teile, von denen der erste mit Agassiz' Jugend und Entwicklung in
der Schweiz und der zweite mit Agassiz' Aufenthalt in Amerika behandelt. Zwischen 1845 bis 1893 erschienen etwa zwanzig formelle Biographien von Louis Agassiz und etwa dreissig kleinere Berichte
über sein Leben und seine Werke im gleichen Zeitraum, sowie unzählige Artikel für Enzyklopädien und Zeitungen.[121]
1896 publizierte Jules Marcou (1824-1898) zwei Bände einer Louis Agassiz-Biographie. Der Autor war ein ehemaliger Professor für Geologie und Paläontologie der ETH
Zürich. Bekannt wurden seine «Lettres sur les roches du Jura et leur distribution géographique dans les deux hémisphères» (1857). Marcou unterstützte Louis Agassiz bei der Gründung des
Naturhistorischen Museums in Cambridge, dessen paläontologische Abteilung er von 1860 bis 1864 leitete.[120] Trotz der «endgültigen» Biographie, die
Elizabeth Cary Agassiz veröffentlicht hatte, war Marcou überzeugt, dass «die wahre Geschichte von Agassiz noch nicht geschrieben worden war». Zu diesem Zweck sammelte er jahrelang Material. Der
Biograph beschreibt ihn als eine beliebte und sympathische Persönlichkeit.[121] 1917 erschien in Amerika ein Buch von Lane Cooper mit dem Titel «Louis
Agassiz as a teacher». 1928 wurde in der «Hall of Fame» für berühmte Amerikaner an der New Yorker Universität eine Agassiz-Büste enthüllt.[4]
Die unbegreifliche Seite von Louis Agassiz
Louis Agassiz und das Linnésche Dogma
Seit dem Erscheinen von «Die Entstehung der Arten» im Jahr 1859 profilierte sich Louis Agassiz als einer der grössten Gegner Darwins. Er sagte über den Darwinismus
in seinem 1859 erschienenen Essay on Classification: «I shall consider the transmutations-theory as an unscientific mistake untrue in its facts, unscientific in its method and mischievous in its
tendency.» Agassiz war ein strikter Gegner des Evolutionismus, obwohl er dazu beigetragen hatte, die fortschreitende Entwicklung des Lebens und die Abfolge der Arten aufzuzeigen. In Agassiz'
Erkenntnistheorie waren diese Abstammungen jedoch nicht genetisch, sondern ideell: Sie folgten einem göttlichen Plan der aufeinanderfolgenden Schöpfungen, der seit dem Ursprung der Welt duch
einen göttlichen Konstrukteur festgelegt wurde (erinnert an die Kinoserie «Matrix»).
Agassiz glaubte das der Ursprung der Menschenrasse folgendermassen stattgefunden hat: Das Menschengeschlecht, das viel älter ist als die Geschichte von Adam und Eva, entstand unabhängig
voneinander an 8 verschiedenen Punkten der Welt, die sich durch Fauna und Flora unterschieden. Es beruht auf den Plan eines göttlichen Konstrukteurs. Seiner organischen Art nach Jahrtausenden
überflüssig geworden, vernichtete dieser Konstrukteur das Leben auf der Erde mehrmals durch eine Revolution der Natur in Form von Katastrophen. Um nicht die Mühe der ganzen Schöpfungsarbeit von
vorne anzufangen, behielt er immer seinen ursprünglichen Plan bei und schuf neue Arten. Nach dem Untergang wurde jede Spezies auf einmal und in einer grösseren Anzahl von Individuen geschaffen.
Agassiz vertrat also nicht die Meinung wie der Grossteil der Gelehrten, dass sich jede Spezies vom sogenannten Schöpfungs-Mittelpunkt aus im Lauf der Zeit weiter verbreitet und entwickelt
hat.[19]
Die verschiedenen Gruppenstufen entsprechen den verschiedenen Stufen der Ausbildung, welche der Schöpfungsplan erlang hatte. Die Hautfarbe des Menschen stimmt mit der Tierwelt seiner Umgebung
überein. Sie gleicht laut Agassiz in Afrika den schwarzen Menschenaffen, in Malaysia dem braunen Orang-Utan usw. Beim Entwurf und bei der Ausführung dieses Plans vertiefte sich der Konstrukteur
jedesmal in mehr Details. Er verfuhr beim hervorbringen der organischen Formen wie ein menschlicher Baukünstler, der sich die Aufgabe gestellt hat, möglichst viel verschiedene Bauwerke
auszudenken und auszuführen. Dabei bewegte er sich nur innerhalb sechs Kategorien: der Art, Gattung, Familie, Ordnung, Klasse und Typen. Nachdem der Konstrukteur Millionen von Jahrtausenden
hindurch sich mit dem Aufbauen und Zerstören einer Reihe verschiedener Schöpfungen unterhalten hatte, kommt er zuletzt auf den Gedanken, sich seinesgleichen zu erschaffen, und er formt den Mensch
nach seinem Ebenbild. Damit wird das Endziel der Schöpfungs-Geschichte erreicht.[19] Theologen schüttelten schon damals darüber den Kopf, den «was soll
man von einem Schöpfer halten, der sein eigenes Werk wieder flickt?».

Louis Agassiz als Rassist im Land der Sklavenhändler
Als Louis Agassiz in den Vereinigten Staaten weilte, florierte der Sklavenhandel, obwohl man politisch bereits etwas dagegen unternommen hatte. Die ersten internationalen Akte gegen den
Sklavenhandel der europäischen Mächte waren ein Zusatz-Artikel des Pariser Friedens, sanktioniert am Wiener Kongress am 4. Februar 1815. In Nordamerika wurde 1831 der Sklavenhandel verboten, was
nicht verhinderte, dass in den nächsten zehn Jahre 300‘000 Sklaven nach Brasilien eingeführt wurden. 1841 landeten 47 Schiffe gefüllt mit Sklaven in dem Häfen des Kaiserreichs. Bostons
Fabrikanten beteiligten sich an dem einträglichen Geschäft des Sklavenhandels. 1851 erklärten die brasilianischen Kammern, dass der Sklavenhandel der Piraterie gleichgeachtet werden solle.
Dennoch wurde der Sklavenhandel weltweit weiter gefördert.

Sklaverei-Gegner Edouard Desor
Edouard Desor, ehemaliger Gehilfe von Louis Agassiz, mit dem er sich zerstritt, kehrte 1852 in die Schweiz zurück. In seinem Werk «L’esclavage aux Etats-Unis à
l’occasion de la case de l’oncle Tom» schreibt Desor: «Tausende Auswanderer schifften sich in die Häfen ein, um angeblich in Amerika eine Freiheit zu suchen, die ihnen Europa nicht bot. Kaum
gingen sie in Baltimore, New Orleans oder New York an Land, waren viele von ihnen bereit, gegen die Schwarzen Partei zu ergreifen. Politische Führer konnten immer mit der Stimme und Unterstützung
anderer rechnen, wenn es um Massnahmen zugunsten der Sklaverei geht. Das galt auch für einen grossen Teil der deutschen und schweizerischen Auswanderer. Leider fielen die Gebildeten nur allzu oft
in die gleichen Verirrungen. Wir kämen nicht zum Ende, wenn wir alle europäischen Journalisten, Gelehrten und Professoren aufzählen wollten, die sich in Amerika für die Sklaverei stark gemacht
hatten. Wie kann man es gut finden, dass ein Mensch wie ein Stück Ware verkauft wird, dass ein Kind seiner Mutter entrissen wird, dass eine Frau von ihrem Mann getrennt wird, um sie einem anderen
zuzuführen? Man müsste ein Monster sein, um solche Schandtaten zu billigen oder gar zu entschuldigen! So wie die Freiheit das grösste aller Güter ist, so ist die Sklaverei das schlimmste aller
Übel.
Die Arbeit der Schwarzen wurde stets produktiver und eröffnete neue Absatzmärkte in den Südstaaten. Die Plantagenbesitzer wurden immer reicher. Hatte man die Sklaverei zuerst nur
entschuldigt, galt sie nun als gerechtfertigt. Es fehlte nicht an Publizisten und Rednern, die bewiesen, dass die Sklaverei keineswegs ein Übel, sondern ein Element des Fortschritts und eine
Voraussetzung für die Grösse der Vereinigten Staaten ist. Ausserdem gab eine Lehre, die anhand physiologischer Beobachtungen beweisen wollte, dass die Schwarzen nach dem Plan der Schöpfung dazu
bestimmt sind, für immer die Sklaven der Weissen zu sein. Diejenigen, die die Sklaverei nicht direkt rechtfertigen, aber versuchen, sie zu entschuldigen oder ihre Folgen zu mildern, gelang es,
sich nicht nur bei denen Gehör zu verschaffen, die ein Interesse an der Aufrechterhaltung des bestehenden Zustandes hatten, sondern sogar bei denen, die in dieser Frage angeblich völlig
uninteressiert waren. Eines der Hauptargumente, mit denen man die Sklaverei entschuldigte, war, dass es im Interesse der Sklavenhalter liegt, ihre Sklaven gut zu behandeln, so wie es bei uns für
einen Bauern von Vorteil ist, sein Vieh gut zu behandeln. Dies, so sagt man uns, ist eine wirksamere Garantie für die Sklaven, als es ein Gesetz je sein könnte. Wir wissen aber, dass es in New
Orleans eine Anstalt (flogging establishment) gab, die ‹Calabouse›, in der täglich bestraft wurde.
Neben der Kaufmannsbevölkerung der Städte gab es auch die Landbevölkerung, die durch die Gier nach Gewinn nicht korrumpiert war. Es bildeten sich Gesellschaften mit dem Ziel, mit allen Mitteln
auf die Abschaffung der Sklaverei hinzuarbeiten. Diese Gesellschaften, die bald unter dem Namen Abolitionisten bekannt wurden, führten einen unaufhörlichen Kampf gegen das System der Sklaverei.
Die Quäker hatten daran einen grossen Anteil. Als praktische Menschen verurteilten sie die Sklaverei nicht nur in ihren Reden, sondern beschlossen auch, dass sie keine Produkte verwenden würden,
die durch die Arbeit von Sklaven gewonnen wurden. So trugen sie keine Baumwolle, rauchten nicht etc. Die Abolitionisten wurden von allen Seiten als gefährliche Aufhetzer geächtet und verfolgt.
Sie gaben zahlreiche Zeitungen heraus und hatten ausserdem eine ganze Kohorte von Agenten in ihren Diensten, die in allen Richtungen durch die Freistaaten reisten und überall und immer die
Abschaffung predigten. In praktischer Hinsicht bestand ihr Hauptgeschäft darin, entflohenen Sklaven zu Hilfe zu kommen, ihre Flucht durch die Nordstaaten zu fördern und ihnen, sobald sie in
Kanada in Sicherheit waren, die Mittel zu verschaffen, um sich eine Existenz aufzubauen. Zu diesem Zweck hatten sie mehrere Siedlungen an der amerikanischen Grenze Kanadas gegründet, wo alle,
denen die Flucht gelang, unter dem Schutz der britischen Flagge Zuflucht fanden. Der heimliche Transport von Sklaven erfolgte (bis 1862) über die von den Plantagenbesitzern des Südens
ironisch als ‹Underground-Road bezeichneter Strecke.
Anlässlich der Aufnahme Kaliforniens in den Bund tauchte die Frage der Sklaverei 1850 erneut im Kongress auf. Die sklavenhaltenden Südstaaten, die bis dahin das politische Zepter in der Hand
gehalten hatten, sahen plötzlich ihre Vorherrschaft gefährdet. Im Kongress diskutierte man nur noch eine Sache: die Sklaverei. Nach endlosen Debatten wurde beschlossen, Kalifornien selbst die
Entscheidung zu überlassen, ob es als freier Staat oder als Sklavenstaat in die Konföderation aufgenommen werden sollte. Die Freiheit siegte bei der Abstimmung. Leider musste dieser Sieg mit
unangenehmen Zugeständnissen erkauft werden. Um den Zorn der Südstaaten zu besänftigen stimmte der Kongress für einen Kompromiss (bekannt als ‹compromise measures›), der unter anderem die Gesetze
über die Auslieferung von Sklaven verschärfen sollte, indem er alle Bürger der Freien Staaten, die in irgendeiner Weise die Flucht eines Sklaven unterstützt oder erleichtert hatten, mit Geld- und
Gefängnisstrafen belegte. Es ist unmöglich, sich die Situation vorzustellen, die dieses Gesetz in den Nordstaaten hervorrief. Die beiden grossen Prinzipien, auf denen die amerikanische
Gesellschaft beruht, nämlich die Achtung vor dem Gesetz und die Unterwerfung unter das Evangelium, standen zum ersten Mal im Widerspruch zueinander. Welchem der beiden Gesetze sollte man
gehorchen, dem hohen oder dem niedrigen Gesetz, der Bibel oder dem Kongress? Man kann sich die Verwirrung und die Konflikte vorstellen, die daraus entstehen mussten, wenn man bedenkt, dass grosse
materielle Interessen auf dem Spiel standen. Die Spaltung war überall, im Staat, in der Gemeinde, in der Pfarrei und sogar in der Familie. Die Abolitionisten verdoppelten ihre Aktivität, als sie
sahen, dass die Rechte der Menschheit durch das Gesetz des Kompromisses erneut verletzt wurden.
Wenn ein Buch nur ein paar Anspielungen auf das Thema Sklaverei enthielt, wurde es aus vielen Salons ausgeschlossen, selbst in den Städten des Nordens. Die amerikanischen Frauen, mutiger als die
Männer, richteten sich nach ihrem Herz und stellten sich auf die Seite der Unterdrückten. Von den Frauen, die sich in der amerikanischen Literatur einen Namen gemacht haben, und das sind nicht
wenige, sind die meisten Abolitionistinnen, während wir keine kennen, die für die Sklaverei Partei ergriffen hätte. Die Sklaverei hat ihre grössten Gegner unter den gebildeten Frauen gefunden
(Harriet Beecher Stowe mit ‹Onkel Toms Hütte›, 1852). Weil eine Frau den Mut hatte, ihr Talent in den Dienst dieses grossen Unglücks zu stellen, und weil sie sich für die Sache so vieler
Unglücklicher einsetzte und dieser gottlosen Einrichtung einen tödlichen Schlag versetzte, applaudieren die ehrlichen Herzen in allen Ländern und Sprachen.» [81]
Agassiz als Förderer der Apartheit
Louis Agassiz, der sich mit Polygenismus beschäftigte, trat zum Zweck der weissen Vorherrschaft für eine strikte Rassentrennung ein: «the races of mankind had been
separately created as distinct and unequal species». 1850 setzte er diese Meinung in einer pseudo-wissenschaftlichen Studie mit Fotografien von afrikanischen und afrikanisch-amerikanischen
Sklaven um, darunter waren der aus dem Kongo stammende «Papa Rentry» und seine in Amerika geborene Tochter Delia, die auf Baumwollfeldern arbeiten mussten. Diese «Studien» geschahen auf einer
grossen Sklavenplantage in Charleston, Süd-Carolina. Agassiz bemerkt in einem seiner Vorträge: «Ich habe über 100 spezifische Unterschiede zwischen dem Knochen- und Nervensystem des Schwarzen und
des Weissen nachgewiesen. Die ganze physische Organisation des Schwarzen unterscheidet sich in gerade eben solchem Mass von der des Weissen, wie sie von der des Schimpansen absticht. Der Schwarze
ist ebenso wenig der Bruder des Weissen, wie die Eule die Schwester des Adlers.»[21]
Eine weitere, überflüssige fotografische Rassen-Studie, erfolgte 1865 bis 1866 während seiner Reise in Brasilien. Geschichtslehrerin Maria Helena Machado: «Agassiz gründete ein umstrittenes anthropologisches Büro in Manaus, der Hauptstadt der Provinz Amazonas. Das Büro diente dem Zweck, die Unterschiede zwischen ‹reinen› und ‹gemischten› Rassen zu dokumentieren. Um die Zusammensetzung der brasilianischen Bevölkerung zu veranschaulichen, bat Agassiz zunächst Augusto Stahl (1828-1877), einen in Rio de Janeiro ansässigen Berufsfotografen, Fotos von Afrikanern in der Stadt zusammenzustellen, die Agassiz als ‹reine Rassentypen› einstufte. Das Ergebnis waren zwei Gruppen von Fotografien: Porträts und wissenschaftlich orientierte physiognomische Studien afrikanischer Ethnien, aber auch Fotos von einigen in Rio de Janeiro lebenden Chinesen. Eine dritte Fotoserie entstand in einem provisorischen Studio in Manaus, für das einer der studentischen Teilnehmer der Thayer-Expedition, Walter Hunnewell (1844-1921), als Fotograf fungierte. Diese Serie dokumentierte ‹gemischte› oder ‹hybride› amazonische ‹Rassentypen›.» [100] Die Fotos gingen in den Besitz des Peabody Museum of Archaeologe and Ethnology der Universität Harvard.
Der Wissenschaftler Samuel George Morton (1799-1851), mit dem Agassiz in engem Kontakt stand, besass eine riesige Sammlung menschlichen Schädeln, darunter die von
600 Indianern, die das frühere Amerika bewohnten. Er erstellte eine Reihe von Tabellen, in denen das durchschnittliche Volumen von Schädeln nach Rassen geordnet verglichen wurde. «Weisse wie
Teutonen und Angelsachsen über alles, Indianer in der Mitte und Schwarze ganz unten».[26] Er teilte die Meinung von Agassiz, dass die höheren Rassen
dazu bestimmt seien, die niederen zu verdrängen, «weil sie mit höheren Instineten ausgestattet seien».[22] Morton statuierte in seinem Werk «Crania
Americana» (1839) 32 Familien, die aus mehreren nicht mehr deutlich erkennbaren Urspezies des Menschengeschlechts hervorgegangen seien. In diesem Werk erwähnte er, dass die Weissen den grössten
Schädel haben, und die Schwarzen den kleinsten. Agassiz fügte dem hinzu, dass die Menschen nationenweise geschaffen worden seien. Als Morton starb urteilte das Charleston Medical Journal,
dass «wir im Süden ihn als unseren Wohltäter betrachten sollten, weil er wesentlich dazu beigetragen hat, dem Schwarzen
seine wahre Stellung als minderwertige Rasse zu geben.» Nach Mortons Tod schrieben dessen Gehilfen Josiah Nott (1804-1873) und Glidden mit Agassiz das Buch «Types of Mankind». Es erschien
1858.
Durch «Autoritäten» wie Agassiz und Morton verblendet, wurde der Sklavenhandel mit der Meinung gefördert, das Schwarze nicht Menschen von derselben Art wie wir seien, sondern eine Art
Tierspezies, über welche die Weissen verfügen können, wie über ein Hund oder ein Pferd.
Agassiz' Ansichten wurden in Nordamerika mit der Sklaven-Frage in Verbindung gebracht. Es entstand die Meinung, er wolle politisch, durch Verteidigung der Mehrheit des Ursprungs der
Menschen-Rassen, die Sklaverei entschuldigen oder rechtfertigen. Dabei soll es ihm bei seinen Forschungen nur um den naturhistorischen theoretischen Zweck gegangen sein. Agassiz war strikte
dagegen, dass man «die Eigentümlichkeiten unserer weissen Zivilisation allen Nationen der Welt aufzwingen will.» und damit gegen die Sklaverei.[23]
Allerdings gab er diese Meinung nicht aus humanitären Gründen. Agassiz schrieb in einem Brief an Dr. Howe, von 9. 8. 1863: «Eine gesunde Politik sollte eine Kreuzung der Rassen und der Vermehrung
einer Bevölkerung gemischter Abkunft jedweges Hindernis entgegenstellen.» und tags darauf: «Wir sollten uns hüten, den Schwarzen Rechte zu verleihen, durch deren Genuss die Ausbreitung der
Weissen gefährdet werden könnte. Soziale Gleichheit halte ich zu allen Zeiten für unausführbar.» [8]
In der Öffentlichkeit verlor Louis Agassiz nicht viele Worte über die Sklaverei. Untypisch für einen Gelehrter, der wusste, dass die Sklavenfrage für Amerika eine Angelegenheit von grosser
politischer und sozialer Wichtigkeit war. Der Grund für sein Schweigen war unter anderem, dass sich Boston als Industriestadt stark am Sklavenhandel beteiligte. Zudem hatte Agassiz auch Freunde,
welche selbst Sklaven hielten.
Naturforscher Carl Vogt und ehemaliger Gehilfe von Louis Agassiz berichtete 1856: «Nichts konnte uns mehr empören, als dass Agassiz mit wissenschaftlichen Resultaten, die Tyrannei der
Sklavenbesitzer zu unterstützen suchte.» Einen Rückgang der Sklaverei stellte Agassiz fest mit der Äusserung: «Die Einführung landwirtschaftlicher Maschinen auf einer gewissen Anzahl von
Plantagen hatte dazu beigetragen, die Sklavenarbeit weniger notwendig zu machen.»
Agassiz empfahl 1863 den Unionsbehörden, die befreiten Sklaven in bestimmten Gebieten der Südstaaten zu konzentrieren, um die seiner Meinung nach negativen Folgen der gegenseitigen Ansteckung der
schwarzen und weissen Rassen zu vermeiden. Neben der offiziell proklamierten Gleichheit war diese Empfehlung ein Vorgeschmack auf die faktische Rassentrennung, die sich nach dem Bürgerkrieg
allmählich durchsetzte. In Harvard prägte Louis Agassiz eine ganze Generation von Studenten. Zu seinen Schülern gehörte auch der Geologe Nathaniel Shaler, der die Minderwertigkeit der
Schwarzen und die Überlegenheit der «angelsächsischen Rasse» predigte. Durch seine ganzen Studien und Aussagen über die Menschenrasse wurde Louis Agassiz zum Förderer der Apartheit.
«From a great man of science, he becomes the Swiss of Slavery.»
Theodore Parker, Theologe [24]
Ein weiterer berüchtigter Rassenforscher war Graf Arthur Gobineau (1816-1882), von 1831 bis 1833 ebenfalls Schüler am Gymnasium Biel. Gobineau hatte wie Agassiz auf
die Ungleichheit der menschlichen Rassen hinwies und insbesondere die Rolle gewürdigt, welche die germanische Rasse in der Geschichte spielte. Obwohl Franzose, wurde Gobineau doch als Wahlgermane
wahrgenommen. 1853 bis 1855 veröffentlichte er sein Buch «Versuch über die Ungleichheit der menschlichen Rassen» und begründete damit mit Agassiz die moderne Rassentheorie. 1853 wurde der von
Agassiz und Gobineau geförderten Rassentypus durch Moritz Wagner in Deutschland weiterverbreitet. Agassiz hielt sich 1865 und Gobineau von 1868 bis 1870 in Brasilien auf. Beide publizierten ihre
Erfahrungen über ihren Aufenthalt. Für Agassiz galt die Rassenmischung als Hauptproblem Brasiliens. Im Buch «Reise nach Brasilien» hält er fest: «Wer den verderblichen Einfluss der
Rasenmischung bezweifelt und in falscher Philanthropie geneigt ist, alle Schranken zwischen ihnen niederzureissen, sollte nach Brasilien gehen. Er wird dann unmöglich den Verfall als Ergebnis der
Kreuzungen leugnen können, die in diesem Land in grösserem Umfang stattgefunden haben als irgendwo sonst. Sie würden dann sehen, dass diese Mischung beim Weissen, Schwarzen und beim Indianer
einen Mischtypus hervorbringt, dessen körperliche und geistige Energie abgeschwächt ist. Wir müssen die Gesetze in der Natur respektieren und in unseren Beziehungen zu den Schwarzen mit Strenge
ihren natürlichen Typus unversehrt und den unsrigen rein erhalten.»[8] Gobineau äusserte sich ebenfalls rassistisch über die Bevölkerung Brasilien.
Details wollen wir unseren Lesern ersparen. Die Brasilienreise war auch Gegenstand des Buches «Der Amazonas», wo der Autor Damian Freiherrn von Schütz-Holzhausen 1883 erwähnt: «Agassiz hatte
recht: diesen Ländern tut nichts so not, als eine andere herrschende Klasse weisser Leute.» (S. 234)
Agassiz und Gobineau verbreiteten ihre fragwürdige Auffassung durch Bücher und Briefwechseln um die ganze Welt. Eine besondere Inspirationsquelle waren zitierte rassistische Textpassagen aus
Agassiz‘ «Reise nach Brasilien». 1895 hielt Dr. Alfred Damm in Berlin einen Vortrag über «Die Entartung der Menschen und die Beseitigung der Entartung.» Er erzählte: «Deutschland nimmt sich
das Vorrecht, allen Völker der Erde voranzugehen. Berlin wird sich der Entartung annehmen und die Regeneration anbahnen. Mit Stolz dürfen wir uns als Deutsche fühlen, um ein Werk durchzuführen,
wie es in den Jahrtausenden der Geschichte nicht entstanden ist.»
Einer von Louis Agassiz Studenten war David Starr Jordan (1851-1931), 1. Präsident der Leland Standford Junior University und umstrittener Eugeniker, der den Polygenismus vertrat. Die von Agassiz geführte «Summer School of Science» auf der Insel Penikese und dessen Evolutionstheorie hatten in diesbezüglich geprägt. Agassiz wurde sein Mentor und Jordan veröffentlichte mehrere Artikel über ihn. 1899 hielt Jordan einen Aufsatz in Stanford, in dem er sich für Rassentrennung und Rassenreinheit einsetzte. In dem Aufsatz behauptete Jordan: «Für eine Menschenrasse oder eine Viehherde gelten dieselben Selektionsgesetze». Jordan äusserte grosse Befürchtungen und Ängste vor einer «Degeneration der Rassen», die eintreten würde, wenn nicht Anstrengungen unternommen würden, um die «Einheit der Rassen» zu erhalten.[107]
1935 bewarb Deutschland das in Berlin erschienene Buch von Gobineau «Die Ungleichheit der Menschenrassen» mit den Worten: «Dieses Werk des grossen Freundes Richard
Wagners (ebenfalls als Rassist bekannt) ist die Grundlage der gesamten Rassenlehre von Houston Stewart Chamberlain bis Günther; wer nach dem Urgrund der Ideen, auf denen das neue Deutschland
aufgebaut ist, sucht, muss zu diesem Gobineau greifen. Wenn wir uns entschlossen haben jetzt eine Ausgabe dieses seit vielen Jahren vergriffenen Werkes herauszubringen, so hat uns dabei der
Gedanke geleitet, dass bei dem erwachten Interesse für Rassefragen, dieses grundlegende Werk Gobineaus für jeden Deutschen, der sich ernsthaft mit den Problemen der Rassenkunde beschäftigen will,
unentbehrlich ist. Gobineau war der erste, der die Bedeutung jener Blutmischung, die wir heute nordischen Einschlag nennen, für Leben und Vergehen der grossen Kulturen und Staatengebilde
erfühlte.»[25] Für Hitler wurde Gobineau zum literarischen Idol, den nach der Philosophie von Gobineau, wären einzig die Arier eine kulturfähige
Rasse. Seither werden die beiden Bieler Gymnasialschüler Agassiz und Gobineau als «Väter des Rassismus» bezeichnet.
Hauptsächlich in Amerika, aber auch in der Schweiz begann man sukzessive den Namen von Louis Agassiz an Schulen, Strassen und Plätzen umzubenennen und Skulpturen zu entfernen. Hauptgründe sind Agassiz als Befürworter des Polygenismus. Die hier zuvor erwähnte religiöse Theorie, die besagt, dass verschiedene Menschenrassen von verschiedenen Vorfahren abstammen, wird heute als wissenschaftlicher Rassismus eingestuft. Agassiz war dementsprechend gegen rassenübergreifende Ehen.
Für seine Pionierforschungen auf dem Gebiet der Glaziologie und über versteinerte Fische, gibt es weltweit viele Orte und Objekte, in denen sein Name dennoch erhalten bleibt.
Erinnerungen in der Schweiz
- An der Louis Agassiz-Gasse in Môtier wurde am Geburtshaus eine etwas versteckte Gedenktafel mit der Inschrift: «Jean Louis Agassiz, celebre naturaliste, est ne
dans cette maison le 28. mai 1807» angebracht.
Môtier, Geburtsort von Louis Agassiz, mit Strassenschild und Geburtshaus von damals (Foto: Bildarchiv der ETH-Bibliothek Zürich) und heute.
Der Agassiz-Stein am Mont-Vully, ganz in der Nähe von Motier.
- Der Agassiz-Stein am Mont-Vully (Wistenlacherberg): Von Neuchâtel aus durchforschte Agassiz das Mittelland und sammelte Beweismaterial für seine kühne Gletschertheorie. Dabei entdeckte er einen mächtigen erratischen Block auf dem Westhang des Mont-Vully und stellte anhand der Steinsubstanz fest, dass dieser aus dem Mont Blanc-Gebiet stammte und vor vielen Jahrtausenden durch den Rhonegletscher an seinen jetzigen Standort getragen wurde. Er konnte nicht ahnen, dass der Findling später einmal seinen Namen tragen würde. Langezeit war der in seiner ganzen Grösse nicht zu erkennende Findling unter einem dichten Gestrüpp versteckt und kaum auffindbar. 1903 entschloss sich der Murtener Sekundarlehrer Jakob Süsstrunk (1840-1909) den «pierre du palais rouland» in seiner Freizeit auszugraben, um ihn seinen Besuchern besser zugänglich zu machen.[35] 1897 hielt die naturforschenden Gesellschaften der Kantone Neuchâtel, Waadt und Freiburg ihre Jahresversammlung in Môtier ab, um den 100. Geburtstag von Louis Agassiz zu feiern. Die Versammlung beschloss, den 10 Meter langen, 4 Meter hohen und um die 500 Tonnen schweren erratischen Block den Namen «Agassiz-Stein» zu geben. [36] Ab 1944 steht darauf die Inschrift «Louis Agassiz, 1807-1873». Der Verkehrsverein Murten erleichterte sein Auffinden mit einer Wegmarkierung. Der Findling ist, ähnlich wie der grosse Heidenstein bei Biel, mit einer Legende verknüpft: Goliath wollte den enormen Stein bei einer Wette vom Chasseral nach dem Murtensee werfen, fiel jedoch bei Vully nieder. Der Stein soll sich um die Mittagszeit zwölfmal um sich drehen, worauf ihm zwölf Männer entsteigen, deren jeder einmal auf den Stein schlägt.[37]
- Ein Schweizer Berggipfel erhielt von Edouard Desor den Namen Agassizhorn.
- In der Nähe des Finsteraarhorns existiert das Agassiz-Joch.
- Die naturforschende Gesellschaft von Neuchâtel hatte 1898 auf dem grossen Granitblock «Pierrabol» die Namen von vier hervorragenden Naturforschern eingravieren lassen, darunter Louis Agassiz und sein Sekretär Edouard Desor.
- Louis Agassiz, dem Initiant vom Uhrenmuseum (MIH), ist in La Chaux-de-Fonds eine Strasse mit 6 Schildern gewidmet.
Die Demontage von Louis Agassiz
Am 29. Februar 1984 veröffentlichte Jean Lindenmann in der Neuen Zürcher Zeitung den Artikel «Der Mensch: Massstab oder Messobjekt?». Darin wird neben Agassiz‘ körperlicher Abneigungen gegenüber
Schwarzen auch seine Meinung über Afrika erwähnt: «Der riesige Erdteil Afrika weist eine Bevölkerung auf, die ständigen Verkehr mit der weissen Rasse hatte, die des Beispiels der ägyptischen
Kultur, der phönizischen Kultur, der römischen Kultur, der arabischen Kultur teilhaftig wurde ... und trotzdem hat sich auf diesem Erdteil nie eine gesittete Gesellschaft schwarzer Menschen
entwickelt.» Ab den 1980er Jahre setzten sich in Amerika zahlreiche Autoren mit dem Rassismus von Agassiz auseinander. Beispielsweise Georg M. Fredrickson in «The black image in the white
mind» (1987), und Constance Perin in «Belonging in America - Reading between the lines» (1988). Nachdem die Universität Harvard die unter Agassiz entstandenen Sklaven-Fotos veröffentlichte,
begann das «makellose» Bild von Louis Agassiz in den 1990er Jahren zu bröckeln.
Wikipedia.org: «Seit 2007 arbeitet Historiker Hans Fässler mit dem transatlantischen Komitee ‹Démonter Louis Agassiz›, das er gegründet hat, um Louis Agassiz neu zu bewerten. An diesem Prozess
sind sowohl der Schweizerische Alpen-Club (SAC), der Agassiz 1865 zum Ehrenmitglied ernannte, als auch das Historische Lexikon der Schweiz (HDS) beteiligt, wo ein neuer Agassiz-Eintrag dem
Freiburger Romanisten Hans Barth zu verdanken ist. Hans Fässler arbeitet eng mit der schweizerisch-haitianisch-finnischen Künstlerin Sasha Huber zusammen. Huber versuchte mit einer
Unterschriftensammlung vergebens das Agassizhorn in Rentryhorn umzubenennen, der Sklaven den Agassiz während seiner Studien fotografieren liess. Huber setzte ihre Forschungen über Agassiz mit der
brasilianischen Historikerin Maria Clara Machado fort und veröffentlichte ‹(T)races of Louis Agassiz: Photography, Body and Science, Yesterday and Today› (2010) als Teil einer Ausstellung für die
29. Kunstbiennale von Sao Paulo 2010. 2012 wurde die Ausstellung ‹Glaziologe, Rassist: Louis Agassiz (1807-2012)›, die zusammen mit der Typografin Hannah Traber und Hans Barth konzipiert und
recherchiert wurde, erstmals im Heimatmuseum Grindelwald gezeigt, deren Auswirkungen bis nach Boston reichten.»[27]
Nachwirkungen

Cambridge, Massachusetts - Die Agassiz-Schule wurde 2002 in Maria Louis Baldwin Schule umbenannt. Die Pädagogin war die erste afroamerikanische Schuldirektorin im Neu-England. Sie leitete die Schule ab 1889 während 33 Jahren. Der damalige Direktor der Harvard Stiftung für interkulturelle Beziehungen, S. Allen Counter, hatte 1975 zusammen mit Stephen Jay Gould mit dem Buch «Der falsch vermessene Mensch», den Rassimus von Agassiz öffentlich gemacht. Die Schule stand im Agassiz-Stadtviertel, dass der Stadtrat von Cambridge 2021 ebenfalls umbenannte. «In einem Land, das auf dem Fundament der weissen Vorherrschaft aufgebaut wurde, müssen wir kritisch und pro aktiv darüber nachdenken, was und wer es verdient, unsere gemeinsamen aktuellen Werte zu vertreten. Wir leben in einer vielfältigen Gemeinschaft - eine Realität, gegen die Agassiz hart gekämpft hat, und dieselbe Art von Gemeinschaft, für die Baldwin hart gearbeitet hat», sagte Cambridge High School-Schülerin Maya Counter in einer öffentlichen Stellungnahme vor dem Stadtrat.[28]
Maria Louise Baldwin, ca. 1885. Fotograf Elmer Chickering, Sammlung Library of Congress, Wikipedia
2002
2021

Neuchâtel - Zwischen 1880 und 1981 gab es in Neuchâtel die «Rue Louis-Agassiz». Nach dem Bau des Physikalischen Instituts und dem Anbau der Handelsschule verschwand die Strasse. Danach stand der Name des Naturforscher auf dem Schild «Espace Louis-Agassiz», das sich beim Gebäude der Fakultät für Humanwissenschaften befindet. 2018 entschied der Gemeinderat auf Initiativen von Barth und Fässler, das «Espace Louis-Agassiz» in «Espace Tilo-Frey» umzubenennen. Die Einweihung fand am 6. Juni 2019 statt. Tilo Frey war eine schweizerisch-kamerunischen Politikerin, die 1971 als erste Neuenburgerin ins Bundesparlament gewählt wurde.[3]
Nationalrätin Tilo Frey, ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv, Comet Photo AG (Zürich), 1971, CC BY-SA 4.0
2019
In Neuchâtel wurde das Espace Louis-Agassiz zu Espace Tilo-Frey.
München - Die Europäische Geophysikalische Union benannte 2019 die Louis-Agassiz-Medaille, die seit 2005 zur Anerkennung herausragender wissenschaftlicher
Beiträge zur Erforschung der Kryosphäre eingeführt wurde, in Julia- und Johannes-Weertman-Medaille um. Diese Änderung hebt den gemeinsamen Beitrag der Weertmans zur Entwicklung des Fachgebiets
hervor, sowohl auf der Ebene der Ausbildung als auch der Grundlagenforschung. Hans Weertman verbrachte einige Zeit als Gastwissenschaftler am Schweizer Reaktorforschungsinstitut (heute Paul
Scherrer Institut).[58]
Strassenschilder mit Informationstafeln der Avenue Agassiz in Lausanne.
Lausanne - Die Stadtverwaltung von Lausanne beschloss 2020 beim Strassenschild, das auf die Avenue Louis-Agassiz hinweist, eine Informationstafel anbringen lassen. Der Inhalt erwähnt ausdrücklich die rassistischen und evolutionsfeindlichen Theorien, die Louis Agassiz vertrat. Darüber hinaus bekräftigt sie, dass die Lausanner Behörden alle Formen des Rassismus entschieden ablehnen und die Gleichheit aller Mitglieder der Gesellschaft gemäss Artikel 8 der Bundesverfassung bekräftigen.[62]
Agassiz besuchte in Lausanne das Collège, das sein Interesse für Naturgeschichte und Anatomie festigte. Sein Lehrer Daniel-Alexandre Chavannes besass die einzige naturgeschichtliche Sammlung im Kanton Waadt, zu der er Zutritt erhielt.[8] Chavannes hatte einen Onkel namens Alexandre César Chavannes (1731–1800), der als Theologe und Naturforscher die Menschenrasse nach ihrer sozialen Entwicklung unterschied und an der Lausanner Akademie unterrichtete. Damals war es in Lausanne Mode, in kleiner Gesellschaft ein dramatisches Werk aufzuführen, so auch das Drama «Mélanie», dessen Autor der Kritiker Laharpe war. Agassiz übernahm die Rolle des Liebhabers. Das Rollenstudium war das längste, das es gab. Alle waren bereitwillig dabei, mit Ausnahme von Agassiz, da er der Meinung war, dass die Mühe, die Verse von Laharpe auswendig zu lernen, durch das Vergnügen, sie vorzutragen, nur halb aufgewogen würde. Während der Aufführung ersetzte er die fehlenden Worte durch Gesten.[70]
1838 wünschte man sich in Lausanne, Agassiz möchte doch als Lehrer an der Akademie unterrichten, doch er lehnte ab. Im Palais de Rumine fand
1907, veranstaltet von der waadtländischen naturforschenden Gesellschaft, die Feier des 100. Geburtstages von Louis Agassiz statt. Die Gesellschaft stiftete ein Denkmal und übergab es dem
Stadtrat. Bei diesem Anlass wurde ein Agassiz-Fonds gegründet zur Unterstützung von jungen Leuten, welche Naturwissenschaft studieren. Der Feier wohnte als Vertreter der Familie Georges
Agassiz (1846-1910), der Sohn von Louis Agassiz‘ Bruder Auguste, bei. Georges verbrachte zu Forschungszwecken einige Jahre bei Louis Agassiz in Amerika und starb dann in Lausanne. Er besass eine
Sammlung von rund 18 000 Schmetterlingen, die er dem Zoologischen Museum Lausanne schenkte.
2020

Kalifornien - 1902 wurde eine Statue von Louis Agassiz an der Aussenseite der Jordan Hall der Stanford University im US-Bundesstaat Kalifornien aufgestellt. 2020 beantragte das Stanford Department of Psychology die Entfernung der Statue von der Fassade seines Gebäudes, da er den Polygenismus befürwortete. Die Statue wurde im Oktober 2020 entfernt.[31]
Die entfernte Louis Agassiz Statue an der Stanford Universität.
Foto: Dicklyon, Wikipedia, CC BY-SA 4.0
Cambridge, Massachusetts - Die Webseite der Eps. Harvard informiert: «Die Universität arbeitet daran, die Darstellung von Agassiz' Erbe zu überarbeiten, um seinen Beitrag zum rassistischen Denken aufzuzeigen. Das Museum of Comparative Zoology (MCZ)-Fakultätskuratorium hat beschlossen, den Namen «Agassiz Museum» aus dem MCZ-Briefkopf zu entfernen, den Namen Agassiz aus dem MCZ-Konferenzraum zu streichen und die Büsten und Porträts von Louis Agassiz in der Ernst-Mayr-Bibliothek im Herbst 2020 nicht mehr öffentlich zu zeigen. Trotz dieser Bemühungen bleibt das Erbe von Agassiz in Harvard von grosser Bedeutung. Über dem Haupteingang des Harvard Museum of Natural History ist «Agassiz» eingraviert. Ausserdem gibt es ein Schild, das den Standort des Hauses der ersten Präsidentin des Radcliffe College, Elizabeth Cary Agassiz, die mit Louis Agassiz verheiratet war, kennzeichnet und auf die Leistungen beider verweist. Zahlreiche Sehenswürdigkeiten sind nach wie vor nach Agassiz benannt.»[28]

Flagstaff, Arizona - Der Stadtrat von Flagstaff wählte 2020 in der Innenstadt einen neuen Namen für die Louis-Agassiz-Strasse, da der Naturforscher rassistische Ideologien vertrat. Sie heisst nun W. C. Riles Drive. Der ursprünglich aus Louisiana stammende afroamerikanische Pädagoge Wilson C. Riles war der erste schwarze Student, der die Arizona State Teachers College (NAU) besuchte. Er promovierte, wurde Lehrer und Schulleiter und 1970 California Superintendent of Public Instruction. Er wirkte auch als Moderator einer Radio-Talkshow. Während seiner Laufbahn konzentrierte sich Riles darauf, benachteiligten Jugendlichen Chancen zu eröffnen. [65] 1952-53 arbeiteten Riles und Superintendent Sturgeon Cromer an der Aufhebung der Rassentrennung an den Schulen der Stadt Flagstaff. Er war der erste Schwarze, der in ein landesweites Amt in Kalifornien gewählt wurde.[64] Ein Gebäude auf dem NAU-Campus ist ebenfalls nach Riles benannt.[65]
State of California - California Blue Book 1975, S. 36, Wikipedia, Public Domain

Chicago - Block Club Chicago berichtet: «Die Agassiz-Grundschule in Lakeview, benannt nach einem schweizerisch-amerikanischen Wissenschaftler, der Theorien zur Verteidigung der Sklaverei vertrat, wird nach Harriet Tubman umbenannt. Damit wird die Grundschule in Lakeview (2851 N. Seminary Ave.) das erste CPS-Gebäude, das seinen Namen im Rahmen des Überprüfungsprozesses des Schulbezirks ändert, der eingeleitet wurde, nachdem eine Untersuchung der Chicago Sun-Times ergab, dass 30 Schulen nach Sklavenhaltern benannt sind.»[30] 2022 wurde die Schule unter dem neuen Namen eingeweiht.
Wikipedia: «Harriet Tubman (1820-1913) war die bekannteste afroamerikanische Fluchthelferin der Hilfsorganisation Underground Railroad, die von etwa 1849 bis zum
Ende des Sezessionskrieges geflüchteten Sklaven half, aus den Südstaaten in die Nordstaaten der USA oder nach Kanada zu fliehen. Im Sezessionskrieg arbeitete sie neben ihrer Tätigkeit als
Krankenschwester und Köchin als Kundschafterin für die Nordstaaten. In ihren späteren Lebensjahren engagierte sie sich in der Frauenbewegung.»[31]
Harriet Tubman um 1885. Foto: Horatio Seymour Squyer, 1848-18 Dec 1905, National Portrait Gallery, Washington, Wikipedia
2022

Manchester-by-the-Sea, Massachusetts - 1874 benannte eine Gruppe von Studenten den Ort dieses Findlings zu Ehren von Louis Agassiz, der als Erster die
Theorie aufstellte, dass die Felsen, die die Landschaft Neuenglands prägen, von Gletschern geformt und abgelagert wurden. Agassiz besuchte den Ort und stellte fest, dass die unregelmässigen
physischen Merkmale zu seiner Hypothese passten.[60] Der Agassiz-Felsen wurde 2022
in «Die Monolithen» umbenannt. Die Umbenennung erfolgte, weil Agassiz in seinen Veröffentlichungen die Ansicht vertrat, dass nicht-weisse Menschengruppen von Natur aus minderwertig sind.
[61]
Der ehemalige Big Agassiz Rock. Foto: Magicpiano, Wikipedia, CC BY-SA 4.0

Cleveland, Ohio - Die Louis Agassiz School in Cleveland wurde 2022 aufgrund Louis Agassiz rassistischer Überzeugung in «Mary Church Terrell School»
umbenannt. (57) Wikipeda: «Mary Church Terrell (1863 -1954), Tochter freigelassener Sklaven, setzte sich aktiv für die Rechte und Gleichbehandlung der afroamerikanischen Bevölkerung und die
Aufhebung der Rassentrennung in den Vereinigten Staaten ein. 1884 machte sie ihren Abschluss am Oberlin College. 1904 nahm sie als einzige Delegierte afroamerikanischer Abstammung am
Weltfrauenkongress in Berlin teil und hielt dort Ansprachen auf Deutsch, Französisch und Englisch. Gemeinsam mit anderen gründete sie 1909 die Bürgerrechtsorganisation National Association for
the Advancement of Colored People (NAACP). Sie setzte sich aktiv für die Erlangung des Frauenwahlrechts ein, bis dieses im Jahr 1919 mit dem 19. Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten
Staaten beschlossen wurde.»
Mary Church Terrell auf einem Ölgemälde von Betsy Graves Reyneau.
Foto: NARA - 559207, Sammlung der National Portrait Gallery, Washington, Wikipedia
Schriften von Louis Agassiz (Auswahl):
1828: Cynocephalus Wagleri aka. Description d’une nouvelle espèce du genre Cynocéphale (Leipzig) / Beschreibung einer neuen species aus dem genus Cyprinus; -
1829: Selecta genera et species piscium quas in intinere per Brasiliam annis 1817-1820; Cyprinus uranoscopus, nouvelle espece trouvée; - 1830: De taxi et syntaxi
morphomatum telae corneae dictae / Prospectus de l’histoire naturelle des Poissons d‘eau douce de l’Europe centrale; - 1832: Untersuchungen über die fossilen Süsswasser-Fische
der tertiären Formation / Untersuchungen über die fossilen Fische der Lias-Formation; - 1833: A Journey to Switzerland, and Pedestrian Tours in that Country / Tableau
synoptique des principales familles des plantes / Neue Entdeckungen über fossile Fisches / Synoptische Übersicht der fossilen Ganoiden; - 1833-1835: Résumé des travaux de la
section d‘histoire naturelle, et de celle des sciences médicales; - 1833-1844: Recherches sur les Poissons fossiles, 5 Bände; - 1834: Remarks on the different
species of the genus Salmo which frequent the various rivers and lakes Europe / On the fossil fishes of Scotland / On a new classification of fishes, and on the geological distribution of fossil
fishes / On the anatomy of the genus Lepidosteus / Observations on the growth and the bilateral symmetry of the Echinodermata / Über das Alter der Glarner Schiefer-Formation nach ihren
Fischresten / Allgemeine Bemerkungen über fossile Fische; - 1835: Description de quelques espèces de Cyprins du lac de Neuchâtel, qui sont encore inconnues aux naturalistes /
Notice sur les fossiles du terrain crétacé du Jura Neuchâtelois / Prodrome d‘une monographie des Radiaires ou Echinodermes / Über Belemniten / Kritische Revision der in der Ittiolitologia
Veronese abgebildeten fossilen Fische (Stuttgart) / Sur les poissons fossiles de la formation houillère / On the principles of classification in the animal kingdom in general, and among mammalian
in particular / Systematic enumeration of the fossil fishes in English collections / Remarques sur les Poissons fossiles / Coup d’œil synoptique des Ganoïdes fossiles / Views of the affinities
and the distribution of the Cyprinidae / On the arrangement and geology of fishes / Observations sur les blocs erratiques des pentes du Jura / Notice on the fossil beaks of four extinct species
of Fishes…; - 1836: Résumé des travaux de la Société des Sciences naturelles de Neuchâtel, Section d’histoire naturelle et de médicine, de 1834 à 1836 / Les Poissons fossiles de
l’Angleterre; - 1837: Discours prononcé à l’ouverture des séances de la Société Helvétique des sciences naturelles, à Neuchâtel le 24 juillet 1837 / Des glaciers, des moraines et
des blocs erratiques / Sur les blocs erratiques du Jura / Sur les infusoires fossiles du tripoli d’Oran / A systematic and stratigraphical catalogue of the fossil fish in the cabinets of Lord
Cole and Sir Philip Grey Egerton, by Sir Philip Grey Egerton / Conchyliogie Minérale de la Grande Bretagne, par James Sowerby; - 1837-1844: Mineral-Conchologie Grossbrittaniens,
von James Sowerby; - 1838: Notice sur les moules du Musée de Neuchâtel / Künstliche Steinkerne von Konchylien-Fisches / Theorie der erratischen Blöcke in den Alpen / Monographies
d’Echinodermes vivants et fossiles, 1ére livraison / Discussions sur les argiles de Speeton / Observations sur les glaciers / Réponses aux objections du transport des blocs erratiques par la
marche des glaciers, et du poli des roches / Conjectures sur l’origine des couches spathiques observées dans le Jura / Explications sur les laves vues à la Neuveville / Le terrain néocomien plus
récent que la formation wealdienne / Geologie und Mineralogie in Beziehung zur natürlichen Theologie von W. Buckland; - 1839: Notice sur quelques points de l’organisation des
Euryales, accompagnée de la description détaillée de l’espèce de la Méditerranée / Notice sur le Mya alba, espèce nouvelle de Porto-Rico / Pterygotus Problematicus, onchus Murchisoni in «The
Silurian System» / Mémoire sur les moules de Mollusques vivants et fossiles / Observations sur les échinodermes fossiles des terrains de la Suisse / Catalogus Echinodermatum fossilium musei
neocomensis / Description des Echinodermes fossiles de la Suisse; - 1840: Gletscher-Studien mit Studer / Etudes sur les glaciers / Enumération des Poissons fossiles d’Italie / On
glaciers and boulders in Switzerland / On animals found in red snow / On the polished and striated surfaces of the rocks which form the beds of Glaciers in the Alps / On Glaciers, and the
evidence of their having once existed in Scotland, Ireland, and England / Observations sur la structure des écailles de poissons / Catalogus systematicus ectyporum echinodermatum fossilium musei
neocomensis / Etudes critiques sur les Mollusques fossiles; - 1841: Untersuchungen über die Gletscher / On the fossil fishes found by Mr. Gardner in the province of Cearà, in the
north of Brazil / Genus Trigonia / Alte Morainen bei Baden-Baden / Une série de coquilles vivantes et fossiles des bords de la Clyde en Ecosse / Routes parallèles de Glen-Roy en Ecosse / Terrain
cyliolitique / Monographies d’Echinodermes, vivants et fossiles / Additions to Mr. Wood’s catalogue of Grag radiaria / De la succession et du développement des êtres organisés à la surface du
globe terrestre dans les différents âges de la nature; - 1842: Observations sur le glacier de l’Aar et sur les glaciers / La théorie des glaces et ses progrès les plus récents /
Histoire naturelle des poissons d’eau douce de l’Europe centrale / Monographies d’Echinodermes, vivants et fossiles / New views regarding the distribution of fossils in formations / Matériaux
pour une bibliothèque zoologique et paléontologique / The Glacial Theory and its recent progress (Edinburgh) / Reise nach dem Aar-Gletscher / Gletscheruntersuchungen auf dem Aargletscher /
Gletscher Einwirkung im Jura; - 1842-1845: Etudes critiques sur les mollusques fossiles. Monographie des Myes; - 1842-1846: The Prospectus of the Nomenclator
Zoologicus; - 1843: Neue Beobachtungen auf den Gletschern / Synoptical table of British fossil fishes / A period in the history of our planet / Notice sur la succession des
Poissons fossiles dans la série des formations géologiques / Sur les glaciers / Valeur géologique des dents de Squales pour la détermination des terrains / Quel est l’âge des plus grands glaciers
des Alpes suisses? / Sur le Mouvement du glacier de l’Aar / Sur les fossiles rapportés du Pérou par M. Tschudi / Sur la détermination exacte de la limite des neiges éternelles en un point donné /
Exposé abrégé de la stratification des glaciers avec des coupes / Report on the fossil fishes of the Devonian system or old red sandstone ; - 1844: Tableau général des Poissons
fossiles rangés par terrains / Essai sur la classification des Poissons / De la forme des Placoides et Tableau général des espèces de placoides rangés par terrains / Sur les progrès de l’étude de
l’ichtyologie / Sur l’importance des divers embranchements du règne animal / Sur l’Isar des Pyrénées, comparé au chamois des Alpes / Sur la distribution géographique des quadrumanes / Sur la
distribution géographique des Chiroptères / Sur le genre Pyrula de Lamarck / Sur les prétendues identités que l’on admet généralement entre les espèces vivantes et les fossiles de certaines
terrains / On fossil fishes / Sur quelques Poissons fossiles du Brésil / Sur un nouvel oursin, le Metaporinus Michelini / Sur les prétendues identités des coquilles tertiaires et vivantes /
Observations sur le poli et les stries des roches / Sur les glaciers et les dépôts erratiques / Nummulitique dans la craie supérieur / La question paléontologique de Petit-Cœur/ Sur une
collection de coquilles d’Orient de M. Albert de Pourtales / Sur le cerveau des Poissons / Introduction à une monographie des poissons fossiles du vieux grès rouge, suivi d’un tableau synoptique
des poissons fossiles du système Dévonien; - 1844-1845: Monographies des Poissons fossiles, supplément aux Recherches sur les Poissons fossiles; 1845: Les
poissons fossiles du système Dévonien de la Russie / Iconographie des coquilles tertiaires réputées identiques avec les espèces vivantes / Sur les métamorphoses des animaux des classes
inférieures / Sur la distribution géographique des animaux et de l’homme / Cirques des glaciers dans les Alpes et le Jura / Anciennes moraines de l’Allée-Blanche et du val Ferret. Glacier d’Ornex
/ Lettre à Elie de Beaumont sur les roches striées de la Suisse / Sur un fait e superposition de roches observées en Ecosse par M. Robertson / Sur l’importance de l’étude des animaux fossiles /
Anatomie des Salmones par L. Agassiz et C. Vogt / Remarques sur le «Traité de Paléontologie» de F. Jules Pictet / Notice sur la géographie des animaux / Nouvelles observations sur les nageoires
des poissons / Observations sur le glacier de l’Aar / Résumé de ses travaux sur l’encéphale des poissons / Sur diverses familles de l’ordre des crinoïdes / Notice sur les glaciers de l’allée
Blanche et du Val Ferret / Remarques sur les observations de M. Durocher relatives aux phénomènes erratiques de la Scandinavie / Rapport sur les poissons fossiles de l’argile de Londres; -
1845-1846: On fossil fishes, particularly those of the London clay; - 1846: Observations sur la distribution géographique des êtres organisés / Observations sur
les rapports qui existent entre les faits relatifs à l’apparition successive des êtres organisés à la surface du globe et la distribution géographique des différents types actuels d’animaux /
Observations sur les glaciers de la Suisse / Discussions sur l’Oscillation des glaciers et sur les roches et galets striés / Sur un nouveau genre de poissons fossiles / Sur les Poissons des
terrains paléozoïques / On the ichthyological fossil fauna of the Old Red Sandstone / Résumé d’un travail d’ensemble sur l’organisation, la classification et le développement progressif des
Echinodermes dans la série des terrain / On the fish Huronigricans of Cuvier / On a new Pygorhynchus of Georgia / Climate of Europe during the later Miocene period; - 1846-1848:
Catalogue raisonné des familles, des genres et des espèces de la classe des Echinodermes, par L. Agassiz et Ed. Desor; - 1847: Analogy between the fossil flora of the
European Miocene and the living flora of America / On the Coal-field of Eastern Virginia - Fossil Fishes, By Charles Lyell, with notes from L. Agassiz and Sir Philip Egerton / Geologische
Alpenreisen / Système glaciaire ou Recherches sur les glaciers, leur mécanisme, leur ancienne extension et le rôle qu’ils ont joué dans l’histoire de la terre par MM. L. Agassiz, A. Guyot et Ed.
Desor / An introduction to the study of natural history, in a series of lectures delivered in the hall of the College of Physicians and Surgeons, New York / Remarks on the position of Boston
naturalists in their location at a seaport / On the blind-fish of the Mammoth Cave / Remarks upon the Moose and Caribou (Cervus alces et Tarandus) and the American raven / De l’étude comparative
des animaux inférieurs et des plantes qui accompagnent l’homme en Europe et dans l’Amérique; - 1848: Letter to Dr. Gibbes in relation to Dorudon Serratus / Tubulibranchiate
Annelids of Boston harbor / On the existence of numerous minute tubes in Fishes / An appeal to the students of science in America / Observations on the structure of the foot in the embryo of
birds / The terraces and ancient river bars, drifts, boulders, and polished surfaces of Lake Superior / Fishes of Lake Superior / On the comparison of Alpine and northern vegetation / Phonetic
apparatus of the Cricket / Black Banded Cyprinidae / Monograph of Garpikes / On the origin of the actual outlines of Lake Superior / On the fossil Cetacea of the United States / The salmonida of
Lake Superior / Revision of the system of classification in Zoology / Two new Fishes from Lake Superior (Percopsis Rhinichthys) / Principles of Zoology; - 1848-1849: Twelve
lectures on Comparative Embryology delivered before the Lowell Institute in Boston, December and January; - 1848-1854: Bibliographia Zoologiae et Geologiae. A general catalogue
of all books, tracts, and memoirs of Zoology and Geology; - 1849: On the distinction between the fossil crocodiles of the Green Sand of New Jersey / Investigations upon Medusae /
On the structure of coral animals / The zoological character of young mammalian / The vegetable character of Xanthidium / On the fossil remains of an elephant found in Vermont / On the
circulation of the fluids in insects / On the embryology of Ascidia, and the characteristics of new species from the shores of Massachusetts / On the structure and homologies of radiated animals,
with reference to the systematic position of the Hydroid Polypi / On animal morphology / On the differences between progressive, embryonic, and prophetic types in the succession of organized
beings through the whole range of geological times / Remarks on two kinds of drift in Cambridge, on the road to Mount Auburn / Worms of the coast of Massachusetts / The metamorphoses of the
Lepidoptera / On the development of ova in insects / Relation between the structure of animals and the element in which they dwell / On the egg in vertebrate animals as a means of classification
/ On the circulation and digestion in the lower animals / Resemblance of the mastodon and the manatee / On the respiratory system in the lower animals: - 1850: Lake Superior /
Contributions to the natural history of the Acalephae of North America / Phocoena Americana, New Sp. Agas / On the gills of Crustacea / Muscular structure of Medusae / Embryonic development of
insects / Breathing organs of Mollusks / Remarks on the development of air-bladders / Remarks on the species common to different formations / On the morphology of the Medusae / On the principles
of classification (of the animal kingdom) / On the structure of the Halcyonoid Polypi / Geographical distribution of animals / The natural relations between animals and the elements in which they
live / Classification of some of the Mollusca Acephala / On the coloration of animals / On the diversified functions of cells / On the structure of the egg / The diversity of origin of the human
races / On Siluridae / On the scales of the Bonito / On the growth of the Egg, prior to the development of the Embryo / On the structure of the mouth in Crustacea / On the relation between
coloration and structure in the higher animals / A new naked-eyed Medusa, Rhacostoma Atlanticum / On the pores in the disc of Echinoderms / On Lamprey Eels (Petromyzontidae)and their embryonic
development and place in the natural history system / On the little bodies seen on Hydra / On the soft parts of American fresh water-Mollusks / De la classification des animaux dans ses rapports
avec leur développement embryonnaire et avec leur histoire paléontologique / Classification of Mammalia, Birds, Reptiles, and Fishes from embryonic and Paleozoic data / Glacial theory of the
erratics and drifts of the New and Old Worlds; 1851: The classification of Insects from embryological data / Contemplations of God in the Kosmos / Extract from the Report of
Professor Agassiz to the Superintendent of the Coast Survey, on the Examination of the Florida reefs, keys, and coasts / On the Florida coral reefs / Results of an exploration of the coral reefs
of Florida, in connection with the U. S. Coast Survey / Report on the vertebrate fossils exhibited to the Association / Shells of New England, by W. Stimpson / Remarks upon the unconformability
of the Paleozoic formations of the United States / On the Mansfield coal formation; - 1851-1855: Grundzüge der Geologie, - 1852: Über die Gattung unter den
nordamerikanischen Najaden / Hugh Miller author of «Old Red Sandstone» and «Footprints of the Creator» / Des relations naturelles qui existent entre les animaux et les milieux dans
lesquels ils vivent / Diversity of origin of the human race / On the Allantois / On organic tissues / The earliest larval state of Intestinal Worms; - 1853: Sur les Poissons des
Etats-Unis / Family of Cyprinodonts / On cell-segmentation / Notices of works on geology / Notices of works on zoology / Extraordinary fishes from California constituting
a new family / On cartilaginous fishes / Cestracion from China / Age of the new red sandstone of Virginia and North Carolina / Footmarks of the Potsdam sandstone / Fishes
found in the Tennessee River; - 1854: Notice of a collection of Fishes from the southern bend of the Tennessee River in the State of Alabama / The primitive diversity and number
of animals in geological times / Sketch of the natural provinces of the animal world and their relation to the different types of man / Phenomena accompanying the first appearance of a
circulating system; - 1855: On the Ichthyological fauna of Western America, or Synopsis of the Ichthyological fauna of the Pacific slope of North America…; Discovery of
viviparous Fish in Louisiana, by Dr. Dowler / Classification of Polyps / On the so-called footprints of birds in the Connecticut River Sandstone / Contributions to the Natural History of the
United States of America; - 1856: Classification in Zoology / On the Geographical Distribution of Turtles in the United States / Ovarian impregnation in Fishes and Chelonians /
Embryology of a species of shark / Orthagoriscus mola / The class of Fishes, divided into several distinct classes / The Glanis of Aristotle / On the general characters of orders in the
classification of the animal kingdom / Notice of the fossil Fishes; - 1857: On the correspondence of different stages of embryonic development with the different stages of
geological succession / On de Beaumont’s theory / The order to which Ammonites belong / The family of Naiades / Nouvelle espèce d’Esoce du Lac Ontario / «Prefatory remarks» in Indigenous Races of
the Earth von G. R. Gliddon, / Various existing systems of classification of fishes; - 1857–1862: Contributions to the natural history of the United States of America, 4 Bände
(Boston); - 1858: What constitutes an individual in natural history? / Account of his visit to the reefs of Florida / On lasso cells upon living corals / Observations upon
Corals / Observation on the egg-case of Skates / A new species of Skate from the Sandwich Islands (Goniobatis meleagris Ag.) / The animals of Millepora are Hydroid Acalephs, and not Polyps / New
fishes from Lake Nicaragua, collected by Julius Froebel / Remarks on the Lump-fish (Discoboli) from the Florida reefs / On some Salmonidae; The Characini; On the so-called migrations of fishes /
The classification of Fishes; - 1859: Similarity between the fauna of Northeastern America and that of Northeastern Asia / On Marcou’s «Geology of North America» / On some
new Actinoid Polyps of the coast of the United States / Origin of Animals / The scientific career of Alexander von Humboldt / Alexander von Humboldt / On reversed bivalve shells / Discoveries of
prehistoric remains on the shores of Lake Neuchâtel / Morphology of the genus Eurypterus / The best arrangement of a Zoological Museum / An essay on classification; 1860: A
communication in opposition to the theory of origin of species of Mr. Darwin / On consecutive faunae and their corresponding number of geological formations / Discussion on the theory of Prof. W.
B. Rogers, of subsidence and denudation of the ocean-floor / On the Arctic Sea / Homologies of the Radiata / Individuality and specific differences among Acalephs / Varieties do not in reality
exist as such / On the age of some of the sandstones of North America / On Mallotus villosus of Labrador; - 1861: Discussion on the primordial fauna / Some remarks on the
circumscription of animals in the ocean / Observations on the rate of increase and other characters of fresh-water shells, Unios / Perforation in rocks made by the Saxicava rugosa, a bivalve
shell / Two individual corals developed from one base / Pressure on living star-fishes at great depths / On the homologies of Echinoderms / Remarks on bilateral symmetry and laterality in
mollusks; - 1862: Directions for collecting objects of natural history, by L. Agassiz, Director of the Museum of Comparative Zoology / Highly interesting discovery of new Sauroid
remains / The structure of animal life / On homologies of Brachiopoda / On the Megatheroids / On development of Rana temporaria / On The subdivisions of Tertiary strata / Differences among the
faunae of fossils / On geographical distribution of the fresh-water fishes; - 1863: Methods of study in natural history / On the enigmatic fossil of Solenhofen / Geographical
distribution of Echini / On the natural attitude of the Megatherium; - 1865: Métamorphoses subies par certains Poissons avant de prendre la forme propre à l’adulte / Lettres
relatives à la faune Ichthyologique de l’Amazone; - 1866: Geological sketches / Conversacôes scientificas sobre o Amazonas feitas na sala do externato do Collegio de Pedro II.,
durante o mez de Maio de 1866; - 1867: Report on use of a new hall in the Smithsonian / Observations géologiques faites dans la vallée de l’Amazone / Remarks upon the antiquity
of man / On phyllotaxis / Examination of the skulls of the American bison and the European aurochs / A Cetacean new to America / Remarks on the Taconic system / On the classification of the
Siluroids: - 1868: Sur la géologie de l’Amazone, par MM. Agassiz et Coutinho / A Journey in Brazil by Professor and Mrs. Louis Agassiz; - 1869: De l’espèce et de
sa classification en zoologie (Paris) / Principes rationnels de la classification Zoologique / Nature et définition des espèces / Ordre d’apparition des caractères zoologiques pendant la vie
embryonnaire ; - 1870: On the former existence of local glaciers in the White Mountains; - 1871: Eulogy of Dr. J. E. Holbrook / Observations on a set of boulders
in Berkshire County and Wachusett range, Massachusetts / Mode of Copulation among the Selachians; - 1872: Fish-nest (of Chironectes Pictus) in the seaweed of the Sargasso Sea /
Agassiz’s deep-sea explorations / Glacial action in Fuegia and Patagonia / Remarks on results of the Hassler Expedition / A lecture on the natural history of the animal kingdom / Sketch of a
voyage from Boston to San Francisco; - 1873: Voyage d’exploration scientifique dans l’Atlantique et l’Amérique du Sud / Structure and growth of domesticated animals ; -
1874: Evolution and permanence of type / The Darwinian Theory / Three different modes of teething among Selachians


Jean Edouard Desor (1811-1882), Naturforscher, Nationalrat, Sekretär von Louis Agassiz
Kein Schüler vom Gymnasium Biel
In den 1940er und 1950er Jahren erwähnten die Zeitungen Journal du Jura (6. 6. 1942 / 3. 9. 1953) und Bieler Tagblatt (6. 6. 1942 / 12. 1. 1952), Desor sei ein
Schüler des 1. Gymnasiums gewesen. Laut damaligen Stadtarchivar Werner Bourquin soll Desor im dazugehörigen Pensionat der Marie Louise Bloesch untergebracht worden sein. Wie man jedoch aus dem
Schülerverzeichnis 1817 bis 1834 entnehmen kann, das sich im Stadtarchiv Biel befindet, ist Edouard Desor darin nicht verzeichnet. Desor hatte Louis Agassiz in vieler Hinsicht
unterstützt und inspiriert.
Kindheit
Edouard Desor stammte aus einer durch die Aufhebung des Ediktes von Nantes aus Frankreich vertriebenen Hugenotten-Familie, die in der hessen-homburgischen Kolonie Friedrichsdorf eine Zufluchtsstätte gefunden hatte. Er kam am 13. Februar 1811 als Sohn des Fabrikanten Jean Desor (1786-1813) und seiner zutiefst religiösen Mutter Christine Albertine, geborene Foucar, zur Welt. Die Familie war nach dem frühen Tod des Vaters mittellos, doch gelang es der Mutter, mithilfe von Stipendien, die Söhne studieren zu lassen.[42]
Nach dem frühen Tod des Vaters heiratete Christine erneut. Als Privatlehrer ihrer Kinder unterrichtete der jugendliche, später berühmt gewordene Institutsvorstand
Louis Frédéric Garnier (1809-1882), der dem jungen Edouard die alten Sprachen beibrachte. Er lernte dann die Bekanntschaft und die Philosophie des von der Polizei verfolgten elsässischen
Evangelisten Bost kennen. In Friedrichsdorf erhielt Bost die Weisung, keine Versammlungen und Vorträge abzuhalten, an die er sich aber nicht hielt. Es gelang ihm Edouard Desor für seine Worte zu
begeistern. Der 15-jährige besuchte die polizeilich verbotenen Konventikel und liess, um seinen Glaubens willen, eine Gefängnisstrafe über sich ergehen. Desor wollte nun Theologe werden, ein
Wunsch, den seine Mutter unterstützte. Sein Bruder Frédéric bevorzugte die medizinische Laufbahn.
Im Pfarrhaus Hanau spezialisierte Edouard sich auf die Deutsche Sprache. Allerdings verlor er durch den dortigen Pfarrer, mehr und mehr das Interesse für Theologie. In Hanau lernte er seinen
Klassenkameraden, den späteren Naturforscher Gottfried Ludwig Theobald (1810-1869) kennen, mit dem er lebenslang befreundet war. Desor bildete sich anschliessend am Gymnasium zu Büdigen auf die
Universität vor. In Giessen (wo er Mitglied der Studentenverbindung Hassia war) und Heidelberg widmete er sich dem Jurastudium. Er verbündete sich mit der «deutschen Burschenschaft», was ihn
wieder in Konflikt mit der Polizei brachte.
Flucht nach Paris
Nachdem er sich an Pfingsten 1832 am «Hambacher Freiheitsfest» beteiligte, wo die radikalen Liberalen die «Vereinigten Staaten von Deutschland» ausruften, wurde Desor polizeilich gesucht und flüchtete nach Paris. Hier begann er als Lehrer für Privatstunden und sorgte für die französische Übersetzung von Carl Ritters «Erdkunde». Er legte namentlich unter der Führung von Elie de Beaumont den Grund zu seinen geologischen Studien.
Die Schweiz als neue Heimat
Als Desor de Beaumont 1837 zu den Versammlungen der Schweizerischen naturforschenden Gesellschaft nach Neuchâtel begleitete, traf er dort Louis Agassiz und Carl Vogt. Er blieb in der Schweiz, wo er sich zuerst eher erfolglos als Jurist zu betätigte. Dann versuchte er durch die Fabrikation von Stearinkerzen seinen Lebensunterhalt zu verdienen und lebte bei Carl Vogts Vater, Medizinprofessors Philipp Friedrich Wilhelm Vogt (1789-1861), in Bern.[44]
Das Team Desor - Agassiz
Louis Agassiz, der an der Uni Neuchâtel unterrichtete hatte von 1832 an zahlreiche Arbeiten zoologischen, paläontologischen und geologischen Inhaltes veröffentlicht und machte sich an ein
Riesenwerk über fossile Fische. Er beschäftigte Zeichner, einen Lithographen, Drucker usw. 1836 klagt er, dass er sich nach Hilfskräften umsehen müsse.[43] Auf der Suche nach einem Sekretär entschied sich Agassiz auf Carl Vogts Empfehlung, Desor
einzustellen. Vogt verlegt den Eintritt Desors bei Louis Agassiz in das Jahr 1839. (45) Desor hatte nun die Möglichkeit sich an den Forschungen von Agassiz zu beteiligen.
Etwas später kam Carl Vogt, nachdem er seine medizinischen Studien abgeschlossen hatte, ebenfalls nach Neuenburg und Agassiz‘ Studie über fossile Fische und Echinodermen schritten rasch voran.
Vogt erwähnt in seinen «Lebenserinnerungen», dass Agassiz wegen Überlastung von 1839 bis 1844 von seinen wissenschaftlichen Publikationen höchstens fünf Druckbogen selbst geschrieben habe, da für
das Technische Sekretär Edouard Desor zuständig war.]43] Carl Vogt: «Als wir beide, Ed. Desor und ich, bei Agassiz arbeiteten, hatte mein Freund Desor die Aufgabe, die fossilen Fische,
welche Agassiz untersucht und bestimmt hatte, nach dessen Notizen zu beschreiben. Desor diktierte diese Beschreibungen Mr. Charles, der behauptete, dass er von dem, was Desor ihm diktiere,
vollständige Kenntnis nehme. Desor verlangte, der Schreiber solle nur eine unbewusste Feder sein. Um diesen Streit zu entscheiden, beschloss Desor seinem Sekretär einen haarsträubenden Unsinn zu
diktieren und flocht in die Beschreibung eines fossilen Fisches die Phrase ein: ‹Dieser Fisch unterscheidet sich vor allen übrigen dadurch, dass er den Kopf da hat, wo die andern den Schwanz
haben.› Mr. Charles schrieb, ohne zu reagieren. Desor vergass den Schelmenstreich und das Manuskript wanderte in die Druckerei. Der Bogen wurde abgezogen und erst als dies geschehen war und die
Lieferung abgesendet werden sollte, erinnerte sich Desor seines Streiches. Es musste ein Karton gedruckt und in den Bogen eingefalzt werden.»[46]
Agassiz, der sich mit der Eiszeit-Theorie auseinandersetzte, gründete als neue Wissenschaft die Glaziologie. Die geologische Arbeiten zum Zwecke der genaueren
Erforschung der Gletscher wurden auf Exkursionen in die Berner-, Walliser- und Savoyer-Alpen immer ausgedehnter.[43] Angeregt durch seine Widersacher errichteten Desor und Agassiz 1840 auf dem Unteraaregletscher in einem natürlichen Unterstand
ein echtes wissenschaftliches Forschungsinstitut, das sie scherzhaft «L'Hôtel des Neuchâtelois» nannten. Am 27. August 1841 unternahmen Edouard Desor, Louis Agassiz, Geologe Franz Josef Hugi,
Gletscherforscher James David Forbes, Gottlieb Studer und andere Alpinisten die erste wissenschaftliche Besteigung des Jungfrauhorns. Bei dieser Besteigung wurden sie von sechs Bauern aus der
Umgebung geführt, die selbst wieder unter der Leitung eines 80-jährigen Hirten, Jakob Leuthold, standen, welcher den Berg schon dreimal bestiegen hatte.[38] Auf dem Gornergletscher entdeckte er dann auch eine Gletscherflohart, die dank Alkohol als
Frostschutzmittel im Eis überlebt. Ihm zu Ehren erhielt das Insekt den Namen Desoria glacialis.[42] Edouard Desor gibt in seinen «Excursions et séjours dans les glaciers» (1843) und später in seinen «Nouvelles excursions et séjours dans les glaciers» (1845) einen Bericht über
die angewandten Techniken und die erzielten Ergebnisse. Die Mitglieder des Aaregletscherteams nahmen den Rang von Pionieren im Alpinismus ein.[47]
Den Studien in den Hochalpen wurden 1845 ein Ende gemacht, als der Gefährte der Alpentouren Dollfus am Galgenstock verunfallte. Schockiert nannte Desor diese Bergtour in einer Broschüre die letzte (Une dernière ascension par E. Desor, 1854). Er zog es nun vor, sich wieder mit seinen Crinoiden zu befassen, statt sein Leben in Eisspalten zu riskieren.[49]
Bereits 1842 begann Agassiz in seinen Briefen, eine Forschungsreise in die Vereinigten Staaten anzudeuten. Nachdem Agassiz eine Berufung zur Universität Cambridge angenommen hatte, lud er 1847 Desor als Begleiter ein. Desor hingegen wollte zuerst Skandinavien kennenlernen, wo er Findlinge untersuchte. Von dort reiste er zu Agassiz in die Vereinigten Staaten. Desor trat dort sehr bald als «Geographer of the Congress» in die Dienste der Regierung der Vereinigten Staaten ein und wurde insbesondere mit wissenschaftlichen Untersuchungen des Lake Superior und von Pennsylvanien betraut. Einer Notiz zufolge stammte der Name Laurentian von Desor her und wurde zuerst 1850 von ihm für einige marine Ablagerungen in Maine an dem St. Lawrence River und an den Champlain- und Outarioseen gebraucht.
Streit mit Louis Agassiz
Desor befreundete sich mit Pfarrer Theodor Parker, dem Vorkämpfer der Sklavenbefreiung und schloss sich auch in religiösen Dingen der Richtung Parkers an. Parker kannte die Schriftstellerin Harriet Beecher-Stowe (Onkel Toms Hütte) sehr gut und kämpfte ebenfalls für die Gleichstellung der Frauen.[39] Dies führte zwischen Desor und Agassiz zu unterschiedlichen Meinungen über die Rassenfrage und zum Streit. Desor berichtete 1853 über die Sklaverei in der Revue Suisse mit dem Artikel «L'esclavage aux Etats-Unis». 1848 wählte man ihn in die American Academy of Arts and Sciences und 1862 in die American Philosophical Society. In Amerika wurden in Michigan ein See und der Mount Desor nach ihm benannt.
Edouard Desor wird Millionär
Sein Bruder Frédéric hatte sich inzwischen als Arzt im Städtchen Boudry niedergelassen und die reiche Neuchâteler Erbin Charlotte de Pierre geheiratet. Als sie 1852 kurz nach der Hochzeit starb,
hinterliess sie ihr Vermögen ihrem Ehemann, der aber seinerseits krank war. Daher kehrte Edouard Desor aus Amerika zurück, um seinen Bruder zu pflegen. Als dieser starb, erbte er dessen Vermögen.
1859 erhielt er von der Gemeinde Ponts-de-Martel das Bürgerrecht. In Neuchâtel arbeitete er bis 1868 als Geologielehrer. Auch unterstützte er die geologischen Studien für die Eisenbahnverbindung
durch die Juraketten. Zusammen mit dem Feldgeologen Amanz Gressly erstellte er ein genaues Profil der Tunnels von Les Loges und Mont-Sagne.
Kulturzentrum für Gelehrte
Das Landgut Combe-Varin: Reproduktion aus «Das Album von Combe-Varin» , 1861 und Foto von 2023
In jedem Sommer war sein geerbter Landsitz in Combe-Varin (oberhalb Noiraigues, gegenüber Les Ponts) ein Sammelpunkt von Freunden und Bekannten. Das ehemalige Jagdhaus und der mittlerweilen verschwundene Bauernhof wurden «Les Pomeys» genannt. Desor, der diesen Ortsnamen nicht mochte, ersetzte ihn durch den des benachbarten Bauernhofs Combe-Varin.[47] Er wandelte sein Haus in einen kulturellen Treffpunkt für seine Freunde um, die sich im Sommer aus den verschiedensten Ländern Europas zusammenfanden. Das hatte zur Folge, dass diese Gelehrten eine Reihe interessanter Fragen auf wissenschaftlichen Gebieten diskutierten. Die Ergebnisse dieser Unterhaltungen fanden sich unter anderem in dem Buch «Das Album von Combe-Varin» wieder.
1862 wurde auf Combe-Varin ein wissenschaftlicher Kongress abgehalten. Unter den anwesenden Gelehrten befanden sich die Herren Liebig, Möhler, Schönbein, Merian. Die
Chemiker beschäftigten sich namentlich mit der von Schönbein gemachten Entdeckung, betreffend die Bildung des salpetersauren Ammoniaks und deren Bedeutung für die
Ackerbauchemie.[51] 1864 beherbergte Desor folgende Gelehrten: der Meteorologe Dove
aus Englands, der Pathologe und Kammerredner Birchow aus Berlin, Prof. Eisenlohr aus Karlsruhe der Reisende Moritz Wagner aus München, Direktor Bolley vom Polytechnicum in Zürich, Capt. Zickel,
der Direktor der artesischen Grabungen in der Sahara und Begleiter Desors und Eschers auf ihrer Reise in der Wüste. Debattiert wurde die wissenschaftliche Theorie über den meteorologischen
Zusammenhang zwischen der Sahara und der Gletscherwelt der Alpen, mit der sich u.a. auch das Jahrbuch des Schweizer Alpenclub auseinandersetzte.[50]
1868 erschien erstmals der Geologe Amanz Gressly, dessen Gedenkstein sich in der Verenaschlucht in Solothurn befindet. In diesem Jahr feierte der neuenburgische
Juraklub auf dem Landgut von Desor ein grosses Fest, an dem sich 800 Schulkinder aus den Bergen und Tälern Neuenburgs beteiligten.[52] Von 1878 bis 1880 traf sich in Combe-Varin die Kommission für die «Geologische Karte der Schweiz», um die dazu
ausgeführten Arbeiten definitiv zu genehmigen und abzuschliessen.
In der Allee, die zum Hause führt, und in dem anstossenden Wald war jedem Gast ein Baum gewidmet, in dessen Rinde der Name eingeschnitten wurde. Heute sind die Originalinschriften weitgehend
verblasst und mehrere Bäume verschwunden. Um die Erinnerung der Allee aufrecht zu erhalten, befinden sich die Namen der illustren Gäste an den Bäumen angebrachten Holzbrettern.
Ernst Schürch beschrieb das Haus 1957 im «kleinen Bund» mit den Worten: «Im umfangreichen Schatz an Briefen, die zum Haus gehören, sieht man Desors Bild, direkt und
im Spiegel der Besucher. Neun Gästezimmer tragen noch aussen an den Türen die Namen derer, die hier zeitweilig daheim waren. Am grössten Zimmer steht der Name «Parker».[40]
Die Bäume trugen damals die Namen folgender Gäste: [39]
Geologen, Paläontologen
Schweizer
Bernhard Studer
(1794-1887)
Peter Merian
(1795-1883)
Arnold Escher von der Linth
(1807-1872)
Oswald Heer
(1809-1883)
Amanz Gressly
(1814-1865)
Franz Vinzenz Lang
(1821-1899)
Isidor Bachmann
(1837-1884)
Francois-J. Pictet de la Rive
(1809-1872)
Alphonse Favre
(1815-1890)
Perceval de Loriol Le Fort
(1828-1908)
Deutsche
Wilhelm Philipp Schimper
(1808-1880)
Karl Ferdinand Roemer
(1818-1891)
Oscar Fraas
(1824-1897)
Karl Alfred Zittel
(1839-1904)
Franzosen, Belgier, Italiener
Edouard Collomb
(1796-1875)
Henri-Sébastien Le Hon
(1809-1872)
Antonio Stoppani
(1824-1891)
Briten
Charles Lyell
(1797-1875)
Thomas Wright
(1809-1884)
Andrew Crombie Ramsay
(1814-1891)
Amerikaner
James Hall
(1811-1898)
Josiah Dwight Whitney
(1819-1896)
Peter Lesley
(1819-1903)
Physiker
Wilhelm Friedrich Eisenlohr
(1799-1872)
Heinrich Wilhelm Dove
(1803-1879)
Per Adam Siljeström
(1815-1892)
John Tyndall
(1820-1893)
Eduard Hagenbach-Bischoff
(1833-1910)
Chemiker
und Ärzte
Friedrich Wöhler
(1800-1882)
Justus Liebig
(1803-1873)
Heinrich Will
(1812-1890)
Rudolf Virchow
(1821-1902)
Jacob Moleschott
(1822-1893)
Naturforscher, die vom Ausland in die Schweiz kamen
a.) Geologen
Edouard Desor
(1811-1882)
Gottfried Ludwig Theobald
(1810-1869)
Heinrich Gerlach
(1822-1871)
b) Glaziloge
Daniel Dollfuss-Ausset
(1797-1870)
c) Chemiker
Christian Friedrich Schönbein
(1799-1868)
Pompejus Alexander Bolley
(1812-1870)
d) Zoologe
Carl Vogt
(1817-1895)
Astronom
Adolphe Hirsch
(1830-1901)
Geodäten und Ingenieure
Johann Jakob Bayer
(1794-1885)
Hermann Siegfried
(1819-1879)
Edouard Zickel
(-- - --)
Botaniker, Zoologen,
Geographen
Charles Martins
(1806-1889)
Adolfo Targioni Tozzetti
(1823-1902)
Ferdinand Krauss
(1812 - 1890)
Theodor von Siebold
(1804-1885)
Moritz Wagner
(1813-1887)
Pfahlbauforscher,
Prähistoriker
Gabriel de Mortillet
(1821-1898)
Giovanni Gozzadini
(1810-1887)
Giovanni Capellini
(1833-1922)
Neuenburger
a) Naturforscher
Charles-Henri-Godet
(1797-1879)
Célestin Nicolet
(1803-1871)
Louis de Coulon
(1804-1894)
Léo Lesquereux
(1806-1889)
Arnold Guyot
(1807-1884)
b) Kunstmaler, Historiker,
Statistiker
Fritz Berthoud
(1812-1890)
Charles Clément
(1821-1887)
Auguste Bachelin
(1830-1890)
Louis Guillaume
(1833-1924)
c) Politiker
Aimé Humbert
(1819-1900)
Zélim Perret
(1823-1889)
Bundesräte
Jakob Dubs
(1822-1879)
Carl Schenkel
(1823-1895)
Wilhelm F. Hertenstein
(1825-1888)
Josef Zemp
(1834-1908)
Eugène Borel
(1835-1892)
Numa Droz
(1844-1899)
Freiheitsfreunde
und Erzieher
Charles Reinwald
(1812-1891)
Jakob Venedey
(1805-1871)
Hans Lorenz Küchler
(1808-1859)
Theodor Parker
(1810-1860)
Joseph Lyman
(-- - --)
Augustin Keller
(1805-1883)
Ferdinand Buisson
(1841-1932)
Unbestimmte
77) H. W. Dreier
78) Müller
79) Stehelin
80) Zahn
Bildergalerie der «Allee der Naturalisten» in Combe-Varin, Zustand 2023.
Mit Texten von Wissenschaftshistoriker Heinz Balmer (1928-2016).[39]
Edouard Desor verband seine wissenschaftlichen Leistungen mit der schweizerischen naturforschenden Gesellschaft, wo er die offizielle geologische Karte
mitgestaltete. Zu seinen Kollegen gehörte Bernhard Studer, der Basler Peter Merian (1795-1883) und Escher von der Linth (1807-1872). Mit dem Letzteren unternahm er im Winter 1863/64 eine Reise
nach Algerien und in die Sahara. Desor unterschied drei Arten von Wüsten, die der Plateaus, die Erosionswüste und die Dünenwüste.
Für seine Studien von Seeigeln, für die Desor zahlreiche Sammlungen in Europa besuchte und die in sein Buch «Synopsis de échinides fossiles» einflossen, ernannte ihn die Universität Basel 1860
zum Ehrendoktor.
In Neuchâtel war Desor an der Bergung keltischer Funde aus La Tène beteiligt, die dann einem Abschnitt der Eisenzeit ihren Namen gaben. Auf Vorschlag Désors wurde später diese Periode in eine ältere Hallstatt- und eine jüngere La Tènezeit unterteilt.[42]
Entdecker von Pfahlbauten
Ein besonderes Interesse wendete er den Pfahlbauten und den prähistorischen Forschungen zu. Die Umgebung des Hauses, welches Desor in der Stadt Neuchâtel besass und zur Winterszeit bewohnte, diente ihm als Beobachtungsfeld. 1858 waren zuerst Oberst Schwab, Gründer vom Neuen Museum Biel (NMB), und dann Edouard Desor an der Bergung keltischer Funde in einer Untiefe (La Tène gennant) bei Marin beteiligt, die dann einem Abschnitt der Eisenzeit ihren Namen gaben. Dies geschah vor der Juragewässerkorrektion, als der Neuenburger See 2,10 Meter höher stand, also La Tène völlig unter Wasser lag. Desor wies die Funde chronologisch der Eisenzeit zu, sozusagen als Bindeglied zwischen den Pfahlbaufunden der Bronzezeit und den Hinterlassenschaften der Altertümerfischerei.[53] Die Fundgegenstände der beiden Forscher wurden an der Weltausstellung 1867 in Paris gezeigt. Der schwedische Gelehrte H. Hildebrand brachte 1874 am Kongress in Stockholm den Vorschlag Desors vor, die Eisenzeit in zwei Gruppen zu trennen: in eine ältere Hallstatt und in eine jüngere La Tènezeit.
Erst nach der Juragewässerkorrektion konnte La Tène in seinem ganzen Umfang erforscht werden. Dabei wurde festgestellt, dass es sich nicht um Pfahlbaustation handle, wie Desor und Schwab angenommen hatten, sondern um eine Kultur, welche mit den Pfahlbauten in keiner Beziehung stand. Die Sammlung des Bielers Oberst Friedrich Schwab, bezeichnete Desor in seiner 1864 erschienenen Schrift «Constructions lacustres du Iac de Neuchâtel» als «la plus riche collection de toutes». An den internationalen prähistorischen Kongressen war er ein regelmässiger Teilnehmer, darunter Neuchâtel (1866), Paris (1867), Kopenhagen (1869), Brüssel (1871) und Stockholm (1875).[49]
Beziehungen zum Kaiser Napoleon III
Desor wurde 1864 von Kaiser Napoleon gebeten, seine keltisch-helvetischen Altertümer, d. h. seine Sammlung aus der Eisenperiode, die namentlich prachtvolle Waffen
enthält, für 40,000 Fr. abzukaufen. Napoleon III. wünschte sie für seine Geschichte Cäsars zu benützen. Desor ging auf den Antrag nicht ein, dagegen überliess er dem Kaiser Doubletten. Als
Gegenleistung wollte Desor für die Neuenburger Stadtbibliothek und die kantonale Sternwarte eine Anzahl naturwissenschaftlicher Bücher. Napoleon war einverstanden. Der Kaiser wünschte sich
allerdings dazu, von den unverkäuflichen Altertümern Gypsabdrücke nehmen zu lassen. Als Geschenk erhielt Desor von Napoleon Abgüsse einer Waffensammlung und andere Gegenstände, die in den Ruinen
von Alesia gefunden wurden. Am 10. August 1865 präsentierte Desor in Fleurier die von Napoleon erhaltenen Wurfgeschosse aus der altgallischen Zeit und aus der etruskischen Epoche. Friedrich von
Mülinen, Professor für Schweizergeschichte an der Uni Bern: «Desor zeigte uns, wie man diese alten Waffen handhaben und werfen müsse. Mir war es aber oft Himmelsangst, dass das gefährliche
Instrument ihm entgleiten und den Zuhörern an den Kopf fahren könnte, was freilich für die Getroffenen nicht sehr angenehm gewesen wäre.» 1866 vermachte Napoleon Desor eine Luxusausgabe über das
Leben Cäsars. 1869 beglückwünschte Napoleon ihn zu seinen Erläuterungen über den Tumulus von Favargettes. Desor war der Ansicht, dass das alte Alesia von Cäsar nicht bei Besançon, sondern in
Burgund gelegen sei.
Nachdem 1865 Travers von einem Brand heimgesucht wurde, organisierte die Stadt Neuchâtel eine Ausstellung ein, dessen Erlös des Eintrittsgeldes den Opfern zukam.
Desor zeigte darin seine Pfahlbauten-Sammlung und brachte den Besuchern die Kulturepoche der Stein-, der Bronze- und der Steinzeit näher.
Desor, der Politiker
Edouard Desor wurde Mitglied und Präsident des Grossen Rates von Neuenburg, 1866 bis 1869 Ständerat und danach bis 1875 Nationalrat. 1878 lehnte Edouard Desor
krankheitsbedingt eine Wiederwahl in den Nationalrat ab.
Eine grosse Uhrenaussstellung
An der 1866 in Neuchâtel stattgefundenen Versammlung der Handels- und Industriegesellschaft schlug Edouard Desor vor, in der Stadt eine «permanente Uhrenausstellung»
zu erstellen, welcher als Zentralpunkt der neuenburgischen Uhrenmacherei dienen soll.[54]
Gründer der zweiten Universität von Neuchâtel
1838 wurde in Neuchâtel die Akademie ins Leben gerufen, welche 1840 ihre Tätigkeit begann und an der die Naturforscher Louis Agassiz und dessen Jugendfreund Arnold H. Guyot als Lehrer wirkten. Zusammen mit Edouard Desor sollte das Buch «Systeme Glaciare» erscheinen, doch verhinderte die Revolution von 1848 die Herausgabe des Buches und bewirkte das Eingehen der Akademie von Neuchâtel. Diese Aufhebung wollte Desor durch seine energische Initiative wieder herstellen. 1864 machte Edouard Desor in seiner Funktion als Präsident vom Neuchâteler Grossrat folgenden Antrag: «Der Staatsrat wird eingeladen, einen Gesetzesvorschlag für Organisation des höheren kantonalen Unterrichts einzubringen. Die Kosten der neuen Anstalt werden Mithilfe desjenigen Ortes, wo die höhere Schule ihren Sitz haben wird, vom Staat getragen.» Bei Begründung dieser Motion bemerkte Desor, der Staat Neuenburg leiste gegenwärtig gar nichts für den höheren Unterricht; die bestehenden Anstalten, wie das Gymnasium in der Stadt Neuchâtel, das Institut Roulet usw. seien lediglich Privatinstitute. Desor bedauerte, dass eine der ersten Handlungen der Republik die Aufhebung der Akademie gewesen sei. Er, der kein Mann der Politik und der politischen Parteien sei, habe sich nur deshalb in den Grossrat wählen lassen, um auf das Ziel hinzuarbeiten, die Akademie wiederzueröffnen. Desors Motion wurde einstimmig angenommen. Die Studierenden von Neuchâtel bedankten sich bei ihm mit einem Fackelumzug.[56] 1866 konnte die neue kantonale Akademie eröffnet werden. Desor wurde Präsident vom akademischen Rat und wirkte an der Akademie als Lehrer für Geologie und Paläontologie in der faculté des sciences. Er demissionierte 1868. Die Umwandlung der Akademie in eine Universität erfolgte 1909.
Seine letzten Jahre
Nach seinem Rücktritt aus dem Nationalrat behielt er die seit Jahren bekleidete Stelle eines Mitgliedes des eidgenössischen Schulrates bei. Als in Neuchâtel , in Folge des Vortrages Buisson's über den Religionsunterricht in der Schule, die kirchliche Reformbewegung in Gang kam, wurde Desor zu einem eifrigen Mitstreiter der Reformpartei.
Desors letzte Jahre waren von gesundheitlichen Problemen überschattet. Er machte es sich zur Gewohnheit, Kurorte (Bex, Carlsbad) zu besuchen oder den Winter in Südfrankreich zu verbringen. (48) Als er am 23. Februar 1882 in Nizza starb, hatte er sein Ziel, die «Förderung der Wissenschaften», erreicht. Sein Vermögen betrug etwa eine halbe Million Franken. Da er unverheiratet war, wurde es für Gemeinnützige Zwecke eingesetzt: für Legate, Geschenke und lebenslängliche Renten, letztere zu Gunsten seiner Dienstboten und Arbeiter (so z. B. für denjenigen, der im See nach Pfahlbauten gruben); auch wurden Schulen (10‘000 Mark für eine Schule in Friedrichsdorf) und Ferienkolonien bedacht. Von seinen Freunden hatte Eugen Borel den Landsitz von Combe-Varin erhalten, Fritz Berthoud eine Feder, welche Desor von seinem berühmten Freunde Theodor Parker erhalten hatte, «die kostbarste meiner Reliquien», wie er zu sagen pflegte, der Romanschriftsteller L. Favre ein von der hervorragenden Künstlerin Favre gemaltes Bild, Numa Droz ein Möbel usw. Die Hauptsumme wurde der Gemeinde Neuenburg geschenkt mit der Bestimmung, die ihr ebenfalls vermachten wissenschaftlichen Sammlungen zu erhalten und zu ergänzen und unter Umständen zu diesem Zwecke auch ein Museum zu bauen.[49]
Erinnerungen
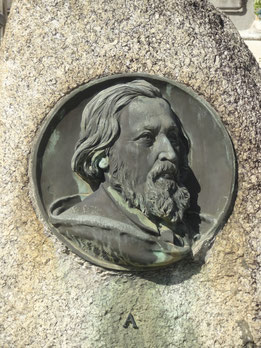
Die Stadt Neuchâtel benannte eine Strasse nach ihm und liess auf dem Grabe des verstorbenen Gelehrten in Nizza ein Denkmal erstellen.
Der Sockel besteht aus rotem Alpenmarmor (aus Arvel in Wallis), worauf ein Jura-Granit ruht, mit eingelegtem Bronze-Medaillon, das den Kopf des gelehrten Professors
darstellt. Unterhalb desselben liest man folgende Inschrift in Bronze: «Dem Geologen Edouard Desor, 1811 bis 1882, die Stadt Neuenburg (Schweiz).» Die Ausarbeitung des Denkmals ist von Leo
Chatelain und das Medaillon das Werk des Bildhauers Jguel. Der Alpenmarmor und der Granit des Jura, aus dem das Denkmal besteht, erinnern an die Orte, in denen der Geologe gearbeitet und
geforscht hatte. Die Form des Steinblocks spielt aus seine Studien aus der vorhistorischen Zeit an. Graveur F. Landry wurde ausserdem vom Stadtrat mit der Herstellung eines Ehren-Medaillons
beauftragt.[41] Die Vorderseite zeigt den Kopf des Gelehrten mit der Inschrift: «Edouard Desor 1811-1882», die Rückseite
trägt die Worte: «La ville de Neuchâtel reconnaissante 1883». Das ethnographische Museum von Neuchâtel benannte einen Saal nach ihm. Ebenfalls ehrte man ihn in Neuchâtel mit dem heute nicht mehr
existierenden «Jardin Desor», in dem 1890 die kantonale Gartenbauausstellung stattfand.
Die 1866 als zweite Akademie eröffnete Universität Neuchâtel.
Gesamtansicht vom damaligen «Jardin Desor». Foto: Bildarchiv der ETH-Bibliothek Zürich, Public Domain
Die Edouard-Desor-Strasse in Neuchâtel.
Durch die Initiative von Louis Agassiz wurde der «Pierre-à-Bot» als erster erratischer Block der Schweiz 1838 unter Schutz gestellt.
Der Granitblock trägt u. a. den Namen von Edouard Desor.
Die naturforschende Gesellschaft von Neuchâtel hatte 1898 auf dem Granitblock Pierre-à-Bot die Namen von vier hervorragenden Naturforschern eingravieren lassen: «Louis Agassiz, Arnold Guyot, Edouard Desor und Léon DuPasquier», in Erinnerung an deren Forschung über die Eiszeit. Die Inschrift wurde 1966 durch eine Gedenktafel ersetzt. Als 1877 Kaiser Don Pedro d‘Acantara von Brasilien in Neuchâtel weilte, zeigte ihm Desor den Findling Pierre-à-Bot». In Friedrichsdorf erinnern eine Strasse und ein Gedenkstein an Edouard Desor.
Schriften (Auswahl): Du climat des Etats-Unis et de ses effets sur les habitudes et les mœurs (1835), Journal d’une course faite aux glaciers du
Mont Rose et du Mont Cervin en société de MM. Studer, Agassiz, Lardy, Nicolet et autres (1840), Excursion et séjour de Mr. Louis Agassiz sur la mer de glace du Lauteraar et du Finsteraar : en
société de plusieurs naturalistes (1841), Die Besteigung des Jungfrauhorns durch Agassiz und seine Gefährten (1842), Ascension du Schreckhorn (1843), Compte rendu des recherches de M. Louis
Agassiz pendant ses deux derniers séjours à l’Hôtel des Neuchâtelois, sur le glaciers inférieurs de l’Aar, en 1841 et 1842 (1843), Topographe du Wetterhorn et des massifs environnants (18--),
Agassiz geologische Alpenreise (1844), Nouvelle excursions et séjours dans les glaciers et les hautes régions des Alpes, de M. Agassiz et de se compagnons de voyage (1845), Embryology of Nemestes
(1848), Mémoire sur les phénomènes erratiques de la Suisse comparés à ceux du nord de l’Europe et de l’Amérique (1852), De l’esclavage aux Etats-Unis à l’occasion de La case de l’oncle Tom (Uncle
Toms’ cabine), par Mad. H. Stowe-Becher (1853), Les cascades du Niagara et leur marche rétrograde (1854), Le Val d’Anniviers (1855), Les plissements du Val-de-Travers (1855), L’orographie du Jura
(1856), Note sur la classification des cidarides (1856), Note sur le tunnel du Hauenstein et les difficultés qui s’y rencontrent (1856), Le pays d’Appenzell à propos de la réunion des
naturalistes suisses à Trogen (1857), Introduction à l’étude des échinides fossiles et réponse à M. Agassiz (1858), Les sources du Jura : Fragment (1858), Etudes géologiques sur le Jura
neuchâtelois (1859), De la physionomie des lacs suisses (1860), Quelques considérations sur le classification des lacs (1861), Album von Combe Varin : zur Erinnerung an Theodor Parker & Hans
Lorenz Küchler (1861), Résultats des dernières fouilles sur les constructions lacustres (1862), De l’orographie des Alpes dans ses rapports avec la géologie: avec une carte des Alpes (1862), Die
Pfahlbauten des Neuenbuger Sees (1863), Un voyage d’exploration scientifique au désert du Sahara algérien (1864), L’âge du fer dans les constructions lacustres du lac de Neuchâtel (1864), La
Kabylie et les Kabyles: esquisse géologique et géographique (1864), Sur l’étage Dubisien (1864), Les emposieux de la vallée des Ponts (1864), Fische im Brunnen (1864), Der Gebirgsbau der Alpen
(1865), Aus Sahara und Atlantis : vier Briefe an J. Liebig (1865), Les palafittes ou constructions lacustres du lac de Neuchâtel (1865), Die Sahara: ihre Beziehung zu dem Alpen-Klima und der
früheren Ausdehnung der Gletscher (1865), Discours d’ouverture du premier Congrès paléoethnologique tenu à Neuchâtel des 24, 25, et 26 août 1866 (1866), Les phases de l’époque antéhistorique
(1866), Über die Dolmen, deren Verbreitung und Deutung (1866), Die Pfahlbauten des Neuenburger Sees (1866), L’hôtel des Neuchâtelois sur le glacier de l’Aar : notices publiée dans le No de
Juillet du Musée neuchâtelois (1867), Présomptions en faveur d’un ancien niveau plus bas des lacs de Neuchâtel, Bienne et de Morat (1868), Le Tumulus des favargettes au val-de-Ruz (1869),
Souvenirs du Danemarck : le congrès anthropologique, et préhistorique de Copenhague en 1869 (1870), Notice biographique sur Célestin Nicolet: dans sa réunion générale annuelle au Locle, le 19
juin 1871 (1871); Essai d’une classification des cavernes du Jura (1871), Die Moränen-Landschaft (1874), Le bel-âge du bronze lacustre en Suisse (1874), Ein Blick in die Eiszeit: Brief an Pfr.
Bitzius (1875), Notice sur un mobilier préhistorique de la Sibérie (1875), Compte-rendu d’une excursion faite à une ancienne nécropole des Monts Albins recouverte par un dépôt volcanique (1877),
Une nouvelle découverte préhistorique. La fonderie de Bologne (1877), Essai sur le nez au point de vue anthropologique est esthétique (1878), La fôret vierge et le Sahara (1879), Les pierres à
écuelles (1879), Philipp Wilhelm Schimper: geboren den 12. Januar 1808, gestorben den 20. März 1880 (1880), Ossements humains trouvés dans le diluvium de Nice (1881), Im Urwald: Vortrag (1881),
Alter der Pfahlbauten aus der Steinzeit, der Bronzezeit, und der Eiszeit : Ursprung und Abstammung der Pfahlbauer (18--)
Philipp Wilhelm K
Quellen/Sources:1) Dr. F. Porchet, «Louis Agassiz: quelques souvenirs de sa jeunesse» in Bulletin de la Société Vaidoise des Sciences Naturelles, Nr. 160, 1907, S. 303ff ; 2) Louis Favre, «Louis Agassiz - son activité à Neuchâtel comme naturaliste et comme professeur de 1832 à 1846» in Bulletin de la Société des Sciences Naturelles de Neuchâtel, Nr. 12, S. 355ff ; - 3) Isaline Deléderray-Oguey, Chantai Lafontant Vallotton, «Échange autour de l'Espace Louis-Agassiz à Neuchâtel, devenu Espace Tilo-Frey» in Travers, Nr. 3, 2019, Chronos Verlag Zürich, S. 183ff ; - 4) ohr., Zentenarfeier des Naturhistorischen Museums der Harvard-Universität in Die Tat, Zürich, 14. 11. 1959, S. 18; - 5) Dr. W. Emsmann, «Louis Agassiz» in Deutsche Warte, Band 6, Karlsruhe, 1874, S. 41ff; - 6) Dr. F. Steindachner, Almanach der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Wien, Wien, 1874, S. 152ff); - 7) Agassiz in Boston, Beilage zur Allgemeinen Zeitung, Stuttgart, 27. 5. 1847, S. 1169; 8) Elisabeth Cary Agassiz, Louis Agassiz’s Leben und Briefwechsel, Berlin 1886, S. 1ff. - 9) Christoph Lörtscher, Dufour Ost und Dufour West: 660 Jahre Stadtgeschichte: Biel, 12. 3. 2000; - 10) Insbrucker Nachrichten, 19. 6. 1873, S. 1695; - 11) Clara Conant Gilson, Agassiz at Cambridge - a paper of personal reminiscences, S. 741ff; - 12) Schülerverzeichnis vom Gymnasium Biel 1817-1834, Stadtarchiv Biel, Sig, AB. 117.131; - 13) «Agassiz und die Lawrence-Scientific-School in Cambridge» in Beilage zur Allgemeinen Zeitung, Nr. 12, 12. 1. 1848; - 14) Mary Anning, Wikipedia.org, abgerufen 2023; - 15) Hippeau, L’instruction publique aux Etats-Unis, rapport adressé au Ministre, Paris, 1872, S. 227 ; - 16) Gerhard Kohlfs, «Über Erziehung und Unterricht in den Vereinigten Staaten von Amerika» in Unsere Zeit, 14. Jahrgang, Este Hälfte, Leipzig 1878, S. 219 ; - 17) Adolphe Fischer, Louis Thévenaz, Le Pays de Neuchâtel, Neuchâtel 1948, S. 49ff ; - 18) «Arnold Guyot» in VII. Jahresbericht der Geographischen Gesellschaft von Bern, Bern 1884/1885, S. 6; - 19) Ernst Haeckel, Natürliche Schöpfungs-Geschichte, 8. Auflage, Berlin, 1889, S. 56ff: - 20) Dr. Graf, «Zum hundertjährigen Geburtslage von Louis Agassiz» in Der Bund, Bern, 9. 6. 1907, S. 6; - 21) «Professor Agassiz über die Schwarzen» in Neue Zürcher Zeitung, Zürich, 16. 4. 1873, S. 2 / Illustrierter Kalender, Leipzig, 1874, S. 74; - 22) Dr. Emanuel Roth, Die Tatsachen der Vererbung, Berlin 1885, S. 112; - 23) Louis Agassiz, Über die Verschiedenheit des Ursprungs der Menschen-Rassen, 1850, S. 36ff: - 24) The Collected Works of Theodore Parker, London, 1864, S. 166; - 25) Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel, Leipzig, 15.2.1935, S. 651; - 26) Serge Rubi, «Quand les préjugés se font scientifiques» in L'impartial, La Chaux-de-Fonds, 3. 7. 1995, S. 28: - 27) Hans Fässler, Wikipedia.org, abgerufen 2023; - 28) Marc Levy, «Baldwin Neighborhood name is approved 9-0, replacing Agassiz; second such change since ’15 », in cambridgeday.com, 15, 2. 8. 2021; - 29) www. eps.harvard.edu/louis-agassiz; - 30) Jake Wittich, Lakeview’s Agassiz School Ditching Name Of Racist Scientist, Set To Become Harriet Tubmann IB World School, www.blockclubchicago.org, 22. 3. 2021; - 31) «Harriet Tubmann» in Wikipedia.de; - 32) «Agassiz' Geburtsort und Jugendzeit» in Chronik der Stadt Zürich, Zürich, 15. 6. 1907, S. 271f: - 33) «Ein biographisches Werk über Carl Vogt» in Neue Zürcher Zeitung, Zürich, 4. 7. 1896, S. 2 - 34) «Louis Agassiz» in Schweizer Lehrerzeitung, Nr. 21, Zürich 1907, S. 202; - 35) Môtier-Vully: Feiern zu Ehren von Louis Agassiz in Freiburger Nachrichten, Freiburg, 7. 12. 1973, S. 13; - 36) «Agassizfeier» in Der Bund, Bern, 3. 6. 1907, S. 2; - 37) «Steine erzählen» in Hedwig Correvon, Oberländer Tagblatt/Thuner Stern, Thun, 16. 10. 1952, S. 4; - 38) Edouard Desor, Die Besteigung des Jungfrauhorns durch Agassiz und seine Gefährten, Solothurn, 1842, S. 73f; - 39) Heinz Balmer, «Edouard Desor und sein Landhaus Combe-Varin» in Gesnerus, Nr. 32, 1975, S. 61ff; - 40) Ernst Schürch, «Combe-Varin» in Der Bund, Bern, 29. 11. 1957, S. 5; - 41) Zuger Volksblatt, Zug, 14. 4. 1883, S. 2; - 42) Gletscherflöhe, Kelten und Seeigel – Universalgelehrter Édouard Désor (13.2.1811 - 1882), www.friedrichsdorf.de, abgerufen 10. 4. 2023; - 43) «Ein bibliografisches Werk über Carl Vogt» in Neue Zürcher Zeitung, Zürich, 4. 7. 1896, S. 1f, - 44) «Ein biographisches Werk über Carl Vogt» in Neue Zürcher Zeitung, Zürich, 6. 7. 1896, S. 1f; - 45) E. Desor. Lebensbild eines Naturforschers von Carl Vogt, S. 16; - 46) Carl Vogt, «Die Verantwortlichkeit des Korrektors» in Neue Zürcher Zeitung, Zürich, 15. 6. 1891, S. 2; - 47) Adolphe Ischer, Des Sciences dans les monts Jura, Cahiers du MHN No 6, Editions de la Girafe, La Chaux-de-Fonds, 1983, S. 32ff ; - 48) «Das Testament von Edouard Desor» in Neue Zürcher Zeitung, Zürich, 2. 3. 1882, S.2; - 49) Dr. Oscar Fraas, «Edouard Desor» in Kosmos - Zeitschrift für Entwicklungslehre, Nr. 1, Stuttgart, 1882, S.1ff; - 50) - Der Bund, Bern, 27. 9. 1864, S. 2; - 51) «Der wissenschaftliche Kongress auf Combe-Varin» in Der Bund, Bern, 24. 8. 1862, S. 3: - 52) «800 Kinder auf dem Landgut Desor» in Neue Zürcher Zeitung, Zürich, 6. 6. 1868, S. 4; - 53) Die Sammlung Schwab im NMB (Neues Museum Biel), Pädagogisches Material, PDF, 2022; - 54) «Uhrenausstellung in Neuenburg» in Intelligenzblatt für die Stadt Bern, 25. 11. 1866, S. 7; - 56) «Eine Sühne in Neuenburg» in Eidgenössische Zeitung, Bern, 21. 5. 1864, S. 1f; - 57) «The Plain Dealer, Renaming Cleveland schools to excise names of those complicit in slavery and oppression» in www. cleavaland.com, 9. 6. 2022; - 58) «Umbenennung der EGU-Louis-Agassiz-Medaille zu Ehren von Julia und Johannes Weertman» in www.egu.eu/news, 12. 2. 2019; - 59) «Statue of Louis Agassiz» in Wikipedia, abgerufen 2023; - 60) The Monoliths, Wikipedia.org, abgerufen 2023; - 61) «Agassiz Rock is renamed The Monoliths» in www. the trustesss.org, 24. 2. 2022; - 62) «Avenue Louis-Agassiz : pose d’une plaque d’information» in www,lausanne.ch; - 63) Philippe Godet, «Agassiz et Neuchâtel» in, La Suisse libérale, Neuchâtel, 13. 11. 1886, S. 1 ; - 64) www,southsideflagstaff.com/wilsonc-riles; -65) Knau Staff, Flagstaff Street To Be Named After African-American Educator And NAU Alum, www,knau.org, 2020; - 66) Dr. Otto Volger, «Das 50jährige Jubiläum der Eiszeitlehre» in Beilage der Münchner Allgemeinen Zeitung, 17., 18. 2. 1887; - 67) O. Büetschli, Zoologisches Zentralblatt, Leipzig, 1897, S. 15; - 68) «Das Schicksal eines deutschen Naturforschers unserer Zeit» in Unterhaltung am häuslichen Herd, Band 2, Leipzig, 1857, S. 410; - 69) Chr. Walkmeister, «Amanz Gressly, der Jura Geologe» in Bericht über die Tätigkeiten der St. Gallischen naturwissenschaftlichen Gesellschaft während des Vereinsjahres 1886/87, St. Gallen, 1888, S. 123f; - 70) C.-F. Girard, «Quelques souvenirs de la jeunesse d’Agassiz» in FAN - L'express, Neuchâtel, 20. 1. 1874, S. 2; - 71) Max Antenen, «Ehrenvoller Empfang in der Seeländer Metropole» in Bieler Jahrbuch 2008, Verlag Gassmann, Biel, S. 26; - 72) «Johann Conrad Appenzeller 1775-1850» in Sammlung bernischer Biographien, Band 1, Bern, 1884, S. 8; - 73) Johann Rudolf Schneider, Das Seeland der Westschweiz und seine Korrektur der Gewässer, Bern 1881, S. 14; - 74) Alexander Schweizer, Biografische Aufzeichnungen, von ihm selbst entworfen, Zürich 1888, S. 5ff; - 75) Paul Godet, «Le Prof. Louis Agassiz et le musée d'histoire naturelle de Neuchâtel» in Bulletin de la Société Neuchâteloise des Sciences Naturelles, Nr. 34, 1907, S. 288ff - 76) Cäsar Adolf Bloesch, Unglaube und Aberglaube in einer und derselben Lehre vereint, Bern, 1851, S.23f; - 77) Ph. N., M. Imhof, «Les 75 ans du Musée d'horlogerie» in FAN - L'express, La Chaux-de-Fonds, 25. 3. 1977, S. 6: - 78) «Museumsgeschichte», Pressemappe vom Musée international d’horlogerie (MIH), La Chaux-de-Fonds, 2017, PDF, S. 2ff; - 79) L’homme et le temps, musée international d’horlogerie La Chaux-de-Fonds, La Chaux-de-Fonds, Mai 1977, PDF S.4; - 80) Alphonse Petitpierre, Un demi-siècle de l'histoire économique de Neuchâtel 1791 - 1848, Neuchâtel, 1871, S. 263f ; - 81) Edouard Desor, «L’esclavage aux Etats-Unis à l’occasion de la case de l’oncle Tom (UncleTom’s cabine)». Extrait de la Revue Suisse, année 1853, S. 3ff, Schweizerische Nationalbibliotek Bern, Signatur A 1917; - 82) «Spiritualismus» in Neue Zürcher Zeitung, Zürich, 17. 8. 1857, S. 2 ; - 83) «Henry Wirz» in Thuner Wochenblatt, Thun, 9. 9. 1865, S. 2 ; - 85) «Agassiz über Fische als Nahrungsmittel» in Der Bund, Bern, 26. 5. 1868, S. 3; - 86) Louis Agassiz «Museum of Comparative Zoology» in The American journal of education, Band 9, London, 1860, S. 615; - 87) Kaspar Meuli, «1868 - das Hochwasser, das die Schweiz veränderte», Geographica Bernensia, Universität Bern, PDF, 2018, S. 7; - 88) «Agassiz» in Pennsylvania School Journal, Nr. 12, Juni 1874, S. 394; - 89) Lucy Allen Paton, «Elizabeth Cabot Agassiz; a biography». Boston, Houghton Mifflin Company, 1919 / Wikipedia, «Elizabeth Cabot Agassiz» , abgerufen 2023; - 90) John G. Whittier, «The Prayer of Agassiz», a poem, Cambridge, 1874; -91) Société neuchâteloise des sciences naturelles, «Quelques mots au sujet des musées de Neuchâtel» in FAN - L'express, 9. 3. 1927, S. 4; - 92) James Orton, The Liberal Education of Women, New York, 1873, S. 317ff; - 93) Martin Schwarzbach, Denkmäler und Gedenktafeln von Eiszeitforschern in Mittel-Europa, PDF 1981, S. 10; - 94) Jules Marcou, Life, Letters, and Works of Louis Agassiz, Band 1, New York/London, 1896, S. 10f; - 95) Ludwig August Frankl, Sonntagsblätter für heimatliche Interessen, Wien, 2. 10. 1842, S. 717; - 96) Alexander Winchell, Sparks from a geologist’s hammer, Chicago 1881, S. 19; - 97) «Weltberühmte Fossilien-Sammlung nun frei verfügbar», Museums d’histoire naturelle Neuchâtel / Wikimedia.ch, 2022; - 98) «Päpstliches Verbot» in Neue Zürcher Zeitung, Zürich, 18. 10. 1839, S. 498; - 99) «Agassiz über Verbot empört» in Der Schweizer Bote, Aargau, 22. 10. 1839, S. 543; - 100) Maria Helena Machado, «Travels and Science in Brazil», Online ReVista, Harvard Review of latin America, 15. 5. 2009: - 101) Briefe von Agassiz und König Friedrich Wilhelm, Annual Report of the Board of Regents of the Smithsonian Institution, Washington, 1876, S. 158f; - 102) M. de Tribolet, «Louis Agassiz et son séjour à Neuchâtel de 1832 à 1846», Verhandlungen der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft, Band 90, 1907, S. 12ff; - 103) Henri Rivier «La Société Neuchâteloise des Sciences Naturelles: 1832–1932», Bulletin de la Société Neuchâteloise des Sciences Naturelles, Band 56, 1931; - 104) «First women’s rights activists», Online, Womenhistoryblog.com, 2017 / «Pauline Agassiz Shaw» in Wikipedia.org, abgerufen 2023; - 105) «Elizabeth Cabot Agassiz, 1822-1907», Online, wanderwomenproject.com, abgerufen 2023; - 106) F. Romang, «Jakob Burkhardt (1808-1867)» in Sammlung bernischer Biographien, Bern, 1884, S. 328f; - 107) «David Starr Jordan», Online, en.wikipedia.org/wiki, abgerufen 2023 / «David Starr Jordan» in The Human Harvest, Boston, 1907, S. 5; - 108) Frank Stephan Kohl, Amazonasbilder 1868, Marburg, 2012, PDF, S. 78; - 109) «The death of Agassiz» in The American Journal of Science and Arts, Nr. 37, Januar 1874, S. 77ff: - 110) The World of Anecdote, Moral and Religious: A Collection of Illustrations, Philadelphia, 1880, S. 71; - 111) Arnold Guyot, Memoir of Louis Agassiz, 1807-1873, Princetin N. J., 1883, S. 15; - 112) Alexander Braun, Brief an seinen Vater, München, 18. 11. 1828; - 113) Dietrich Barth, Max Burckhardt, Olaf Gigon, Der Schweizerische Zofingerverein 1819-1935, Basel, 1935, S. 202; - 114) Le canton de Neuchâtel, revue historique et monographique des communes du canton de l’origine à nos jours, Le district de Neuchâtel, Neuchâtel 1898, S. 307ff: - 115) Louis Agassiz, Discours prononcés à l'inauguration de l'Académie de Neuchâtel le 18 novembre 1841, Neuchâtel, 1841, S. 30ff; - 116) «Kirchengeschichte» in Allgemeine Literatur Zeitung, Nr. 152, Junius 1827,S. 375; - 117) «Verzeichnis der Ehrengaben und Gewinner am Schiessen der Herren Studenten des medizinischen Institutes» in Zürcherisches Wochenblatt, 15. 9. 1825, S. 3; - 118) A. K., «Agassiz» in biblio.unibe.ch/digibern/dic hist biblio suisse/Agassiz Alpin Suisse 129 256, pdf, S. 114; - 119) Heinz Balmer, «Louis Agassiz, 1807-1873» in Gesnerus, Vierteljahrsschrift für Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften, Verlag Sauerländer Aarau, Band 1 u. 2, 1974, S. 1ff; - 120) «Jules Marcou» in wikipedia.org, abgerufen 11. 01. 2024; - 121) Book Reviews, A Monthly Journal, Band 4, Nr. 1, Mai 1896, S. 54ff; - 122) Louis Agassiz, Methods of Study in Natural History, 2. Auflage, Boston, 1864, S. 3ff
Postadresse: Altstadtleist Biel, Obergässli 11, 2502 Biel/Bienne. Lokal: Brunngasse 11, Tel. 032 323 42 84,
Öffnungszeiten auf Anfrage
Adresse postale: Guilde de la vieille ville, Ruelle du Haut 11, 2502 Biel/Bienne. Local: Rue des Fontaines 11, Tel: 032 323 42 84.
Heures d'ouverture sur demande.