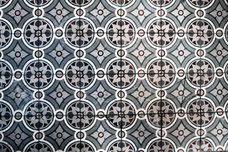- Brunngasse / Rue des Fontaines
- Burgplatz / Place du Bourg
- Burggasse / Rue du Bourg
- Jakob-Rosius-Strasse / Rue Jakob-Rosius
- Kanalgasse / Rue du Canal
- Kirchgässli / Ruelle de l'Eglise
- Obergasse / Rue Haute
- Obergässli / Ruelle du Haut
- Quellgasse / Rue de la Source
- Ring
- Römergässli / Rue des Romains
- Schmiedengasse / Rue des Maréchaux
- Untergasse / Rue Basse
- Untergässli / Ruelle du Bas
- Juravorstadt / Faubourg du Jura
- Mühlebrücke / Pont du Moulin
- General Dufour-Strasse / Rue du Général-Dufour
- Das Dufour Schulhaus - Überblick
- Das Dufour Schulhaus - Kloster und Spital
- Das Dufour Schulhaus 1818-1819
- Das Dufour Schulhaus - Abram-Emmanuel und Edouard Tièche
- Das Dufour Schulhaus 1818 - Louis Agassiz
- Das Dufour Schulhaus 1818 - Oberst Friedrich Schwab
- Das Dufour Schulhaus 1820-1827
- Das Dufour Schulhaus 1828-1835
- Das Dufour Schulhaus - Lehrer in geheimer Mission
- Das Dufour Schulhaus 1836-1838
- Das Dufour Schulhaus 1837 Jean Joseph Hisely
- Das Dufour Schulhaus 1839-1842
- Das Dufour Schulhaus 1843-1849
- Das Dufour Schulhaus 1845 Albert Friedrich Haller
- Das Dufour Schulhaus Kinder der Fabrik
- Das Dufour Schulhaus 1850-1869
- Das Dufour Schulhaus - Armin und Arnold Mueller
- Das Dufour Schulhaus 1870-1880
- Das Dufour Schulhaus 1881-1887
- Das Dufour Schulhaus 1885 - Hermann Aegler
- Das Dufour Schulhaus - Die Bieler Bijouteriefamilie Weber
- Das Dufour Schulhaus 1887 - Karl Walser
- Das Dufour Schulhaus 1888 Robert Walser I
- Das Dufour Schulhaus 1888 Robert Walser II
- Das Dufour Schulhaus 1888-1891
- Das Dufour Schulhaus 1891 Grock
- Das Dufour Schulhaus 1892 - Gottlieb Hauser
- Das Dufour Schulhaus 1892-1895
- Das Dufour Schulhaus 1896-1898
- Das Dufour Schulhaus 1893 - Eduard Amsler
- Das Dufour Schulhaus 1896 - Hermann Hubacher
- Das Dufour Schulhaus 1897 - Emil Meyer
- Das Dufour Schulhaus - Die Familie Lanz
- Das Dufour Schulhaus 1897 - Fritz Antenen
- Das Dufour Schulhaus 1899-1903
- Das Dufour Schulhaus 1904-1905
- Das Dufour Schulhaus 1902 Werner Bourquin
- Das Dufour Schulhaus 1902 - MAURICE UND ANDRÉ VAUCHER
- Das Dufour Schulhaus 1903 - Hans Zulliger
- Das Dufour Schulhaus 1903 - Hans Zulliger II
- Das Dufour Schulhaus 1905 - Karl Schoechlin
- Das Dufour Schulhaus 1906-1908
- Das Dufour Schulhaus 1908 - Hans Schoechlin
- Das Dufour Schulhaus 1909-1910
- Das Dufour Schulhaus 1951-2011
Das Dufour-Schulhaus / L' école Dufour 1818-1819

Das erste Bieler Gymnasium / Le premier gymnase biennoise 1817 - 1836
1815 wurden der Jura und Biel ein Teil des Kantons Bern und die Vereinigungsurkunde sah die Gründung eines Gymnasiums für den neuen französischsprachigen Kantonsteil vor. Bereits 1817 eröffnete man in Biel, einem Städtchen mit nicht ganz 3000 Einwohnern, das neue Gymnasium in den Räumen der Burgerschule an der Untergasse 8. 1818 fand es seinen Sitz im ehemaligen Spitalgebäude. Als 1836 die Berner Regierung das Bieler Gymnasium zum Progymnasium herabstufte, wurde das Gebäude zum Sitz weiterer Schulen.[4]
En 1815, le Jura et Bienne furent attribués au canton de Berne. L’acte de réunion prévoyait la création d’un gymnase pour la nouvelle partie francophone du canton. À
Bienne, on réagit rapidement à la question de l’implantation du gymnase et, en 1817, la ville inaugurait un nouveau gymnase dans les locaux de l’école des bourgeois à la rue Basse 8. En 1818, le
gymnase avait déjà son siège dans l’ancien couvent et l’hôpital dut être transféré à la rue Basse 45. En 1836 le gouvernement bernois, dans la foulée, dégrada le gymnase de Bienne qui devenait
ainsi le progymnase. Quant à l’ancienne commanderie de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem, elle devint le siège d’autres écoles.[4]
Vorgeschichte / Avant-propos
Ein Gymnasium für Biel
Die französische Besetzung (1798 bis 1815) war für das Bieler Schulwesen nicht förderlich. Gemäss Gesetz gab es in Biel zwar eine kommunale Primarschule und eine
Sekundarschule (mit den obligatorischen Fächern Latein, Französisch, Mathematik, Deutsch usw.). Da der Schulbesuch nicht obligatorisch war und der Gemeinde die nötigen Geldmittel fehlten, kam es
immer mehr zu einer Vernachlässigung des Schulwesens.[12] Am 20. März 1815 beschloss der Wiener Kongress die Vereinigung des ehemaligen Bistums Basel
und der Stadt Biel mit dem Kanton Bern, dessen Territorium in den Wirren der Revolution stark zusammengeschmolzen war. Unter den Anwesenden befand sich auch Georg Friedrich Heilmann, der
vergeblich versuchte Biel als selbständigen Kanton durchzusetzen.
Am 27. Mai desselben Jahres schloss sich die eidgenössische Tagsatzung der Erklärung des Wiener Kongresses an, und kurz darauf fand in Biel die Beurkundung dieses
Staatsvertrags durch eine von den beiden beteiligten Parteien zu gleichen Teilen ernannte Kommission statt. In Artikel 12 der Vereinigungsurkunde versprach die Berner Regierung dem reformierten
Landesteil eine höhere Lehranstalt, an der sich junge, zukünftige Theologen auf die Berner Akademie vorbereiten könnten.
Durch die Vereinigung erhielt die Stadt Biel zwei Sitze im Grossrat des Kantons Bern zu, vertreten durch die Grossräte Georg Friedrich Heilmann (1785-1842) und
Rudolf Neuhaus (1767-1846). Mit besonderem Eifer nahm sich Neuhaus der aufkommenden Schulfrage an. Im Frühling 1816 teilte er dem Kleinen Stadtrat mit, dass der Pfarrer Charles Ferdinand Morel (1772-1848) von Corgémont sich mit dem
Projekt eines in Courtelary zu errichtenden Kollegiums oder Instituts befasse, worauf die Ratskollegen, seine Mitteilung verdankend, ihn beauftragten, sein möglichstes zu tun, damit dieses
Etablissement nach Biel komme. Neben der Stadt Biel bewarben sich auch La Neuveville und das Erguel als Standort für die neue Schule. Als die Regierung wissen wollte, was Biel zu einer solchen
Schule beitragen wolle, wurden Rudolf Neuhaus und Samuel Perrot-Haag mit der Ausarbeitung des Projektes beauftragt. Der bernische Schultheiss von Mülinen besuchte den Lehrer und Pädagogen Conrad
Appenzeller in Brütten und forderte ihn dazu auf, einen detaillierten Plan für ein Gymnasium in Biel zu entwerfen und der Regierung in Bern vorzulegen. Das Projekt wurde am 11. September 1816 vom
Grossen und Kleinen Stadtrat gutgeheissen und am folgenden Tag der in Biel versammelten reformierten Geistlichkeit des Juras zur Begutachtung unterbreitet.[5]
1815
Un gymnase pour Bienne
L'occupation française (de 1798 à 1815) n'a pas été favorable au système scolaire biennois. Conformément à la loi, il existait certes à Bienne une école primaire et une école secondaire communales (avec les matières obligatoires que sont le latin, le français, les mathématiques, l'allemand, etc.) Mais comme la fréquentation de l'école n'était pas obligatoire et que la commune ne disposait pas des moyens financiers nécessaires, le système scolaire est devenu de plus en plus négligé.[12] Le 20 mars 1815, le Congrès de Vienne a décidé de réunir l'ancien évêché de Bâle et la ville de Bienne avec le canton de Berne, dont le territoire avait fortement fondu dans la tourmente de la révolution. Le 27 mai de la même année, la Diète fédérale s'est ralliée à la déclaration du Congrès de Vienne et, peu de temps après, une commission nommée à parts égales par les deux parties concernées a authentifié ce traité d'Etat à Bienne. Dans l'article 12 de l'acte de réunion, le gouvernement de Berne promettait à la partie réformée du pays un établissement d'enseignement supérieur où les jeunes futurs théologiens pourraient se préparer à l'Académie de Berne.
Ein Provisorium für 6 Jahre
Die Berner Regierung beschloss am 20. November 1816, durch Dekret und in Vollziehung der § 3 und 12 der Vereinigungsurkunde: «In der Stadt Biel soll auf eine Probezeit von 6 Jahren ein Gymnasium für die protestantische französische Geistlichkeit und für die wissenschaftliche Bildung junger Leute überhaupt errichtet und damit eine Pensionsanstalt verbunden werden.» Interessanterweise sprach das Dekret nicht mehr bloss von der Vorbereitung zukünftiger Geistlicher, sondern auch von der wissenschaftlichen Bildung junger Leute überhaupt.[5]
Die Stadt hatte das Gebäude samt Einrichtung zu beschaffen und einen jährlichen Beitrag von Fr. 1,600.- zu leisten, während die Regierung eine Jahressubvention von Fr. 4,000.- zusicherte.[2]
1816
Une solution provisoire pour 6 ans
A l'initiative des députés Georg Friedrich Heilmann et Rudolf Neuhaus, le gouvernement bernois décida en novembre 1816 de créer à Bienne, à titre d'essai et pour une
durée de 6 ans, un gymnase destiné à la population réformée du Jura-Sud (du Leberberg, comme le précise l'arrêté gouvernemental). L'écoutète bernois de Mülinen rendit visite à l'enseignant et
pédagogue Conrad Appenzeller à Brütten et l'invita à élaborer un plan pour un gymnase à Bienne et à le soumettre au gouvernement à Berne. Ce plan fut accepté, le gymnase fut fondé et le pasteur
Appenzeller fut nommé directeur à Bienne.
La ville devait se procurer le bâtiment et son équipement et verser une contribution annuelle de 1 600 francs, tandis que le gouvernement garantissait une subvention
annuelle de 4 000 francs. On pensa d'abord à utiliser l'ancienne mairie (devenue plus tard la brasserie Moll) comme bâtiment scolaire. Mais il s'est avéré qu'il avait besoin de beaucoup de
réparations. C'est pourquoi la municipalité, suivant les conseils des spécialistes de la construction, a finalement renoncé à ce projet et a installé l'école dans la rue Basse.[2] Comme les gymnases catholiques de Porrentruy et de Delémont, le gymnase de Bienne était placé sous la surveillance et la direction du Conseil de l'Eglise
bernoise.
Foto links: Die Pension der Witwe Blösch an der Obergasse 22. Rechts: Standort des Gymnasiums an der Untergasse 8.
Photo de gauche : La pension de la veuve Blösch à la Rue Haute 22. A droite : l'emplacement du gymnase à la Rue Basse 8.
1. Standort Untergasse
Man dachte zunächst daran, das alte Rathaus (später Brauerei Moll) als Schulgebäude zu nutzen. Es erwies sich jedoch als sehr reparaturbedürftig. Deshalb gab die Stadtverwaltung dem Rat der Baufachleute folgend, diesen Plan schliesslich auf und richtete das Gymnasium 1817 im Kabenschulhaus in der Untergasse 8 ein.[2] Der dort wohnende Lehrer E. König musste seine Wohnung räumen. Wie die katholischen Gymnasien in Pruntrut und Delsberg stand auch das Bieler Gymnasium unter der Aufsicht und Leitung des bernischen Kirchenrates.
Der Verwaltungsrat
Als die Berner Regierung das Statut der Anstalt erliess, nahm sie die Stadt Biel in die Mitverantwortung, indem sie ihre Behörden verpflichtete, einen fünfköpfigen Verwaltungsrat zu stellen. Dieser hatte die Aufgabe, die Organisation der Anstalt zu entwerfen, ihre Ziele zu bestimmen, die Lehrpläne aufzustellen, die Schulverwaltung durch ein Reglement zu umschreiben, die Wahl der Lehrkräfte vorzubereiten und für all dies den definitiven Regierungsbeschluss einzuholen. Die Hauptaufgabe des Aufsichtsrates sollte jedoch darin bestehen, die Umsetzung aller Vorschriften zu überwachen. Der unmittelbaren Aufsichtsbehörde der Schule, offiziell Verwaltungsrat genannt, eine Bezeichnung, die sich in Biel bis in die jüngste Zeit erhalten hat, gehört zuerst an: Oberamtmann von Fischer in Nidau von Amtes wegen, Amtsstatthalter Georg Friedrich Heilmann, der französische Pfarrer Charles-Victor Gibolet, Rudolf Neuhaus und Samuel Perrot-Haag.
1817
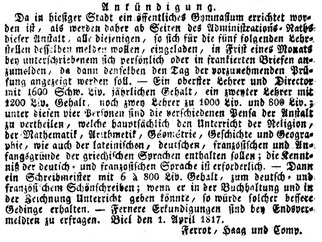
Lehrer gesucht
Das Gymnasium suchte am 1. April 1817 per Inserat: «Ein oberster Lehrer und Direktor mit 1600 Schw. Liv. jährlichem Gehalt, ein zweiter Lehrer mit 1200 Liv. Gehalt,
noch zwei Lehrer zu 1000 Liv. und 800 Liv.; unter diesen vier Personen sind die verschiedenen Pensum der Anstalt zu verteilen, welche hauptsächlich den Unterricht der Religion, der Mathematik,
Arithmetik, Geometrie, Geschichte und Geografie, wie auch der lateinischem, deutschen, französischen und Anfangsgründen der griechischen Sprachen enthalten sollen; die Kenntnis der deutsch - und
französischen Sprache ist erforderlich. - Dann ein Schreibermeister mit 6 à 800 Liv. Gehalt, für deutsches und französiches Schönschreiben; wenn er in Unterricht in Buchhaltung und Zeichnen geben
könnte, so würde solcher bessere Gedinge erhalten».
Für die 5 Lehrstellen hatten sich nicht weniger als 51 Bewerber aus dem In- und Ausland angemeldet. Die Wahl trug dem Administrationsrate eine Rüge ein des obersten Schulrates ein, weil er
entgegen § 5 obiger Instruktion von einer Prüfung der Bewerber Abstand genommen hatte. [5] Pfarrer Appenzeller wurde am 28. Januar 1817 als Direktor und
Lehrer für Religion, Gedächtnisübung, Logik, Geschichte, Geographie und Schreiben nach Biel berufen. Weitere Lehrer waren der Pfarrhelfer Molz (Latein, Griechisch, Deutsch), der Theologe
Johann Rickly (Französisch, Latein, Geschichte, Geographie, Geometrie), der Theologe Johann Jaques (Deutsch, Französisch, Latein) und der Bieler Kunstmaler Peter Girard (Schreiben, Zeichnen,
Singen).[2]
Verspätete Eröffnungsfeier in der Stadtkirche
Im Juli 1817 nahm die neue Anstalt in der Untergasse ihren Betrieb auf. Die feierliche Eröffnung fand jedoch erst am 15. September 1817 in der Kirche statt, da erst zu diesem Zeitpunkt das Lehrerkollegium vollständig war. Eine von Pfarrer Appenzeller gedichtete Strophe der in der Kirche gesungenen Melodien lautete:
«Unsere Schulen blühen wieder!
Wissenschaft den Geist erfreut!
Nun, wir säen, teure Brüder.
Samen für die Ewigkeit.»
Musikfreunde der Stadt und die Zöglinge der Erziehungsanstalt Zehnder in Gottstatt gestalteten den musikalischen Teil der Feier. Ein Mittagsesen im Gasthof zur Krone schloss die Feier ab. Der Rat spendierte den «Lehrknaben» auf Kosten der Stadt ein kleines Abendessen.[5]
Ablauf des Unterrichts
Das Gymnasium wurde eine Anstalt mit 6 Jahreskursen. Der reguläre Unterricht begann am 16. September mit 42 Schülern. Neben den Landeskindern wurde das Gymnasium von
Deutschen, Franzosen, Engländern und Italienern besucht. Die Schule sollte von Anfang an den Charakter eines humanistischen Gymnasiums mit altsprachlichem Schwerpunkt haben. Die Schüler erhielten
darum in 6 Jahreskursen durchschnittlich 9 Lateinstunden pro Woche. Es war keine leichte Aufgabe, die Schule mit wenigen Lehrern und unvollständigen Lehrmitteln zu führen. Alle Schüler (von 9 bis
18 Jahren) waren sozusagen auf dem gleichen Wissensstand. Die einen sprachen nur Deutsch, die anderen nur Französisch, wieder andere konnten beide Sprachen ohne sie grammatikalisch zu
beherrschen, oder sprachen den Dialekt des jeweiligen Ortes. Direktor Appenzeller löste das Problem, indem er die Schüler gleichzeitig beim selben Lehrer Deutsch, Französisch und Lateinisch
lernen liess. Sie beherrschten durch vielfache Wiederholung und Gedächtnisübungen bald die Formenlehre in drei Sprachen in Wort und Schrift. Wer aber nur eine Muttersprache beherrschte, musste so
lange Privatunterricht nehmen, bis er die andere Sprache soweit erlernt hatte, dass er dem Unterricht folgen konnte.
Der Religionsunterricht wurde für Deutsche und Welsche getrennt erteilt. Die christliche Glaubens- und Sittenlehre wurde nach dem protestantisch-reformierten Lehrbegriff vermittelt: für die
Welschen nach Osterwalds, für die Deutschen nach dem eingeführten Katechismus. Als Gedächtnisstütze dienten die sogenannten Quatrains moraux (Lausanne bei Hignou), in denen die Glaubenssätze der
Kirche in vierzeiligen Strophen überliefert sind. Die Berner Ausgabe der biblischen Geschichte in französischer und deutscher Sprache (Kinderbibel) wurde in beiden Klassen als historischer
Religionsunterricht verwendet. Später wurden mit ihnen auch einige Bücher des Neuen Testaments gelesen. Der Konfirmationsunterricht erteilten die Stadtpfärrer unabhängig vom Gymnasium.
Unterrichtet wurden auch Geographie, Schönschreiben und Rechnen. Wer an die Berner Akademie wechseln wollte, fand so leichter Anschluss.
Die Pension an der Obergasse 22
Von den 42 jungen Gymnasiasten wurden 10 Pensionäre von der verwitweten Marie-Louise Bloesch-Moser als Ökonomieverwalterin in ihrem Haus an der Obergasse 22 betreut. L
1817
1er emplacement Rue Basse
Le Gymnase de Bienne, une création quelque peu précipitée, mais géniale pour l'époque. Si d'une part on n'avait pas entrevu toutes les difficultés que devait rencontrer un gymnase bilingue, d'autre part le gouvernement bernois faisait preuve de libéralisme en ouvrant les études supérieures à toute une population qui en était plus ou moins exclue. Le premier conseil administratif, présidé par le bailli Friedrich Fischer, de Nidau, comprenait le pasteur français de la ville, Gibolet, le préfet Heilmann, Jean-Rodolphe Neuhaus et Samuel Perrot-Haag. Plus de 50 candidats se présentèrent aux cinq places de professeurs, et le pasteur Appenzeller fut appelé à la direction, un des promoteurs les plus éclairés de l'instruction publique à Bienne.
En 1817, les autorités municipales décident que le gymnase doit être provisoirement installé pour 6 ans dans l'école de garçons de la Rue Basse. La fête d'inauguration eut lieu le 15 septembre 1817 à l'église, et le lendemain, les cours commençaient avec 42 élèves, logés à la maison d'école de la rue Basse et dans des maisons particulières.
Déroulement de l'enseignement
Le gymnase est devenu un établissement avec 6 cours annuels. Les cours réguliers ont commencé le 16 septembre avec 42 élèves. Outre les enfants du pays, le lycée
était fréquenté par des Allemands, des Français, des Anglais et des Italiens. Dès le début, l'école devait avoir le caractère d'un lycée humaniste avec un accent sur les langues anciennes. C'est
pourquoi les élèves recevaient en moyenne 9 heures de latin par semaine dans le cadre de 6 cours annuels.
Ce n'était pas une tâche facile de gérer l'école avec peu d'enseignants et des outils incomplets. Tous les élèves (de 9 à 18 ans) se trouvaient pour ainsi dire au même niveau de connaissances.
Certains ne parlaient que l'allemand, d'autres que le français, d'autres encore connaissaient les deux langues sans pour autant les connaître grammaticalement ou parlaient le dialecte de leur
localité. Le directeur Appenzeller a résolu le problème en faisant apprendre aux élèves simultanément l'allemand, le français et le latin par le même professeur. Grâce à de nombreuses répétitions
et à des exercices de mémoire, ils maîtrisaient bientôt l'apprentissage des formes dans les trois langues, à l'oral comme à l'écrit. Mais ceux qui ne maîtrisaient qu'une seule langue maternelle
devaient prendre des cours privés jusqu'à ce qu'ils aient appris l'autre langue de manière à pouvoir suivre l'enseignement.
L'enseignement religieux était dispensé séparément pour les suisses allemand et pour les Romands. L'enseignement de la foi et des mœurs chrétiennes était présenté selon le concept d'enseignement
protestant réformé: pour les Romands selon Osterwald, pour les suisses allemands selon le catéchisme introduit. Les Quatrains moraux (Lausanne chez Hignou), dans lesquels les croyances de
l'Eglise sont transmises en strophes de quatre lignes, servaient d'exercice de mémoire. L'édition bernoise de l'histoire biblique en français et en allemand (Kinderbibel) a été utilisée dans les
deux classes comme cours de religion historique. Plus tard, certains livres du Nouveau Testament ont également été lus avec eux. L'enseignement de la confirmation était dispensé par les prêtres
de la ville, indépendamment du lycée.
On y enseignait également la géographie, la calligraphie et le calcul. Ceux qui souhaitaient intégrer l'Académie de Berne trouvaient ainsi plus facilement leur place.
2. Standort, ehemaliges Spital / 2ème emplacement, ancien hôpital
Am 21. März 1818 beschloss die städtische Exekutive, dass das Gymnasium von der Untergasse 8 in das ehemalige Kloster an der Hintergasse zu verlegen, wo es 19 Jahre blieb: Gegen den Wiederstand des Grossen Stadtrates, aber mit Unterstützung des Oberamtmanns von Fischer, erfolgte der Umzug im Herbst 1818. Äusserlich brachte die Umnutzung vom ehemaligen Spital kaum bauliche Veränderungen mit sich. Auffallend war die über dem mittleren Eingang angebrachte schwarze Tafel mit der Aufschrift «GYMNASIUM» in goldenen Lettern. Darunter, im Rundbogen des Eingangs, prangte der ebenso gestaltete juvenalische Spruch. «NIL DICTU FOEDUM VISUQUE HAEC LIMINA TANGAT, INTER QUAE PEUER EST» («Nichts für Auge und Ohr Unreines betrete die Schwelle, wo ein Knabe eingeht»). Die Stadt Biel verpflichtete sich lediglich, das Dach und die Aussenmauern instand zu halten. Um das Gebäudeinnere besser dem neuen Zweck anzupassen, musste die Schulverwaltung unerwarteter Weise noch einige tausend Franken aufwenden.[9] Im ehemaligen Spital (später als Schulhaus Dufour-Ost bekannt) waren genügend Innenräume, Kräutergärten für die Kostanstalt und Platz für Turnübungen vorhanden.
1818
Das Gymnasium 1818, Ansicht Nordseite. Im Vordergrund der Hof (heute Dufourstrasse). Dahinter steht der grosse «rote Turm», worin die Bieler Kadetten ihr Zeughaus hatten. Rechts steht in der alten Ringmauer der Klosterturm. Der Hof wird 1863 von der Nordseite in die Südseite verlegt.
Reproduktion aus «Das alte Biel und seine Umgebung» von Emanuel Jirka Propper, Heinrich Türler, 1902
Photo du haut: Le gymnase en 1818 : vue du côté nord. Au premier plan, la cour (aujourd'hui rue Dufour). Derrière
se trouve la grande "tour rouge", où les cadets biennois avaient leur arsenal. A droite, la tour du couvent se trouve dans l'ancien mur du ring. En 1863, la cour est déplacée du côté nord vers le
côté sud.
Die Pensionsanstalt von Marie-Louise Blösch
Das Pensionat der Witwe Marie-Luise Blösch, die bis 1836 den Haushalt leitete, war nun im Obergeschoss untergebracht. Für Kost, Logis, Heizung, Beleuchtung, Wäsche und kleine Reparaturen zahlten
die kantonalen Pensionäre 17, die ausserkantonalen 21 Louis d’or pro Jahr. Die Höhe des Pensionpreises war auch Gegenstand von Beschwerden. So richteten am 9. Dezember 1822 mehrere Notablen und
Hausväter der Ämter Courtelary und Münster eine Eingabe an den Verwaltungsrat, in der sie die Herabsetzung des Kostgeldes für Landeskinder auf 12 Louis d’or verlangten. Weder in Delsberg noch in
Pruntrut wurde so viel bezahlt. Die Verwaltung trat auf eine Reduktion nicht ein.[5]
Die Schüler erhielten 4 Mahlzeiten:
Zum Frühstück Suppe oder Milch;
Mittagessen Suppe, Gemüse, Fleisch, Brot;
Abendessen Brot und Milch oder Obst;
Nachtessen Suppe, Gemüse, Fleisch, Brot.
Das Pensionat schreibt den Schülern folgende Ausstattung vor:
18 Taghemden
6 Nachthemden
16 Paar Strümpfe
2 schwarze Halsbinden
18 Nasentücher
2-3 Paar Schuhe
2 Paar Überstrümpfe
2 Paar Unterbeinkleider
2 vollständige Uniformen
1 hellblaue Mütze
1 Tschako
1 Paar Pantalons zum tanzen
Ihr Leben war nach folgender Tagesordnung geregelt:
5
6 ¾
8 - 12
12
13 - 16
16
17 - 20
20
21
Uhr
„
„
„
„
„
„
„
„
Aufstehen und 5 Minuten später Antreten im Arbeitszimmer; Gebet und Studium
Toilette
Unterricht
Mittagessen; frei bis 13 Uhr
Unterricht
Abendessen; frei bis 17 Uhr
Studium
Nachtessen: freie Beschäftigung innerhalb des Hauses bis 21 Uhr
Gebet und Lichterlöschen
Kein Schüler durfte ohne Erlaubnis des aufsichtführenden Lehrers das Haus oder dessen unmittelbare Umgebung verlassen. Die AufseherIn oder der Inspektor besassen
selbst wenig Bewegungsfreiheit, was durch den folgenden Brief, den Rickly am 21. August 1821 an Rektor Appenzeller richtete, treffend illustriert wurde: «J’ai l’honneur de vous prévenir que,
préférant les deniers de la liberté aux francs de l’esclavage, les connaissances aux écus sonnants, j’ai pris la ferme et inébranlable résolution de me décharger, une fois pour toutes, du poids
de la surveillance au premier avril prochain, de sortir é la même époque de la maison dans laquelle sous tous les autres rapports je me trouve parfaitement bien, et d’aller porter mes pénates je
ne sais trop encore où ni chez qui.»
Das Reglement verlangte vom Inspektor die Aufsicht über den körperlichen, sittlichen und wissenschaftlichen Zustand der Schüler. Er überwachte die Sauberkeit des Körpers und der Kleidung, behielt
sie beim Schlafengehen im Auge und verlangte, dass sie sich an die Regeln der Religion und des Anstands hielten. Er hatte die Arbeiten für die Schule zu beaufsichtigen und auch der Konversation
seine Aufmerksamkeit zu schenken, indem die Schüler abwechselnd 14 Tage deutsch und 8 Tage französisch sprachen. Von den drei Sonntagen waren zwei dem deutschen und einer dem französischen
Gottesdienstes gewidmet. Die Zahl der Pensionäre lag in der Blütezeit der Schule bei über 30, ging dann aber auf 20 zurück.[5] L
1818
Nouveau domicile - École Dufour
En 1818, le gymnase déménagea de la rue Basse 8 à la Hintergasse, où il resta 19 ans. Extérieurement, le changement d'affectation n'a guère entraîné de modifications architecturales. Cependant, la plaque noire portant l'inscription « GYMNASIUM » en lettres dorées, placée au-dessus de l'entrée centrale, attirait l'attention. En dessous, dans l'arc en plein cintre de l'entrée, trônait la devise juvénile tout aussi élaborée. «NIL DICTU FOEDUM VISUQUE HAEC LIMINA TANGAT, INTER QUAE PEUER EST» («Que rien d'impur pour l'œil et l'oreille ne franchisse le seuil où entre un garçon»). La ville de Bienne s'est seulement engagée à continuer d'entretenir le toit et les murs extérieurs. Pour mieux adapter l'intérieur du bâtiment à son nouvel usage, l'administration scolaire dut encore dépenser, de manière imprévue, plusieurs milliers de francs. [9] Dans l'ancien hôpital (connu plus tard sous le nom d'école Dufour-Est), il y avait suffisamment d'espaces intérieurs, de jardins d'herbes pour l'établissement de soins et de place pour les exercices de gymnastique.
Le pensionnat de Marie-Louis Bloesch
Dès 1818, le gymnase et le pensionnat - dirigé jusqu'en 1836 par Louise Blœsch - furent réunis à l'ancien couvent de la Hintergasse. Les conditions d'admission
n'étaient pas très sévères: connaissance de la lecture et de l'écriture en langue maternelle, les quatre règles d'arithmétique, à l'âge de 9 ans. Une centaine d'élèves fréquentèrent
l'établissement en moyenne pendant la Restauration. Les Bernois payaient un écolage mensuel de deux francs, les étrangers au canton cent francs par an ; ils étaient une vingtaine. Pendant que
nous en sommes à l'administration, disons que les maîtres étaient payés de 800 à 1200 francs, le directeur 1600 francs. Quant à l'enseignement, il comprenait les branches suivantes :
1° Langues allemande et française, écriture, diction, logique, style.
2° Ecriture allemande et française, dessin.
3° Arithmétique, géométrie, algèbre, mécanique, géographie, mathématique.
4° Géographie ancienne et moderne, histoire générale et histoire suisse, sciences naturelles élémentaires, éducation morale et religieuse, logique.
5° Latin et grec, préparation à l'académie.
6° Chant d'après les dispositions de l'enfant.
Die Schülerzahl wächst
Am 20. Oktober 1819 inserierte das Gymnasium: «Die Schülerzahl im Gymnasium ist so gewachsen, dass die angestellten 6 Lehrer nicht mehr ausreichen. Man verlangt daher noch einen Lehrer, der im Stande ist in der deutschen, französischen, lateinischen und griechischen Sprache Unterricht zu geben und nebenbei einige Kenntnisse in den mathematischen Wissenschaften, der Erdbeschreibung und Geschichte besitzt». Gesangslehrer wurde Xavier Dessirier (Besançon) und Sprachlehrer Friedrich Wünternitz (Reichenbach bei Leipzig).
1819
1819
Le nombre d'élèves augmente
Le 20 octobre 1819, le lycée publie une annonce : «Le nombre d'élèves du lycée a tellement augmenté que les six professeurs engagés jusqu'à présent ne suffisent plus. On demande donc encore un professeur capable de donner des leçons d'allemand, de français, de latin et des éléments du grec, et possédant en outre quelques connaissances en sciences mathématiques, en description de la terre et en histoire». Xavier Dessirier (Besançon) a été élu professeur de chant et Friedrich Wünternitz (Reichenbach près de Leipzig) professeur de langues.

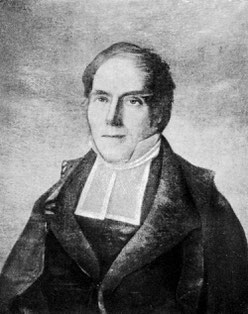
Johann Conrad Appenzeller (1775-1850), Direktor, Schriftsteller (Gertrud von der Wart)
Am Bieler Gymnasium von 1817 bis 1831
Fächer: Religion, Gedächtnisübung, Logik, Geschichte, Geographie, Schreiben.
Johann Conrad Appenzeller kam am 27. November 1775 in Bern zur Welt. Er war der Sohn des frommen St. Galler Kaufmanns Joseph Appenzeller. Bei der Taufe erhielt er die Vornamen Johann Conrad,
damit er durch die Initialen J. C. A. stets an «Jesus Christus, Amen» erinnert werde. Mit seiner Familie und den Dienstboten wurde jeden Abend die Hausandacht vollzogen. In seiner Kindheit las er
Gedichte, Trauerspiele und Rittergeschichten und übte sich im Zeichnen und Malen. Auch die Ausflüge, die er als kleiner Knabe mit seinem Vater ins Berner Oberland und ins Seeland unternehmen
durfte, sowie die Bekanntschaft mit den damaligen Berner Künstlern Freudenberger, König, Lory, Lafond und Rieter, weckten früh seine künstlerischen Anlagen. [47]
Appenzeller als Theologe
Im Alter von 10 Jahren zog er mit seiner Familie nach St. Gallen und besuchte die dortigen höheren Stadtschulen. Während seines Theologiestudiums fertigte er Schattenrisse an und verschaffte sich
so ein kleines Einkommen. Als die Wirren der Französischen Revolution die Schweiz erfassten, arbeitete Appenzeller von 1799 bis 1809 als Hauslehrer in Winterthur. Dort unterrichtete er Arithmetik
und Kalligraphie und gab er dem jungen Archäologen Ferdinand Keller Privatunterricht.[46] Appenzeller verband dies mit einer Anstellung als Sekretär des
bayerischen Salinen-Oberkommissärs Johann Sebastian von Clais (1742-1809) in der Villa Lindengut. Diesen begleitete Appenzeller bald darauf in das an Kunstschätzen reiche München. Hier
faszinierte ihn besonders der berühmte Karl von Eckartshausen (1752-1803), der unter anderem Geister beschwören konnte und dem Illuminantenorden angehörte. Der Orden unterstützte die Französische
Revolution und den Kampf gegen die katholische Kirche. Die Zauberworte «Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit» begeisterten auch ihn, so dass er sogar einige Lieder auf die Siege der
Revolutionsarmee dichtete. Appenzeller erkannte jedoch bald, dass sich die blendenden Freiheitsworte der Revolution in Unterjochung, Plünderung, Brandschatzung und Mord umschlugen.[47]
Auf der Heimreise in die Schweiz hörte Appenzeller in Innsbruck vom Loos der tapferen Nidwaldner. Die Trauerkunde veranlasste ihn zu einem in Posselt's Weltkunde und in Wielands neuem «Deutschen
Merkur» erschienenen, später vier stimmig komponierten Gedicht «Den Manen des gefallenen Volkes von Unterwalden nid dem Wald im September 1798.» Appenzeller wirkte dann an den Stadtschulen
Winterthurs, setzte seine theologischen Studien autodidaktisch fort und trat nach seiner in Schaffhausen bestandenen Prüfung in den geistlichen Stand ein.[46]
1809 wurde er vom Kloster Einsiedeln, als evangelisch-reformierter Pfarrer in das Bergdorf Brütten bei Winterthur gewählt. Damals ging es in dem abgelegenen Bergdorf noch sehr patriarchalisch zu:
In der Kirche sorgte der Schulmeister für Disziplin, indem er mit einer langen Haselrute die Köpfe der Unruhestifter bestrafte und die Unaufmerksamen zur Ordnung mahnte. In Appenzellers Haus
waren jeder willkommen: Künstler, Staatsmänner, Soldaten, Gelehrte, Industrielle, Dichter, Amtsbrüder, Arme, sogar ein politischer Flüchtling aus Deutschland und ein militärischer Deserteur aus
Frankreich. Zu den Persönlichkeiten, mit denen er korrespondierte, gehörten der Pferdemaler Conrad Gessner (1764-1826), Dichter David Hess (1770-1843) , Schultheiss Friedrich von Mülinen
(1760-1833), Kaufmann Johann Caspar Zellweger (1768-1855), Schriftsteller Heinrich Zschokke (1771-1848), Archivar Gerold Meyer von Knonau (1804-1858), der mystische Schriftsteller Johann Heinrich
Kung-Stilling (1740-1817), General Rudolf Ludwig von Erlach (1749-1808), Pater Gall Morel (1803-1872) und der Naturwissenschaftler Hans Conrad Escher von der Linth (1767-1823).[47] Am 16. Juni 1812 wurde Appenzeller in die Berner Regierung aufgenommen.
1818-
1831
Armenfürsorge
Die Teuerung der Lebensmittel des täglichen Bedarfs führte 1817 in Gais zu einer aufkommenden Hungersnot. Am 29. Juli richtete Appenzeller von Brütten aus einen Aufruf an die dortige
Kurgesellschaft, die Not der Bedürftigen durch Spenden zu lindern. Präsident Meyer von St. Gallen, Staatskassier und Regierungsrat Spöndli von Zürich unterzeichneten zusammen mit Appenzeller den
Aufruf. Andere schlossen sich dem Komitee an. Appenzeller und Spöndli reisten nach St. Gallen, um bei der dortigen Hilfsgesellschaft Reis und Brot zu kaufen. Mit weiteren Beiträgen kam bald eine
stattliche Summe zusammen. Am 31. Juli fand in der dem Gasthof zum Ochsen nahegelegenen Wohnung die erste Suppenausgabe statt. Sie bestand aus Reis und Fleisch. Am ersten Tag wurden 200 Portionen
ausgegeben. Später stieg die Zahl auf 266. Für die Ausgabe wurden Bezugsscheine ausgegeben. Die Bedürftigsten und am meisten Abgezehrten erhielten täglich eine Portion, die weniger Kranken jeden
zweiten Tag. [51]
Schriftstellerische Tätigkeiten
Appenzeller begann nun seine Tätigkeit als belletristischer Schriftsteller. Er veröffentlichte wertvolle Beiträge in den Jahrbüchern der Alpenrosen. Sein bekanntestes Werk «Gertrud von Wart» soll
er in zwei Wochen geschrieben haben. Es wurde ins Englische, Holländische und zweimal ins Französische übersetzt und 1894 in der «Encyclopaedia Britannica» erwähnt (S. 838). Grosse Beachtung
erhielt die Überarbeitung und Herausgabe von Johann Heinrich Mayrs «Schicksalen eines Schweizers während seiner Heise nach Jerusalem und dem Libanon» sowie durch die Herausgabe der Erzählungen
und Märchen der Bielerin Susanna Ronus (1769-1835) unter dem Pseudonym Selma. Auch seine «Wendelgarde von Linzgau» fand viele Leserinnen und Leser. [46] Den Erlös aus «Die Heimatlosen», das in
deutscher und französischer Sprache erschien, spendete er unglücklichen Familien. [49] «Der Mordbrand von Walperswil im Oberamt Nidau» enthält einen lithographierten Grundriss des Brandortes,
Aktennotizen, sowie zahlreiche Zeugenaussagen. Appenzeller: «Ein Ortsbürger namens Benedikt Maurer ermordete nach langer und ausgeklügelter Vorbereitung bei Einbruch der Dunkelheit seine Gattin
(Mutter von vier Kindern) und setzte gegen Mitternacht zahlreiche Bauernhäuser in Brand. Das Vieh war glücklicherweise auf der Weide und keine Person viel dem Brand zum Opfer.»
Rector gymnasii Biennensis
Durch die Wiener Kongressakte war die grössere Hälfte des ehemaligen Bistums Basel an den Kanton Bern gefallen. Schultheiss von Mülinen besuchte Appenzeller in Brütten und forderte ihn auf, einen
Plan für ein Gymnasium für Biel auszuarbeiten und der Regierung in Bern zu unterbreiten. Dieser Plan wurde angenommen, das Gymnasium gegründet und Pfarrer Appenzeller am 28. Januar 1817 als
Direktor und Lehrer nach Biel berufen. Die feierliche Eröffnung des Gymnasiums fand am Montag, 15. September 1817, in der Stadtkirche statt. Drei von Appenzeller gedichtete und nach bekannten
Melodien gesungene Lieder sorgten für Stimmung. Am Dienstag den 16. September, begann der Unterricht mit 42 Schülern, nachdem bereits seit Juli, bevor das Lehrerkollegium komplett war, einige
Lektionen erteilt worden waren. Appenzeller unterrichtete Religion (in deutscher Sprache), Gedächtnisübung, Logik, Geschichte, Geographie und Schreiben.[5]
Seinem pädagogischen Geschick war es zu verdanken, dass sich das Gymnasium unter seiner Leitung zu einer von der ganzen Schweiz besuchten Bildungsstätte entwickelte. Es wurde auch von Deutschen,
Franzosen, Engländern, Polen und Holländern besucht.
Die Probleme der städtischen Schulen führten dazu, dass Appenzeller 1819 beauftragt wurde, ein Gutachten zu erstellen. Er schlug vor, die untere Knabenklasse so einzurichten, dass sie auch als
Vorbereitungsanstalt für das Gymnasium dienen konnte. Dann entwarf Appenzeller eine neue Schulordnung und einen Lehrplan für die burgerliche Knabenschule. Die neue Schulordnung nannte die Schule
nun Elementarschule. Die Schulordnung wurde am 31. August 1822 vom Grossen Stadtrat genehmigt und am 1. Januar 1823 in Kraft gesetzt. Doch nun haperte es an der Umsetzung. Am 8. Juli 1823 schrieb
Appenzeller an den Stadtschreiber, dass die Schulordnung zwar seit einem halben Jahr in Kraft sei, aber nichts für ihre Ausführung getan werde. Die Ermahnungen der Geistlichen werden von Lehrern
und Schülern missachtet und verhöhnt, daher könne und wolle er für die Stadtschulen nichts mehr tun. Appenzeller machte in seinem Gutachten auch darauf aufmerksam, dass es kaum eine
protestantische Stadt in der Schweiz gebe, in der der Handarbeitsunterricht nicht einen Bestandteil der öffentlichen Mädchen-Erziehung bilde. Biel sollte dem Beispiel folgen und diesen Unterricht
aus dem Stadium eines privaten Wohltätigkeitsunternehmens in den Tätigkeitsbereich der ordentlichen Mädchenschulen überführen. 5 Jahre später wurde die Anregung umgesetzt. Ein Ratsbeschluss vom
7. Juli 1824 erklärte den Arbeitsunterricht für alle Mädchen vom 10. bis zum 14. Lebensjahr für obligatorisch.[5] Damit kehren wir zurück zum
Gymnasium.
1821 bemerkte Ida Fischer, die Tochter des Oberamtmanns von Nidau, gegenüber Appenzeller, dass das Kadettenkorps noch eine Fahne brauche. Appenzeller: «Sie lächelte und bat mich, ihr eine
Zeichnung zu machen, wie ich die Fahne wünsche; sie wolle dann gern das Ihre dazu tun. Der hier wohnende Maler Courvoisier übernahm die künstlerische Gestaltung. Meine beiden Töchter besorgten
das Zusammensetzen des roten und weissen Taffets in der Form des eidgenössischen Kreuzes, und Ida Fischer vollendete die Stickerei von Hand.»[5]
Mit seinen Schülern besuchte Johann Conrad Appenzeller 1822 das Schlachtdenkmal in Murten. Er beschrieb die Reise im illustrierten Kalender «Alpenrosen»: «Am Vorabend des 10.000 Rittertages, dem
21. Brachmonat des Jahres 1822, reisten wir, die Lehrer und Schüler des Gymnasiums zu Biel, über 80 an der Zahl, nach Kerzers, um am folgenden Morgen in aller Frühe den Jahrestag der Schlacht bei
Murten, am Fusse der neu errichteten Denksäule zu feiern. Bei unserer Rückkehr erhielten wir die Einladung, an der Preisverleihung der Schuljugend von Murten teilzunehmen. Wir wohnten in der
Kirche und um 9 Uhr morgens fand die Preisverleihung statt.»
Zu den Schülern von Johann Conrad Appenzeller gehörten u. a. Alexander Schweizer und die heute umstrittenen Naturforscher Arthur Gobineau und Louis Agassiz. 1822 erhielt Appenzeller aufgrund
eines Grossratsbeschlusses 50 Louis d’ors mit einem Begleitschreiben als Ausdruck der Anerkennung für seine Bemühungen bei der Gründung der Anstalt und für die ersten sechs Probejahre, welche die
Nützlichkeit dieser Institution bewiesen hätten.[48] Appenzeller schrieb 1823 in einem Bericht, dass in 5 Jahren über 200 Schüler durch die Anstalt
durchlaufen hätten. Ab 1829 versah er nur noch das Rektorat und den Religionsunterricht. In dieser Zeit erlebte das Gymnasium eine revolutionäre Zeit, die gezielt gegen Geistliche vorging, um sie
aus dem Schuldienst zu verbannen. Politischen Umtriebe und andere Umstände machten ihm ab 1830 das Leben schwer. 1831 verliess er das Gymnasium.[46] Nachdem
dessen Schliessung 1836, erteilte Appenzeller am neu eröffneten Progymnasium Religionsunterricht.
Primum pastorem Biennensis ecclesiae German
Vom 20. April 1818 bis zu seinem Tod war Appenzeller auch 1. Stadtpfarrers der deutschen Kirche in Biel. Das von Schultheiss und Schulrat am 20. September 1824 erlassene «Reglement für die
reformierte Geistlichkeit des Kantons» verlangte vom Pfarrer: dass er die Schulen regelmässig besuche; dem Schulkommissär bei der Prüfung der Bewerber um Lehrerstellen helfe; die Lehrer in ihrer
Amtsführung, in Sitte und Betragen überwache; mit der Methode im Allgemeinen und mit der jedes einzelnen Lehrers im Besonderen vertraut sei; keine anderen als die vom Kirchenrat genehmigten
Bücher zu dulden; bei den Schulvisitationen die Kinder zu ermuntern; die schlechten Schüler zu tadeln; sich zu erkundigen, ob alle Kirchengenossen ihre Kinder fleissig zur Schule schicken; die
Nachlässigen zu ermahnen und zu verwarnen und die Hartnäckigen dem Chorgericht anzuzeigen.[5] Appenzeller war zwar streng, aber er bevorzugte die Diplomatie.
1824 schrieb er für seine entlassenen Kommunikanten «Das Nahen zum heiligen Abendmahl».
1829 betreute Pfarrer Johann Conrad Appenzeller die Opfer des Mordbrandes von Madretsch. Die Täterin, Susanna Elisabeth Weyeneth, traf am Dienstagabend, 8. Dezember, in Nidau ein, um für ihr
Verbrechen zu büssen. Der Oberamtmann von Mülinen verkündete ihr am nächsten Tag vor zahlreichen Anwesenden das Todesurteil. Es wurde öffentlich auf einer Bühne vor dem Rathaus verlesen. Weinend
betete die 27-jährige Landarbeiterin auf den Knien. Währenddessen tröstete Appenzeller bei sich zu Hause die unglückliche Familie Gloor, die bei dem Brand ihre drei Kinder verloren hatte. Nachdem
dem Läuten der Armensünderglocke schritt die Angeklagte am 10. Dezember durch Madretsch zum Hochgericht, wo sie auf einem Scheiterhaufen an den Pfahl gebunden, erwürgt und dann verbrannt
wurde.[54]
Ab 1831 widmete er sich nur noch dem Predigtamt, der Kunst und Wissenschaft, sowie seinen Freunden und Bekannten, von deren er viele in Deutschland, Frankreich, Holland, England, Schweden und
Italien hatte.[46] In seinen letzten Jahren entschloss er sich aus gesundheitlichen Gründen, einen Pfarrvikar (Dr. Güder) für die öffentlichen Amtsgeschäfte
zu nehmen, die Haus- und Krankenbesuche aber noch selbst zu machen.
Pfarrer Johann Conrad Appenzeller wusste einiges über Biel zu berichten. Aus einer 1824 verfassten Beschreibung weiss der Leser, dass sich im Keller des Bieler Rathauses eine Bühne «für
vagabundierende Taschenspieler, wandernde Komödiantentruppen und hungrige Deklamatoren» befand. [50] In seinem Aufsatz «Ein Abendspaziergang ob Biel» erzählt er von der Römerquelle und wie Pierre
Claude Villemin hinfiel, durch den unterirdischen Wasserlauf trieb und unversehens wieder herauskam. 1828 erschien «Thomas Wyttenbach oder die Reformation in Biel». Ausschlaggebend dafür war der
Zürcher Heinrich Nötzli, Pfarrer in Biel, der die Geschichte Wyttenbachs 1620, fast 100 Jahre nach dessen Tod, in einer Bibel niederschrieb. Diese befand sich damals noch im Pfarrhaus.
Appenzeller: «Es war im Jahre 1523, als Wyttenbach in seiner Vaterstadt Biel als Prediger öffentlich die eingeschlichenen Missbräuche der Kirche anprangerte und namentlich die Messe, die Lehre
vom Fegefeuer und den Zölibat der Geistlichen angriff. Durch seinen offenen Kampf gegen heilige Lehren zog er sich heimliche und offene Feinde zu, besonders als er sich verheiratete und acht
andere Geistliche seinem Beispiel folgten. Obwohl er seine Pfarrstelle an der Hauptkirche verlor, verkündete Wyttenbach weiterhin das Evangelium im Kloster (Standort
Dufourschulhaus).»[52]
Initiant der Bieler Notfallstube
1832 richtete Pfarrer Johann Conrad Appenzeller ein Gesuch an die Kantonsregierung um Errichtung eines Spitals in Biel, «zu Aufnahme der Kranken und Verunglückten der hiesigen Umgebung». 1836
erteilte das Departement des Innern den Auftrag zur Errichtung von Notfallstuben, eine davon in Biel. Sie wurde 1837 im Spital an der Untergasse eröffnet.[53]
Mitglied in vielen Gesellschaften
Johann Conrad Appenzeller war nach eigenen Angaben Mitglied folgender Gesellschaften: der helvetisch-patriotischen von Schinznach, der schweizerisch-gemeinnützigen, der geschichtsforschenden von
Bern, der naturhistorischen von Solothurn, der künstlerischen von Zofingen und der geistlichen Ministerien von Zürich, Bern und St. Gallen.[48]
Familie
Er war zweimal verheiratet. Zuerst mit Anna Margarethe Rieter aus Winterthur (gest. 1807). Am 6. Mai 1810 heiratete er seine zweite Frau Anna Dorothea Usteri aus Zürich.[7] Aus dieser zweiten Ehe stammte Jakob Appenzeller (gest. 1899), Pfarrer der Heiliggeistkirche in Bern. Die Tochter Johanna (1802-1830) heiratete den Architekten
Christian August Roller aus Burgdorf. Das Schlimmste war für ihn mit anzusehen, wie von seinen zehn Kindern nur sein Sohn Jakob überlebte.
Johann Conrad Appenzeller starb am Gründonnerstag, dem 28. März 1850, mit 74 Jahren in Biel an den Folgen einer Brustwassersucht. Sein hinterlassenes Manuskript trägt den Titel «Töne und Klänge
aus der inneren Welt eines Greisen». [47]
Schriften (Auswahl)
Potpourri von Reminiszenzen, kleinen Gemälden und Gedichten über die Schweiz (Winterthur, 1810), Gertrud von Wart oder Treue bis in den Tod (Zürich, 1813), *Alpenrosen von Meissner, Kuhn und Wyss
(1811-1830), Das Nahen zum heiligen Abendmahle (Bern 1824), Künstlerlieder (Basel 1809, 1826), Wendelgarde von Linzgau oder Glaube, Liebe, Hoffnung (St. Gallen 1816), Ein Tag an der Linth oder
auf Wiedersehn (Aarau 1817), Die Heimatlosen im Jura (Bern 1822), Der Mordbrand zu Walperswyl im Oberamt Nidau, Kanton Bern (Bern 1825), Die Jahrgänger am Jubelfeste ihres fünfzigsten Altersjahrs
(St. Gallen 1925), *Ein Zug aus dem Leben eines vollendeten Eidgenossen (Bern 1827), Thomas Wyttenbach oder die Reformation in Biel (Bern 1828), *Der Schlossberg bey Neuenstadt am Bielersee (Bern
1828), Das Berghaus (St. Gallen 1830), Notwendigkeit der Gehaltserhöhung für die Bernischen Landschullehrer (Berner Volksfreund 1834), Schicksal eines Schweizers während seiner Reise nach
Jerusalem und in den Libanon (St. Gallen 1815). L
*Alpenrosen

Marie Louise Bloesch-Moser (1782-1863)
Leiterin der Gymnasiums-Pension von 1817-1836
Marie Louis Bloesch kam am 15. Mai 1782 zur Welt. Sie war die Tochter des Burgermeisters Johann Alexander Abraham Moser (1755-1824) und der Marie
Margarethe Neuhaus (1757-1825). 1802 heiratete sie den Arzt Alexander Bloesch (1778-1814). Zu ihren fünf Kindern zählen Alexander (1802-1816), der Arzt Caesar Adolf (1803-1863), Jurist Eugen
Eduard (1807-1866) und der Industrielle Friedrich (1810-1887) und Tochter Mathilde (1814-1869).[7] Während der Typhus- und Ruhrepidemie, die in Biel wütete,
als Napoleons Truppen dort Halt machten, kümmerte sich Marie-Louise Bloesch um die Behandlung der Zivilisten und der Soldaten. Ihr Mann Alexander starb 1814 bei der Behandlung der Kranken. Durch
die französische Besatzung und das damit verbundene wirtschaftliche Chaos hatte die Familie ihr Vermögen verloren. Mittellos stand die junge Marie-Louise mit ihren Kindern da. Lange Zeit gab es
in Biel gar keine öffentliche Schule, da die Schulhäuser militärischen Zwecken dienten. Nach dem Tod des Vaters übte Marie-Louise auf ihre Kinder einen nachhaltigen Einfluss aus, der umso
bedeutender war, als diese während dieser Zeit keine Schulen besuchten.[21] Sie entschloss sich am neu gegründeten Gymnasium 1817 die Leitung des mit dieser
Anstalt verbundenen Pensionats zu übernehmen. Hier fand sie als Pensionsmutter ein Betätigungsfeld, das ihrer Begabungen entsprach und ihr gleichzeitig die Möglichkeit gab, sich der Erziehung
ihrer Söhne Adolf (1817 bis 1821), Eduard (1817 bis 1823) und Friedrich (1817 bis 1823) zu widmen.[20] Sie starb am 31. Juli 1863. Es gibt ein Porträt von
ihr, das von Aurele Robert gemalt wurde. 1962 wurde ein Weg in Biel nach Marie-Louise-Bloesch-Moser benannt. L
1818-
1836
Johann Peter Girard (1769-1851), Landschaftsmaler und Zeichner
Lehrer am Gymnasium von 1817 bis 1824
Fächer: Schreiben, Zeichnen, Singen.
Johann Peter Girard kam in Biel am 9. 7. 1769 als Sohn des Glasers Johann Peter und der Marianne Huguelet zur Welt. Seit 1790 lebte die Familie in Morges. Girard verkaufte 1793 Pendulen. Von 1817 bis 1824 stellte er sein Können dem Gymnasium Biel als Lehrer zur Verfügung und unterrichtete Zeichnen, Schreiben und Singen. Wegen Mangel an Disziplin wurde er ersetzt. In der Lith. Anstalt Jenni in Bern erschienen vier grössere, von Girard gezeichnete Bieler Stadtansichten, die zum Teil in reduziertem Format ihre weitere Verbreitung fanden. Es existieren auch von ihm kolorierte Lithographien vom Gasthaus «Zum Schiff» der Familie Römer, vom ehemaligen Pavillon Felseck, vom alten Rechbergerhaus und vom Pasquart. Um 1842 zog Johann Peter Girard zu seinem Schwiegersohn nach Aarburg. Am 25. 10. 1851 starb er in Zürich. Er war verheiratet mit Marianne Luise Criblez (1782-1864). Der Ehe entstammt die am 15. Mai 1818 geborene Tochter Louise.[7]
1818-
1824

Johannes Rickly, Theologe
Lehrer am Gymnasium von 1817 bis 1829, ab 1836 Lehrer am Progymnasium
Fächer: Latein, Französisch, Geschichte, Geographie, Geometrie, Griechisch.
Johannes Rickly von Bleienbachs Muttersprache sprach trotz seiner oberaargauischen Abstammung Französisch.[5] In Lausanne studierte er Theologie. Von 1817 bis 1829 unterrichtete er als Lehrer am Bieler Gymnasium Latein, Französisch, Geschichte, Geographie,
Geometrie.[7] Rickly fungierte auch als Aufseher. Obwohl gut bezahlt, war das Amt des Aufsehers unbeliebt. In seinem Kündigungsschreiben formulierte Rickly:
«…préférant les deniers de la liberté aux francs de l’esclavage, les connaissances aux écus sonnants, j’ai pris la ferme et inébranlable résolution de me décharger, une fois pour toutes, du poids
de la surveillance au premier avril prochain…». Ab 1836 unterrichtete er am Progymnasium Biel Latein und Griechisch.[9] Sehr guten Kontakt pflegte Rickly zu
seinen Schülern. Die Eltern von Jean-Louis-Rodolph Agassiz wünschten, dass ihr Junge nach dem Schulabschluss bei einem Onkel in Neuenburg in die Banklehre eintrete, doch auf Anraten Ricklys
konnte dieser seine Ausbildung in Lausanne fortsetzen und 1824 in Zürich ein Medizinstudium beginnen.[25] Die reichhaltige Bibliothek von Johannes
Rickly mit 4000 Bänden wurde 1861 von der Burgerbibliothek angekauft.[7] L
1818-
1829
*1836

Adam Friedrich Molz (1790-1879), Pfarrer, Bieler Dichter, Gründer vom 1. Tierschutzverein der
Schweiz
Lehrer am Gymnasium von 1818 bis 1831
Fächer: Deutsch, Lateinisch, Griechisch, Arithmetik, Singen.
Adam Frid
Adam Friedrich Molz wurde am 31. 1. 1790 in Biel als ältestes von drei Kindern des aus Sachsen eingewanderten Glasers Johann Philipp Molz (1768 bis 1849) und der Margaretha Schneider (1769-1829) geboren. Der Vater erwarb 1817 das Bieler Burgerrecht erwarb und war Besitzer des «Rosius-Hauses» am Obergässli 5. In dessen Glashandlung kauften die Bieler alle Arten von Fensterglas. Adam Friedrichs Bruder Philipp August Molz (1797-1871) war Feldprediger in Frankreich im Regiment Steiger und von 1834 bis 1871 Pfarrer in Münsingen.
Jugend
Als die Franzosen Biel besetzten, wurde der 7-jährige Adam quasi über Nacht zum Franzosen. Nach dem Besuch der Bieler Stadtschule, in der wegen der damaligen kriegerischen Ereignisse wenig
geleistet wurde, kam er mit 13 Jahren in die Sekundarschule von Pruntrut. Dort lernte er die Elemente der Realfächer, durfte jedoch nur Französisch sprechen. 1805 begann er eine
kaufmännische Lehre in Neuchâtel, doch schon nach zwei Monaten wurde das Handelshaus wegen der Kontinentalsperre geschlossen. So kehrte er in sein Elternhaus zurück. Die Lust am Handel war im
vergangen. Auf Anraten eines Pfarrers entschloss er sich, an der Berner Akademie Theologie zu studieren. Schnell holte er das Versäumte in Latein und Griechisch nach. Ab 1809 setzte er sein
Theologiestudium an der Akademie in Genf fort. [56]
Pfarrhelfer in Biel
Am 21. August 1810 wurde Adam Friedrich Molz ins Predigeramt gewählt und am 23. August durch Handauflegen feierlich eingesegnet.[57] Danach war er vom 10. Dezember 1810 bis 1815 Pfarrhelfer in Biel und unterrichtete von 1811 bis 1815 gleichzeitig an der französischen Oberschule in Biel. Vom
Kirchenamt erhielt er nur die bescheidene Summe von 50 Dublonen als Gehalt. Durch freiwillige Unterschriften wurde diese um 10 Dublonen erhöht. Adam Friedrich Molz wohnte im 2. deutschen
Pfarrhaus an der Untergasse 4.[7]
Molz unterrichtete auch an der Realschule. Im April 1815 hatte die Regierungskommission mit Molz ein Übereinkommen getroffen, über die vorläufige Versehung des Pfrunds neben dem Schulamt. Nun
geschah es, dass Molz‘ Vater Philipp, ein etwas aufsässiger Elsässer, zum Nachteil des städtischen Ohmgeldes 4 Fässer Branntwein veruntreute, die von der Regierungskommission beschlagnahmt
wurden. In dem darauf folgenden Rechtsstreit ergriff Friedrich Molz in seiner temperamentvollen Art für seinen Vater Partei. Er verletzte dabei den Präsidenten der Regierungskommission, Niklaus
Heilmann, so empfindlich in seiner Ehre, dass Friedrich Molz zur Wiedergutmachung Abbitte leisten und am 18. Juni 1815 seinen Rücktritt von Schul- und Kirchenamt erklären musste.[5]
Vikar in Rütti und Lehrer in Gottstatt
Von 1816 bis 1817 war er Vikar in Rütti und Lehrer an der Knabenerziehungsanstalt Zehnender im Kloster Gottstatt. [7] Werner
Bourquin zitiert im Bieler Tagblatt vom 25. 1. 1944 einen Brief, den Molz kurz vor seinem Tode an einen Freund in Biel schrieb: «Gottstatt bewahre ich in freundlichem Andenken. 1816/17 war ich
Lehrer in der Knabenpension des Dekans Zehender. Von da pilgerte ich jeden Samstagnachmittags über Büren nach Rütti, wo ich für den höchst interessanten, wunderlichen, originellen, alten Pfarrer
Küpfer die Sonntagsfunktion und das sonst Nötige verrichtete.»
1817 wurde Molz am neugegründeten Gymnasium in dessen Lehrerkollegium gewählt. Sein Eintritt stiess zunächst auf einige Schwierigkeiten, da er beim obersten Kirchen- und Schulrat kein hohes
Ansehen genoss. Dennoch erhielt er die Stelle und blieb bis 1831 am Gymnasium. 1825 gab er das Gesangsbuch «182 christliche Lieder über die vornehmsten
Wahrheiten der Glaubens- und der Sitten-Lehre» heraus.
Familie
1828 heiratete er in Pieterlen Emilie Watt, Tochter von Marie Anna Sophia Morel und Johann Gottfried Watt, Pfarrer in Orvin und Förderer der Moralischen Burgerbibliothek im Schulhaus
Dufour.
Förderer der Bieler Schulen
Rudolf Neuhaus nutzte die Reformationsfeier von 1828, um die Bieler Schulen zu fördern: «Die Knabenschulen sind nicht mit der Zeit gegangen; sie genügen weder als Vorschule des Gymnasiums, noch
bieten sie eine einigermassen befriedigende Ausbildung für diejenigen, die aus finanziellen Gründen auf den Besuch des Gymnasiums verzichten müssen.» Zur Unterstützung legte Neuhaus eine Eingabe
von Friedrich Molz bei, der die Situation aus pädagogischer Sicht beurteilte. Molz stimmte in der Beurteilung der bestehenden Schuleinrichtung mit Neuhaus überein, hebte aber darüber hinaus
folgenden Umstand besonders hervor: «Es ist ein altes Vorrecht der hiesigen Burger, gute Schulen unentgeltlich zur Verfügung zu haben. Das trifft aber schon lange nicht mehr zu, weil die alte
Knabenschule durch das Gymnasium verdrängt wurde. Der Zutritt zu dieser Anstalt wird vielen Knaben durch die hohen Kosten, jährlich 10 bis 20 Neutaler, verunmöglicht. Ein erster Schritt zur
Verbesserung der städtischen Schulen sollte darin bestehen, einen Lehrer zu wählen, der den älteren Knaben und Mädchen täglich 2 bis 3 Stunden Unterricht in Christenlehre, Aufsatz, Arithmetik,
Geographie, Geschichte usw. erteilt.» Auf Vorschlag von Molz schuf der Stadtrat die Stelle eines Oberlehrers, der wöchentlich 16 Unterrichtsstunden erteilen und die Aufsicht über das
Lehrerpersonal führen sollte. An die Oberlehrerstelle wurde am 30. Oktober 1829 Molz selbst gewählt, mit einem Gehalt von 1000 Franken. Aufgrund interner Schwierigkeiten trat Molz im Herbst 1829
zusammen mit den Lehrern Beck, Rickly und Rohr von ihren Stellenam Gymnasium zurück. Er meinte in einem Schreiben an die Behörde meinte er, wenn der Erfolg seiner Reformarbeit hinter dem
gesteckten Ziel zurückblieben sei, so liege es an den unruhigen Zeiten (Revolution), an der Unwissenheit und den Vorurteilen der Eltern und der Lehrer, an der ängstlichen Anwerbung von 7-
und 8-jährigen Schülern für das Gymnasium, die diese Anstalt zu einer Kleinkinderschule und den Ausbau der Knabenbürgerschule überflüssig gemacht habe.[5]
Wegen seiner liberalen Ideen wurde Friedrich Molz zum Stein des Anstossens und von Pfarrei zu Pfarrei versetzt. Er lebte in einem Landgut in Wistenlach, dass er mit Rücksicht auf die Gesundheit
seiner Frau gekauft hatte. Dann liess er sich in Bern nieder. Von 1835 bis 1839 amtete Adam Friedrich Molz als Pfarrer und Klassenhelfer in Bleienbach bei Langenthal.
Adam Friedrich Molz als Gefängnispfarrer
Von 1839 bis 1862 wirkte er als Zuchthausprediger in den Gefängnissen der Stadt Bern. Seine Aufgabe bestand hauptsächlich darin, an Sonn- und Feiertagen den Morgen-
und Nachmittagsgottesdienstes zu halten, den Wochengottesdienst zweimal nach Geschlechtern getrennt zu halten, die Kranken in der Infirmerie zu besuche, die noch nicht aufgenommenen Gefangenen zu
unterrichten und Privatgespräche mit denen zu führen, die darum baten.[16] Die Sträflinge stammten aus prekären Verhältnissen: Einer der Häftlinge hatte nur
eine sehr dürftige Schulbildung genossen und war schon als Kind von seinen Eltern zum Betteln geschickt worden. Lesen und Schreiben hatte er nie gelernt. Erst während der Untersuchungshaft in der
Strafanstalt unterrichtete ihn Molz und der Sträfling erhielt erstmals eine notdürftige Bildung. 1851 wurde er auf der Strasse, weil er keine Arbeit hatte und schlecht gekleidet war, als Vagant
von einem Polizisten aufgegriffen und dem Regierungsstatthalteramt Bern zugeführt. Da er arbeitslos und schlecht gekleidet war, wurde er auf 3 Monate aus dem Amtsbezirk Bern ausgewiesen. Er
verstiess gegen diese Verweisung und wurde deshalb in die Zwangsarbeitsanstalt eingewiesen.[17] Molz missfiel es, dass in Notzeiten «oft ganz junge Leute
wegen eines Masses gestohlener Kartoffeln oder einiger Krautköpfe ins Zuchthaus gesperrt und für immer entehrt wurden.»[55] 1850 schenkte er dem Berner
Zuchthaus 48 Bücher zur Belehrung und Besserung der Insassen. Laut Statistik hatten von 370 Männern nur 17 eine gute Schulbildung, von 70 Frauen hatte gar keine eine gute Schulbildung. Die
Häftlinge mussten unter anderem prähistorische Knochen sortieren. Molz schickte sie dann an ein Museum weiter. Leider wurden sie von den Arbeitern so stark zerstört, dass eine genauere Bestimmung
kaum mehr möglich war. Neben seiner Tätigkeit als Gefängnispfarrer leitete er ab 1848 als Stellvertreter der Erziehungsdirektion die Taubstummenanstalt für Mädchen auf dem Aargauerstalden.
Mitbegründer der Ersparniskasse Biel
1823 gründeten Adam Friedrich Molz und Johann Rudolf Neuhaus (1767-1846) die Gemeinnützige Ersparniskasse Biel. Sie befand sich in einem Zimmer vom Rockhall. Die Kunden waren Dienstboten,
Fabrikarbeiter, Kleinsparer, also die ärmere Bevölkerungsschicht der damaligen Zeit. Dies zeigt den humanitären und philanthropischen Charakter der Institution. Zwei Wochen nach der Eröffnung
wurde die erste Einlage getätigt. Neuhaus übernahm das Amt des Kassierers. 1825 verfügte die Anstalt über ein Eigenkapital von 21'651 Franken, 1872 waren es 4'369'683 Franken. [58]
Gründer vom ersten Schweizer Tierschutzverein
Adam Friedrich Molz beklagte sich über die häufige Ausbeutung von Pferden und Hunden bei schweren Arbeiten. Er forderte ausserdem, dass das sogenannte «Vörteln», also Kühe und Ziegen, die
man auf den Markt bringen wollte, vorher während 2 bis 3 Tagen nicht zu melken, bestraft werden sollte. So begann er 1839 sich für den Tierschutz einzusetzen. Molz forderte 1841 mit einem
Schreiben an die Regierung, dass die Schüler des Staatsseminars für den Tierschutzgedanken gewonnen werden sollten und dass im Schulunterricht auf die Notwendigkeit des Tierschutzes aufmerksam
gemacht werden sollte. Die erste Schulbehörde, die mit gutem Beispiel voranging, war diejenige von Nidau, die bereits 1842 eine Disziplinarverordnung erliess, welche die Tierquälerei
verbot. Allerdings ging für viele die Vorgehensweise von Molz, den Tierschutz von der Kanzel herunter zu predigen, zu weit. Am 15. 8. 1844 gründete er in Bern den ersten Tierschutzverein der
Schweiz, für dessen Bestrebungen er sich die Anerkennung der Behörden zu verschaffen wusste, so dass der Grosse Rat im gleichen Jahr das Dekret gegen die Tierquälerei erliess. Von völliger
Erblindung bedroht, trat Molz 1869 von der Leitung des Tierschutzvereins zurück. Leider existier in der Schweiz ein konkretes Tierschutzgesetz erst seit 1981.
«Vo allne Sproche, nei und alt,
Mer d’s Bieldytsch doch am beste gfallt!»
Adam Friedrich Molz
Dichter in Bieldytsch
Den Bielern ist Molz als der Verfasser der Bieler Mundartgedichte bekannt.[18] Seinem kleinen Bändchen «bieldytscher» Gedichte
kommt umso grössere Bedeutung zu, als das alte Bieldeutsch, wie es zur Zeit des Dichters noch gesprochen wurde, heute völlig verschwunden ist. Seine Gedichte sind sozusagen das einzige
authentische Zeugnis jenes nordwestalemannischen Sprachzweiges, der sich einst bis an den Bielersee und darüber hinaus erstreckte. [3] Beim Bau das damalige Mädchenschulhaus Dufour-West 1863,
wurden zwei Gedichte von Friedrich Molz in den Grundstein eingeschlossen. Ein anderes Werk über den «Wunderglauben» durfte auf seinen ausdrücklichen Wunsch hin erst nach seinem Tod
erscheinen.[19] Das 1869 erschienene Buch «Die Verheerung der räthischen Alpenthäler durch Wasser und Menschen, widmete Autor von Bandlin «den Freunden
Friedrich Molz und dessen Gattin Emilie Molz, in dankbarer Erinnerung an die schönen Stunden im Pfarrhaus an der Altach». Emilie Molz starb 1874 und vermachte dem Gemeindespital Biel 10'000
Franken.
Adam Friedrich Molz starb am 19. Mai 1879 im Alter von 89 Jahren in Bern. Auch er vermachte dem Bieler Gemeindespital 10'000 Franken, der Armenerziehungsanstalt
Gottstatt 10'000 Franken und dem Berner Tierschutzverein 2'000 Franken. Eine Molz-Büste des Bildhauers und Graveurs Karl Alfred Lanz (1847-1907) gelangte 1875 ins Museum Schwab und wurde 1976
ausgestellt. Heute ist sie Teil der Kunstsammlung Biel. Er vermachte dem Einwohnergemeindespital Biel 10'000 Franken, der Armenerziehungs- und Versorgungsanstalt in Gottstadt 10'000 Franken und
dem bernischen Tierschutzverein 2000 Franken. Heute erinnert ein Strassenname an ihn: 1912 wurde die Hintergasse auf Beschluss des Gemeinderates in Molzgasse umbenannt. Ein Rebhäuschen oberhalb
des «Seefelds» nennt sich Molz-Häuschen.[18] L
1818-
1831
Schüler / Éleves

Johann Friedrich Boll (1801-1869), Pfarrer und
Seminardirektor in Hindelbank, Frauenrechtler
5. Schüler und gleichzeitig Aushilfslehrer am Gymnasium Biel von 1817 bis 1818
Johann Friedrich Boll: «Am 12. Februar 1801 kam ich als das jüngste von drei Kindern des wenig begüterten Handwerkers Peter Boll und der Susanne Allioth in Biel zur
Welt. Zur Zeit meiner Geburt gehörte das ganze ehemalige Bistum Basel, seit 1798 zu Frankreich und blieb in diesem Verhältnis bis zum Sturz Napoleons 1814. Ich erinnere mich wie man im
Gottesdienst für den Kaiser, die Kaiserin und das ganze durchlauchte Haus betete und wie man die Siege feierte, welche die französischen Heere erfochten. Ein trauriger Tag war der alljährlich
wiederkehrende, an dem die wehrfähigen Burschen aus Biel und den umliegenden Ortschaften zusammenkamen, um durch das Loos entscheiden zu lassen, wer von ihnen in die Armee einrücken musste. Die
Eltern wussten, dass ihr Sohn, wenn er in die Armee eindrücken musste, für sie so gut wie verloren war, ja, dass sie ihn wohl nie oder höchstens als Gebrechlichen wiedersehen würden.
Ich war ein sehr kränkliches Kind, dessen Fähigkeit zu einem etwas längeren Leben wiederholt abgesprochen wurde. Dies hatte zur Folge, dass ich einige Zeit die Batzenschule, eine Anstalt für
Kleinkinder, besuchte und dann, als ich fast 9 Jahre alt war, in die Primarschule eintrat. Zu diesem Zeitpunkt kannte ich bereits das Zehnersystem und konnte addieren und subtrahieren. Diese
Fortschritte verdankte ich meiner Mutter, die weder Pädagogik noch Unterrichtslehre studiert hatte. Sie fand die Kraft, ihr krankes Kind vorbereitet in die Schule zu geben, obwohl sie einen
ziemlichen schweren Haushalt führte. Das war umso wertvoller, als Biel als französische Grenzstadt mit ihrem Zoll und dem Heer ihrer Zöllner, aber auch als bedeutender Fabrikort, unzählige
Gefahren für die heranwachsende Jugend barg.
«Im Schulwesen Biels herrschte eine unglaubliche Verwirrung und Unordnung»
Johann Friedrich Boll
Die Bieler Schule war bei meinem Antritt in einem erbärmlichen Zustand. Die schulpflichtige Jugend war nach Geschlechtern getrennt, und sowohl die Knaben- als auch
die Mädchenschule zerfiel in eine obere und eine untere. Besonders entscheidend war, dass 1810 Adam Friedrich Molz (1790-1879) als zweiter Pfarrer angestellt wurde und ich in die obere
Knabenschule versetzt wurde, deren Unterricht lebhafter wurde. 1812 trat ich in die Oberschule ein.
Nach dem Wunsch meines Vaters hätte ich Handwerker werden sollen, obwohl meine körperlichen Kräfte dazu kaum ausreichten. Pfarrer Molz ermutigte mich, den geistlichen Stand zu wählen. Er förderte
meine Kenntnisse der lateinischen Sprache und der Grammatik. Überraschend legte Molz 1815 sein Amt nieder und verliess Biel. Rickly, der als Lehrer in Gottstadt angestellt war, beschloss mich in
Griechisch zu unterrichten. So ging ich während anderthalb Jahren, Sommer und Winter und bei jedem Wetter, wöchentlich dreimal eine Stunde von Biel nach Gottstadt. Weit besser geeignet für meine
Vorbereitungen auf die damalige Akademie war das 1817 in Biel eröffnete Progymnasium (wie das Gymnasium auch genannt wurde), in dem sowohl Molz als auch Rickly als Lehrer angestellt wurden. In
meinem ersten Schuljahr wurde ich von den Lehrern gern als Nachhilfelehrer für die schwächeren Schüler herangezogen, die sich im Allgemeinen gern von mir belehren liessen. Mir wurde sogar für
einige Wochen die Leitung der oberen Knabenschule anvertraut. Die Eltern baten mich, ihren Kindern Privatunterricht zu geben, wenn sie in der Schule oder im Progymnasium nicht
weiterkamen.»[15]
Am 11. Juni 1818 zog der Schultheiss Niklaus Rudolf von Wattenyl (1760-1832) mit einer grossen Zeremonie in Biel ein. Vor dem Nidautor, bei der Schädelismatt, stand ein prächtiger Triumphbogen.
Auf der einen Seite standen die uniformierten Schüler des Gymnasiums, auf der anderen Seite die mit Blumen geschmückten Töchter der Stadt. Friedrich Boll und Caroline Schaltenbrand, Sprecherin
der Mädchenschule, hielten die an den Landammann gerichtete Ansprache und überreichten der Deputation Gedichte von Johann Conrad Appenzeller und Friedrich Molz. [62]
Theologiestudium
Boll: «Endlich ging ich im Herbst 1818 nach Bern, um als künftiger Theologe in die sogenannte philologische Fakultät der damaligen Akademie einzutreten. 1821 wurde ich in die theologische
Fakultät befördert und verbrachte die Sommerferien auf dem Bellevue bei der Familie von Ratsherr Fischer. Mit dem verdienten Geld entlastete ich meine Eltern. Im Herbst 1824 bestand ich die
Theologieprüfung.»[15]
Friedrich Boll war ab 1824 fast zwei Jahre Vikar in Nidau. Hier hielt er am 30. Januar 1825 die Abdankungsfeier für die im Schloss Nidau verstorbene Landvögtin von Mülinen, geborene Graffenried.
Von 1826 bis 1832 unterrichtete er als Lehrer mit bescheidenem Gehalt in der ersten Elementarklasse der Literarschule in Bern. 1827 heiratete er Sophie Schmalz (gest. 1878) von Nidau und gründete
danach ein Pensionat für Knaben.
1818-
1818

Lehrer in Niederbipp
1832 wurde er in Niederbipp Lehrer und zugleich Schulkommissar des sogenannten Bipperamts. Friedrich Boll: «In Niederbipp mussten über 500 Kinder von drei Lehrern in zwei Schulhäusern
unterrichtet werden, so dass weder das Lehrpersonal noch die Räumlichkeiten ausreichten. Das Schulhaus, im sogenannten Lehn gelegen, konnte höchstens 60 bis 70 Kinder aufnehmen. Dazu kam, dass
die Eltern ihre Kinder unregelmässig zur Schule schickten. Einmal wurden 60 Väter wegen Schulversäumnissen ihrer Kinder auf einmal vorgeladen. Ein anderes Problem war, dass viele Mütter aus armen
Familien nicht im Stande waren, eine Nadel in die Hand zu nehmen, um Kleider zu flicken. Auf meinen Vorschlag hin beschloss die Schulkommission, ich solle von der Kanzel herab die Leute
auffordern, wer seine Mädchen in Handarbeit unterrichten wolle, möge sich im Pfarrhaus melden. Zuerst hiess es, wir wollen nicht, dass unsere Mädchen Näherinnen werden. Als meine Frau mit dem
Unterricht in Nähen und Stricken begann, kamen die Kinder in Bewegung, so dass sich in wenigen Tagen 40 Mädchen meldeten. Wohlhabenden zahlten etwas, die Armen gar nichts. Bald kam eine Lehrerin
dazu, während meine Frau die Oberleitung übernahm. Der Fortbestand der Arbeitsschule, welche nur im Sommer stattfand, war gesichert.»[15]
1834 und 1835 leitete Boll in Burgdorf für das Erziehungsdepartement die Wiederholungskurse unter dem deutschen Pädagogen Friedrich Fröbel (1782-1852), der in Willisau eine Erziehungsanstalt
unterhielt. Dabei übernahm er den Religionsunterricht, während der Pfarrer und Schriftsteller Jeremias Gotthelf (1797-1854) Geschichte unterrichtete. Im Januar 1835 wünschte sich das
Erziehungsdepartement, dass sich in verschiedenen Gegenden des Kantons Bern Vereine bilden, die an den langen Winterabenden die Schweizer Geschichte unters Volk bringen sollten. Tatsächlich
bildete sich in Niederbipp ein solcher Verein, an dessen Spitze Pfarrer Boll stand. An zwei Abenden machte er sich die Mühe, die Schweizer Geschichte so vorzutragen, dass sie auch der
Einfältigste verstand.
Das Pfarrhaus (links), erster Ausbildungsort für Handarbeiterinnen und Primarlehrerinnen und die Kirche von Niederbipp, Zustand 2024.
Direktor am Lehrerinnenseminar Niederbipp von 1838 bis 1843
Im Gesetz über die öffentlichen Privatschulen des Kantons Bern vom 13. März 1835, wurde erstmals die Ausbildung von Lehrerinnen thematisiert und die Errichtung von
Lehrerinnenseminaren vorgesehen. 1837 beschloss das Berner Erziehungsdepartement versuchsweise eine Anstalt zu errichten, in der Mädchen in den Primarschulfächern, in Handarbeit und in der
Führung einer Kleinkinderschule unterrichtet werden sollten. Dieses Provisorium sollte 80 Jahre dauern. Friedrich Boll wurde 1838 Direktor des ersten Lehrerinnenseminars des Kantons Bern und der
Schweiz, das am 12. November 1838 mit folgenden 12 Schülerinnen in Niederbipp eröffnet wurde: 1) Anna Maria Ryf von Rumisberg, 2) Margaritha Frei von Oberwyl im Simmental, 3) Anna Allemann von
Farneren, 4) Magdalena Stähli von Moos-Affoltern, 5) Sophie Röthlisberger von Langnau, 6) Maria Elisabeth Gugelmann von Attiswyl, 7) Elisabeth Schwab von Siselen, 8) Maria Katharina Fuchser von
Oberdiesbach, 9) Anna Maria Affolter von Leuzigen, 10) Anna Horrisberger von Auswyl, 11) Anna Maria Furrer von Diesbach, 12 Rosina Schaller von Diesbach.
Sie erhielten ihre Wohnung im 1577 erbauten Pfarrhaus, daher nannte man sie auch liebevoll die «Pfarrerstöchter». Das Kostgeld war auf 80 Franken festgesetzt. Es
konnte Unbemittelten vom Erziehungsdepartement ganz oder teilweise erlassen werden. Der Stundenplan umfasste 43 Wochenstunden. Die Ausbildung zur Primarlehrerin dauerte zwei Jahre. Während
Pfarrer Boll in Pädagogik, Religion, Geschichte, Geographie und Physik unterrichtete, übernahm seine Frau Sophie von 1838 bis 1843 den Handarbeitsunterricht. Für den praktischen Unterricht stand
eine Kleinkinderschule in einem Privathaus zur Verfügung. So entstand die Idee vom Kindergarten mit ausgebildetem Personal. Neben dem Unterricht hatten die Seminaristinnen den grossen Haushalt zu
führen und halfen im Garten mit. In besonderer Erinnerung blieb die Kutschenfahrt der Seminaristinnen von Niederbipp über den oberen Hauenstein nach Waldenburg. 1839 wurde das Seminar ins
grössere Pfarrhaus von Hindelbank verlegt, dessen Scheune auch Platz für den Unterricht bot. Hier fand am 7. Oktober 1940 die erste Schlussprüfung statt. Boll behielt die Leitung des Seminars
vorerst bis zum Herbst 1843. Die ausgebildeten Lehrerinnen trugen wesentlich dazu bei, dass im Kanton Bern der Elementarunterricht fast ausschliesslich Lehrerinnen anvertraut wurde. Zu den Bieler
Absolventinnen gehörten Jenny Huber, Julia Schöni, Tochter des radikalen Politikers Alexander Schöni (1796-1880) und Emma Boll. Von 1852 bis 1864 war der ehemalige Direktor vom Bieler
Progymnasium, Johann Peter Romang, Pfarrer in Niederbipp.

Direktor vom Lehrerseminar Münchenbuchsee 1843 bis 1846
Im Winter 1842/43 brach im Seminar in Münchenbuchsee Typhus aus. Boll half da zunächst aus und musste auf Verlangen des Erziehungsdepartements ab 1843 den Direktorposten im Lehrerseminar von
Münchenbuchsee übernehmen. Der Alltag war das genaue Gegenteil dessen, was Boll und Sophie im Lehrerinnenseminar erlebt hatten: 50 bis 100 Jugendliche lebten lärmend auf engstem Raum zusammen,
mangelnde Sauberkeit, Wirtshausbesuche trotz Verbots. Boll: «Es zeigte sich eine fast unglaubliche, wirklich sehr bedauerliche Schwäche, die die Mehrzahl der Aspiranten in der Prüfung in
Biblischer Geschichte an den Tag legten.» Die Seminaristen schrieben kaum eine fehlerfreie Zeile. Sie machten durchschnittlich 40 bis 50 Fehler in 15 Druckzeilen. Ausserdem mahnte Boll 1845, den
Musiksaal des Lehrerseminars auch heizbar zu machen. [59] Friedrich Boll entschied sich gegen eine Reorganisation (Einführung dreijähriger Kurse und Erhöhung der Zahl der Seminaristen von 100 auf
120). Er berichtete, dass das Seminar mit den Lehrerfamilien, den Dienst- und Arbeitsleuten schon ohnehin etwa 140 Personen zähle. Er sei daher gezwungen, «die Anstalt mehr durch eine fast
militärische Disziplin als durch den Geist eines häuslichen Lebens» zu leiten. Schliesslich beliess man die Zahl der Zöglinge bei 100. Im Herbst 1845 nahm man eine dritte Klasse auf. Zur
Durchführung des dreijährigen Kurses kam es ebenfalls nicht. Die ganze Anstalt geriet in eine schwere Krise. Zwischen den Lehrern, den Lehrerfamilien und den übrigen Hilfskräften und dem
Direktor, die alle unter einem Dach lebten, kam es zu Spannungen und zu Zerwürfnissen. Das Seminar wurde 1846 von der politischen Bewegung erfasst. Boll wurde durch den radikalen Sekundarlehrer
Heinrich Grunholzer (1819-1873) ersetzt und bewarb sich in Gottstatt. [64] In Gottstatt arbeitete Boll als Lehrer und an seinem «Handbuch zur Kinderbibel».
Wieder Direktor am Lehrerinnenseminar Hindelbank von 1853 bis 1865
Nach dem Tod von Heinrich Benz übernahm Boll 1852 in Hindelbank dessen Stelle als Pfarrer. Am Lehrerinnenseminar wirkte er von 1853 bis 1865 erneut als Direktor und Sophie als Lehrerin. Die Zahl
der Seminaristinnen stieg auf 22. Trotz Lehrermangels waren die Lehrerinnen vom männlichen Konkurrenzneid bedroht: «Es fehlt dem weiblichen Geschlecht an Gründlichkeit und Tiefe und an der für
den Lehrstand so notwendigen Selbständigkeit.» [63] Im Auftrag der Erziehungsdirektion verfasste Boll 1859 die Kinderbibel «Geschichten und Lehren der heiligen Schrift für die reformierten
deutschen Schulen des Kantons Bern», die in den Primarschulen des deutschen Kantonsteils für verbindlich erklärt wurde. 1862 erschien sein «Handbuch zur obligatorischen Kinderbibel für die
reformierten deutschen Schulen des Kantons Bern», in dem er das neue Testament vollständig umarbeitete. Als Boll aus gesundheitlichen Gründen vom Lehrerinnenseminar ausschied, behielt er die
Pfarrei noch drei Jahre. Dies führte von 1865 bis 1868 zur Aufhebung des Seminars. Erst als Boll sein Pfarramt niederlegte, konnte das Lehrerinnenseminar wieder eröffnet werden. In Bern verfasste
er noch einige Schriften, die teilweise nicht in den Buchhandel gelangten. Boll starb 1869 und wurde auf dem Friedhof in Bremgarten beigesetzt. Seine Autobiographie erschien 1870. [14]
L

Cäsar Adolf Blösch (1804-1863), Arzt,
Politiker und Historiker
7. Schüler am Gymnasium Biel von 1817 bis 1821
und später Lehrer
Fach: Botanik
Die Eltern: Cäsar Adolf Blösch war der Sohn des Bieler Arztes Dr. Alexander Blösch (1878-1814) und der Marie-Louise Moser (1782-1863), Tochter des
letzten Burgermeisters Alexander Moser. Als 1814 die Franzosen aus Biel abzogen, waren die einrückenden Truppen der kaiserlichen Armeen willkommen, brachten aber den Flecktyphus mit. Die fremden
Soldaten und die einheimische Bevölkerung wurden von dieser schrecklichen Krankheit befallen. Die Kranken wurden im Ratssaal und in andern Räumen des Rathauses untergebracht. Als sich diese Räume
als zu klein erwiesen, wurde auch das Gymnasium als Lazarett eingerichtet. Überall in den Zimmern und Gängen lagen die Kranken im Stroh. Drei Ärzte starben als Opfer ihrer Pflicht, darunter
Cäsars erst 24-jähriger Vater. [20] Dr. Alexander Blösch hinterliess seiner Frau vier Söhne und etwa ein Monat später kam noch ein Töchterchen. Der älteste Sohn war Alexander (1782-1814), er
starb mit 12 Jahren und 2 Monaten an Entkräftung, der zweite Cäsar Adolf Blösch (1804-1863), der dritte der spätere Landammann Eduard Eugen Blösch (1807-1866) und der jüngste der spätere
Industrielle Fritz Blösch (1810-1887).[20]
Kindheit
Cäsar Adolf Blösch kam am 5. 11. 1804 in Biel zur Welt. Sein Geburtshaus steht an der Obergasse 22. Im Dufourschulhaus war er der Schulkamerad von Louis Agassiz. Bloesch erzählte in seinen
unveröffentlichten autobiographischen Aufzeichnungen, wie er mit Agassiz am Gymnasium Kaninchen sezierte, um die Verbindung der Nieren mit der Harnblase freizulegen. Laut Dr. Majors, dem Onkel
von Agassiz, erstellten sie einen «Elektrophor», auf den ihre Mitschüler nicht weniger stolz waren als die Ersteller selbst. Ihre Neugier trieb sie bald dazu, Schiesspulver herzustellen, um einen
feuerspeienden Berg zu demonstrieren. Statt des erwarteten Lavaausbruchs kam es aber zu einer Explosion, die den Vulkan zum Erstaunen aller über die Stadtmauer in den Graben
schleuderte.[22] Der Lehrer Johannes Rickly schenkte Cäsar zum Neujahr das von Corway bearbeitete Buch mit den Lehren des griechischen Arztes Hippokrates,
das auch dessen Arbeit «Über Luft, Wasser und Wohnort» enthielt. Jahre später führten Cäsars Studien zu diesem Buch, das ihm Lehrer Rickly geschenkt hatte, zurück zu Hippokrates und speziell zu
jenen Kapiteln, in welcher dieser Klassischer der Medizin aus dem 5. vorchristlichen Jahrhundert die Einflüsse der Luft, des Wassers und des Wohnortes auf die Gesundheit des Menschen ausüben.
Blösch stellte sich mit seiner Dissertation die Aufgabe, die von Hippokrates aufgestellte Theorie anhand der spezifischen Verhältnisse der Stadt Biel zu überprüfen.[24]
Mediziner und Geschichtsforscher
Nach dem Besuch des Bieler Gymnasiums studierte Cäsar Adolf Blösch Medizin in Zürich (1821-1823), Göttingen (1823-1826), Berlin (1826) und Paris
(1826-1827).[7] 1827 eröffnete er in Biel eine Arztpraxis. In seiner Freizeit widmete er sich mit besonderer Vorliebe der Bieler Geschichte. Zusammen mit
seinem Bruder ordnete er das Stadtarchiv, das rund 60‘000 Urkunden umfasste. Nicht weniger als 14 Jahre dauerte die Ordnung des Archivs. Cäsar Blösch war es auch, der als erster in Petinesca nach
römischen Funden grub, assistiert von den Gymnasiallehrern Flegler und Grauff. Diese Forschungen waren vom Erfolg gekrönt.
Cäsar Blösch heiratete am 1. 12. 1827 Catherine Luise Marie Elisa Pugnet, Tochter des französischen Arztes Jean-Francois-Xavier Pugnet (1765-1846). Er gab ehrenamtlich Botanikunterricht am
Gymnasium. 1828 wählte man in als Freund der Schule in die Schulkommission und übernahm die Leitung Burgerbibliothek. 1829 trat er in den Stadtrat ein und widmete sich der radikalen Politik mit
solchem Eifer, dass er deswegen seine berufliche Tätigkeit vernachlässigte. Er wurde auch Mitarbeiter radikaler Zeitungen wie der Appenzeller Zeitung, was die Aufmerksamkeit der bernischen
Regierung auf ihn lenkte.[23]
«Als alles revolutionierte, wie überall das Volk sich gegen die Regierungen
erhob und grössere politische Freiheiten und Rechte forderte, wie die
verschiedenen Kantone zu diesem Zwecke Verfassungsräte wählten, so
glaubten die hiesigen Bürger, dass auch sie revolutionieren, auch sie gegen den
Magistrat sich erheben, mehr Freiheiten und Rechte (Aufhebung des
Gymnasiums) fordern und einen Verfassungsrat erwählen müssten»
Cäsar Blösch, Geschichte der Stadt Biel und ihres Pannergebiets
Anfangs radikal gesinnt, näherte er sich in seinen späteren Jahren immer mehr dem liberal-konservativen Gedanken an, dem auch sein Bruder Eduard verpflichtet war.
1840 kaufte Blösch ein Haus an der Mühlebrücke 5, das später Blöschhaus gennant wurde. Der Kaufvertrag bezeichnet die Liegenschaft als «das Haus vor dem Pasquarttor». Besondere Verdienste erwarb
er sich 1855 bei der Schaffung des Ausscheidungsvertrags zwischen der Burger- und Einwohnergemeinde.[7] Daneben betätigte er sich auch als Schriftsteller und
gab ein Werk seines Schwiegervaters Dr. Pugnet über die praktische Anwendung der Medizin heraus. Er selbst hinterliess zahlreiche handschriftliche Bände.[23]
Cäsar Blösch veröffentlichte 1855-56 sein dreibändiges umfassendes stadtgeschichtliches Werk «Geschichte der Stadt Biel und ihres Pannergebiets». Nach dem Tod seines Schwiegervater 1861, wurden
ihm 1863 erst die Mutter und dann seine Frau durch den Tod entrissen und er selbst beendete in diesem Jahr im Alter von 59 Jahren sein Leben.[26]
L
1818-
1821

Eduard Eugen Blösch (1807-1866), Landammann, Präsident der Viktoriaanstalt für arme Mädchen
8. Schüler vom Gymnasium Biel von 1817 bis 1823
Eduard Eugen Blösch wurde am 1. Februar 1807 in Biel geboren. Zu diesem Zeitpunkt war Biel noch mit Frankreich vereinigt und blieb es bis 1813. In diesem Jahr zogen
die alliierten Truppen ein. Mit der österreichischen Armee kam auch das Lazarettfieber nach Biel, das zahlreiche Opfer forderte, darunter der 1814 verstorbene Vater Johann Alexander Blösch.
Eduard war damals erst 7 Jahre alt. 1815 wurde das Provisorium Biel dem Kanton Bern angegliedert. Mit der Gründung des Gymnasiums 1817 konnte die Witwe Marie-Louise Blösch die ökonomische Leitung
des dazugehörigen Pensionats übernehmen, das 1818, wie die Schule selbst, in das ehemalige Burgerspital verlegt wurde. Die ökonomischen Vorteile dieser Stelle waren sehr bescheiden, da sie für
die ihr zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten eine hohe Miete zahlen musste. Dafür konnte sie ihre Kinder erziehen, die zu den Schülern der Pension und des Gymnasiums gehörten.
Die Anstalt wurde mit militärischer Strenge geführt. Extraarbeiten waren nicht die einzigen Strafen, die zur Anwendung kamen. Eduard Blösch erinnerte sich in einem Brief an Stock und Peitsche.
Die Erziehungsmethoden entsprachen der damals neuen Pädagogik, und zwar in so ausgesprochener Weise, dass es nicht selten zu Konflikten mit den Berner Behörden kam. Das Gymnasium stand unter der
Leitung von Pfarrer Appenzeller und hatte das Glück, zwei hervorragende Lehrer zu haben.
Mit Stolz erinnerte sich Blösch daran, dass sich viele Schüler in den verschiedensten Positionen ausgezeichnet hatten, und mit mehreren von ihnen verband ihn eine langjährige Freundschaft. Mit
Johann Rickly stand er noch lange in Briefkontakt und nahm sich nach dessen Tod in Bern der mittellos gewordenen Familie an. Eduard gehörte nicht gerade zu den begabtesten Schülern und tat sich
weniger hervor als sein älterer Bruder Cäsar. Aus einem Brief von 1822 an den Bruder ging hervor, dass bereits militärisches Exerzieren geübt wurde und er selbst Fahnenträger der kleinen Truppe
war; ein anderer Brief zeigt, dass er im selben Jahr den ersten Preis in «Deutschen» und den zweiten Preis in «Lateinischen und Griechischen» gewonnen hatte.
Im Frühling 1821 verliess Cäsar das Gymnasium und das Elternhaus, um in Zürich Medizin zu studieren. Eduard begleitete ihn, zusammen mit einem Lehrer und einem weiteren Schüler zu Fuss, über
Zofingen und Bremgarten. Die Berufswahl war schwierig; eine gewisse Neigung zog ihn auch zur Medizin, aber die Mutter hielt es für unpassend, zwei Brüder das gleiche Fach wählen zu lassen, andere
Verwandte stimmten bei und rieten zur Jurisprudenz. Mit 16½ Jahren wurde Eduard 1823 in Bern bei Oberst Stettler, dem obrigkeitlichen Salpeterverwalter, tauschweise untergebracht. Sein
Hauptlehrer an der Berner Universität war Samuel Ludwig Schnell (1775-1849), Mitglied des Obersten Gerichtshofs der Schweiz.
Mittlerweile hatten alle Kinder der Witwe Blösch das Elternhaus verlassen: Cäsar Adolf (1804-1863) befand sich in Göttingen und Berlin, wo er seine Studien fortsetzte, die zehnjährige Schwester
Mathilde (1814-1869) war in Pension gegeben worden und Friedrich (Fritz) (1810-1887) beendete nach der Handelslehre seine kaufmännische Ausbildung an der «école centrale des arts et métiers» in
Paris. Nach 5 Semestern verliess Eduard Blösch die Hochschule. Ab 1826 arbeitete er im Bieler Stadtarchiv, dessen teilweise feucht gewordenen Bestände damals in zwei Räumen am Boden verstreut
waren und nun geordnet werden mussten. In den ungeheizten Räumen zog er sich eine gefährliche Erkältung zu. 1827 ging er nach Heidelberg um seine Studien in 3 Semester fortzusetzen, kehrt aber
schon ein Jahr später heimwehkrank nach Biel zurück. Aus Rücksicht auf seine Mutter lebte er sehr sparsam. So bestand längere Zeit sein Frühstück aus einer Flasche frischem Wasser und einem
Brötchen, das er zur Hälfte für das Abendessen aufhob.
1830 führte ihn die Stellensuche nach Burgdorf. Beim Stadtschreiber Ludwig Schnell fand er eine Arbeit als Gehilfe und heiratete dessen Tochter Rosina Elisabeth im März 1832. Aus
Sparsamkeitsgründen gab es keine Hochzeitsreise und das Paar wohnte in einem kleinen, bescheidenen Zimmer der Schwiegereltern Schnell. Blösch bezeichnete diese Zeit als die glücklichste seines
Lebens. Durch die Familie Schnell wurde Eduard Blösch in die radikale Politik hineingezogen, die sich für eine Verfassungsrevision einsetzte. 1832 wurde er durch eine Auszeichnung zum Anwalt
ersten Ranges ernannt und trat mit Schnell in eine Berufsassoziation ein. 1838 wurde er Mitglied des bernischen Grossen Rates, 1839 Major und Stabschef im Übungslager Thun. 1846 erhielt er das
Burgerrecht von Burgdorf geschenkt, nachdem er jahrelang das Sekretariat der Bürgergemeinen bekleidet hatte. Im gleichen Jahr wurde er zum Präsidenten des Gemeinderates und der Einwohnergemeinde
gewählt.[43] Der prägende Teil von Blöschs Leben und Wirken liegt jedoch nicht in seiner eidgenössischen Karriere, sondern in seinem Anteil an den
Parteikämpfen des Kantons Bern in den 40er und 50er Jahren. In diesen Kämpfen war Blösch der geistige Kopf der konservativen Partei.[44]
Ab 1841 war er als Landammann (Präsident des Grossen Rates) und Tagsatzungsgesandter. Blösch und Hans Schnell gründeten zu Propagandazwecken die Berner Volkszeitung, da der Revisionssturm
zugenommen hatte. 1847 nahm er als Oberauditor am Sonderbundskrieg teil. Von 1850 bis 1854 amtete er als konservativer Regierungspräsident, ab 1851 auch als Nationalrat. 1854 wurde er Präsident
des Bundesgerichts und 1858 Nationalratspräsident. Dann musste er dem endgültigen Sieg der Radikalen weichen. 1859 verlieh ihm die Universität Bern die Ehrendoktorwürde.[43] In diesem Jahr erfolgte die Gründung der Viktoriaanstalt für arme Mädchen des Kantons Bern in Kleinwabern bei Bern. Sie wurde von dem in Paris lebenden Jakob Rudolf
Schnell von Burgdorf gestiftet. Erster Präsident war Eduard Blösch, der sich bis zu seinem Tod der Anstalt widmete. Die Anstalt wurde am 1. Dezember 1859 eröffnet und am darauffolgenden
Weihnachtsabend mit 8 Schülerinnen eingeweiht. Bereits 1860 waren es 25. [45] 1863 gründete Blösch das «Kinder-Sonntagsblatt». 1864 war er wieder im Grossen
Rat und 1866 dessen Präsident. Eduard Blösch starb kurz darauf am 7. Februar 1866, erst 59 Jahre alt, an den Folgen einer Lungenentzündung. Er war der Vater von Dr. Emil Blösch.[43] L
1818-
1823
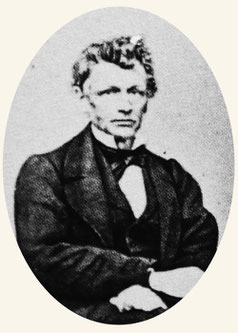
Friedrich Blösch (1808–1887), Industrieller,
Unternehmer, Besitzer vom Drahtzug, Grossrat
9. Schüler am Gymnasium von 1817 bis 1823
Friedrich Blösch genannt Fritz, kam am 29. Dezember 1808 in Biel zur Welt. Sein Vater war der Arzt Johann Alexander Blösch (1778–1814) und Gymnasial-Pensionsvorsteherin Marie Louise Blösch-Moser
(1782–1863). Nach der Handelslehre besuchte er die Ecole des arts et métiers in Paris um seine kaufmännische Ausbildung zu vervollständigen.[7] Wieder in
Biel fand er sofort eine Anstellung bei der Firma «Neuhaus, Huber & Cie.», Inhaber der damals neu errichteten mechanischen Baumwollspinnerei und Weberei. Fritz Blösch war einer der ersten und
bedeutendsten Industriellen Biels und des Jura, wo er sich um die industrielle Entwicklung grosse Verdienste erwarb. Er wurde Mitinhaber und Direktor der Baumwollspinnerei «Fritz Blösch &
Cie.» auf der Gurzelen, der mechanischen Weberei «Fritz Blösch & Cie.» in Bözingen und der Drahtzieherei in Bözingen. (68) Letztere erfuhr durch ihn einen bedeutenden Aufschwung und immer
neue Produktionszweige wurden angegliedert. 1824 erhielt die Firma auf der Berner Industrieausstellung die Goldmedaille.
Am 21. Juni 1833 heiratete er in Seedorf Adele Emilie Neuhaus (1814–1898), die Tochter des Ratsherrn Johann Rudolf Neuhaus. Zu den Kindern zählten Alexander Cäsar Friedrich (1840-1917), Ernst
Friedrich Emil (1843-1887), Robert Alexander (1855-1881), sowie die drei Töchter Sophia Louise, Adelheid Mathilde und Maria Elisabeth Sophia. [7]
1834 wurden die Produkte der Drahtwerke beim Bau der grossen Hängebrücke in Freiburg verwendet. 1852 entstand in Madretsch ein Konkurrenzunternehmen zu den Drahtwerken, gegründet von Constant
Montandon. Er erwarb ein Grundstück und berief den Ingenieur Gustav Schwab zur Leitung des Unternehmens. Schwab verliebte sie jedoch in die Tochter von Fritz Blösch und wurde sein
Mitarbeiter.
Die politischen Kämpfe der fünfziger Jahre führten ihn in die Reihen der Konservativen. Mit seinem Eintritt ins politische Leben und in öffentliche Ämter 1860 trat er jedoch offen zur liberalen
Partei über. Blösch war auch einer der unermüdlichsten Vorkämpfer für den Bau der Jurabahnen.[65] 1864 wählte die Kirchgemeinde Biel Fritz Blösch mit 549
gegen 459 Stimmen in den Grossen Rat. 1871 trat er von diesem Amt zurück. 1873 liess er zur Nutzung der Wasserkraft einen Tunnel bauen, der das Wasser der Schüss bei der Strassenbrücke aufnahm
und in den Drahtzug leitete. Als in Biel 1875 das neue eidgenössische Fabrikgesetz vom Grütliverein entworfen wurde, begrüsste Fritz Blösch den 11-Stunden-Arbeitstag. Er wünschte jedoch, dass den
verschiedenen Industriezweigen ein gewisser Spielraum bei der Arbeitszeit zugestanden werde. Ferner betonte er die Schuldbildung der Arbeiter, da es im Interesse jedes Fabrikanten liegen müsse,
geschulte und intelligente Arbeiter zu haben.[66]
Fritz Blösch-Neuhaus, sein Sohn Ernst Bloesch-Wildermett und Maria Schwab, geborene Blösch, gründeten in Biel die Kollektivgesellschaft «F. Bloesch-Neuhaus & Co.» Geschäftszweck: Herstellung
von Eisendrähten, Kardendrähten, Matratzenfedern, Drahtstiften, Schuhnägeln, Schwülen, Holzschrauben, Ketten usw. 1884 installierte die Firma in ihrer Fabrik in Bözingen eine elektrische
Generatormaschine, die durch eine 1200 Meter lange Kupferleitung mit der Fabrik von «Louis Brandt & Söhne» verbunden war, wo sich die Empfangsmaschine befand. Diese auf Telegrafenmasten und
Isolatoren geführte Leitung hatte Drähte mit einem Durchmesser von 7 mm. Die Firma lieferte den Gleichstrom mittels einer ihrer Turbinen, die mit dem Wasser des Schüss-Wasserfalls gespeist wurde,
und die Mieter «Roulet» und «A. Bourquin & Cie» nutzten ihn in ihrer Uhrenfabrik.[69] Zum Andenken an seinen 1885 verstorbenen Sohn Robert Alexander,
vermachte Fritz Blösch der Arbeiterkrankenkasse im Drahtzug Fr. 1000.-.
Fritz Blösch war Mitglied im Gemeinderat, Burgerrat, Grossrat, verschiedener Kommissionen, sowie Präsident der Volksbank, des Komitees der Berner Kantonalbank-Filiale, der Ersparniskasse und des
Bieler Gas- und Wasserwerkes.[68] Er starb am 28. Dezember 1887 im Alter von 79 Jahren im Gurzelen.[7] Die Witwe Blösch-Neuhaus machte im Einvernehmen mit ihrer Familie und in Übereinstimmung mit den Wünschen ihres verstorbenen Mannes folgende Schenkungen im Betrag
von Fr. 15‘000.-: 1) Fr. 5'000.- zur Verteilung an die Dienstboten des Hauses, 2) Fr. 4'000.- an die Arbeiterkrankenkasse der Drahtzieherei Bözingen, 3) Fr. 3'000.- an das Gemeindespital Biel, 4)
Fr. 1'000.- an den Bieler Hilfsverein, 5) Fr. 300.- an den Bieler Frauenhilfsverein, 6) Fr. 500.- an das Waisenhaus der Burgergemeinde Biel in Gottstatt, 7) Fr. 200.- an das Waisenhaus für arme
Mädchen in Biel, 8) Fr. 200.- an die Suppenanstalt für arme Schulkinder, 9) Fr. 200.- an das Privatasyl des Dr. Blösch in Bern, 10) Fr. 400.- an den Fürsorgeverein Bözingen, 11) Fr. 200.- an den
Fürsorgeverein Mett. L
1818-
1823
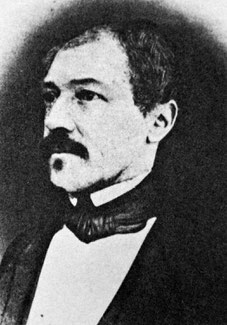
Gottfried Scholl (1803-1865), Präsident der «Emulation jurassienne» Sektion Biel, Gemeinderat
13. Schüler am Gymnasium Biel von 1817 bis 1818
Charles Marc Godefroy Scholl, wie er im Schülerverzeichnis des Gymnasiums Biel genannt wird, kam am 24.12.1803 in Lausanne zur Welt.[7] Sein Vater Samuel Gottfried Scholl (1752-1832) gab 1806 seinen Wohnsitz in Biel auf und zog zu seinen Verwandten nach Lausanne, von wo er 1814 nach dem Abzug der Franzosen wieder in seine Vaterstadt zurückkehrte.[34] Den Eltern gehörte das Haus am Ring 5, das später verkauft wurde. Von 1817 bis 1818 besuchte der kleine Gottfried das Bieler Gymnasium. Nach seiner glänzenden Ausbildung wählte er eine gesellschaftliche Stellung. Von seinem Vater hatte er die Vorliebe für Waffen, von seiner Mutter Marianne Porta d’Apples eine tiefe Liebe zu geistigen Dingen. Seine militärische Laufbahn beschränkte sich zunächst auf den kantonalen Dienst. Wir finden ihn am 1. März 1814 als Infanteriekadett in Bern, am 10. April desselben Jahres als zweiten Unterleutnant und am 8. Mai 1826 als ersten Unterleutnant der Dragoner. Am 13. April 1829 wurde er Oberleutnant der Grenadiere. In diesem Jahr trat er mit dem 4. Schweizer Regiment in neapolitanische Dienste. Am 1. September 1837 wurde er zum Adjutantmajor und zwei Jahre später (am 7. Mai 1839) zum Offizier ernannt. Diesen Rang bekleidete er noch, als er am 26. Dezember 1841 um seine Entlassung ersuchte und diese auch erhielt.[41]
1818-
1818

Während eines Urlaubs reiste er nach Tunesien und veröffentlichte das umfangreiche Buch «Ein Spaziergang nach Tunis im Jahr 1842». Darin beschreibt er Tunis wie
folgt: «In jeder Strasse findet man ein anderes Handwerk oder eine andere Industrie. Zunächst fallen die Hersteller von Pferdegeschirren auf; hier findet man prächtige Stickereien: Gold auf Samt,
Silber auf Purpur. Dann kommen die Pantoffelmacher: alle möglichen Formen, Farben und Preise sind hier zu finden; die für die Frauen bestimmten Pantoffeln sind bemerkenswert wegen der eleganten
Seltsamkeit ihrer Zeichnung. Schon von weitem, und ein Blinder würde den Weg finden, riecht man die Läden der Parfümeure: in Rosen- und Jasminwasser steht Tunis an erster Stelle. Es folgen die
Tuch-, Scharpen-, Gürtelkrämer, die Waffenschmiede, Spezierer und eine Menge Repräsentanten der verschiedensten Berufe.» [38] Dann veröffentlichte er in der Zeitung «La Suisse» eine ausführliche
Beschreibung der Stadt Biel, die über die damaligen Verhältnisse und Institutionen Auskunft gab. Diese noch heute lesenswerte Schrift erschien 1855 auch als Sonderdruck.[34]
Nach der Entlassung der Neapolitaner kehrte er nach Biel zurück. Dort baute er in der Klostergasse ein geräumiges Doppelhaus, das er 1860 öffentlich versteigerte. Er widmete seine Interessen
weitgehend der Öffentlichkeit: Scholl versuchte 1847 seiner Heimatstadt eine literarische Zeitschrift zu geben: Es entstand das Familienblatt «Conteur», in dem neben historischen Stücken und
pikanten Dialogen auch Modeartikel, Zeichnungen usw. enthielt. Der finanzielle Erfolg blieb dem Herausgeber jedoch verwehrt, so dass er das Unternehmen aufgeben musste.[41] Er war bis zum Sturz
der konservativen Regierung Grossrat von 1850-1854, Ratsmitglied der Burgergemeinde Biel, des Bernischen Kunstvereins, der Geschichtsforschenden Gesellschaft und der Schweizerischen
Gemeinnützigen Gesellschaft, Gemeinderat von 1845 bis 1859, Initiant der ersten Bieler Kunstausstellung von 1855, Präsident der burgerlichen Schulkommission und Sekretär des
Armenvereins.[7] Im militärischen Bereich wurde er am 6. März 1851 zum Kommandanten des Reservebataillons Nr. 11 ernannt.[41]
Gründer und Präsident der «Emulation jurassienne» Sektion Biel
Kurz nach der Gründung der Société jurassienne d'Émulation in Pruntrut 1847, einer damals patriotischen und gelehrten Gesellschaft, gründeten einige im lokalen politischen und kulturellen Leben
engagierte Bieler 1854 eine Bieler Sektion der S.J.É. und lancierten die Idee eines Museums in Biel. Zu diesen Vorreitern zählten an der Spitze Gottfried Scholl, Gemeinderat in Biel, César
Bloesch, der Autor der «Geschichte von Biel», Ferdinand Keller, Initiant der archäologischen Ausgrabungen rund um den Bielersee, und Oberst Friedrich Schwab.[37] Scholl hatte 1861 in einem Aufruf im Handels-Courier seine Lieblingsidee, ein jurassisches Museum mit archäologischen, historischen, künstlerischen und
naturkundlichen Sammlungen zu eröffnen, ins Gespräch gebracht. Es sollte sogar eine Reithalle und einen Raum für Industrieausstellungen umfassen.[36] Im
Einzelnen sollte das Museum enthalten: 15'000 Bände aus verschiedenen Bieler Bibliotheken 15'000 Bände, das Stadtarchiv mit mindestens 62'000 Dokumenten, von Dr. Blösch unter Mithilfe der
Gemeinde perfekt geordnet, alte Burgunderfahnen, Reste der Siegestrophäen aus den Schweizer Schlachten gegen Karl den Kühnen, an denen auch Biel beteiligt war, ein grosses Relief der
Reuchenette-Strasse, Geschenke der Berner Regierung und das kleine naturhistorische Kabinett des Gymnasiums. Scholl wollte die Gemälde von Leopold und Aurèle Robert, Stuntz, Wyss und anderen
nationalen Künstlern, mit seiner eigenen Sammlungen zusammenführen.[40] Auch Friedrich Schwab war der Meinung, dass seine archäologischen Sammlungen zum
Gelingen dieser neuen kulturellen Initiative beitragen könnten, und so wurde aus seiner Privatsammlung 1865 das «Museum Schwab».[36]
Scholl war bis 1863 erster Präsident der Bieler Emulation jurassienne. 1854 komponierte er anlässlich der 6. Versammlung der jurassischen Emulation ein Lied auf La Neuveville. An den Bieler
Versammlungen behandelte er 1856 an seiner Eröffnungsrede die Biographie des Soldaten und Schriftstellers Oberst Thellung und 1860 das Leben des jurassischen Botanikers Pastors Lamon.[41] Er veröffentlichte im Organ der Société mehrere Artikel, darunter: Sur une exposition industrielle pour le Jura et le Seeland (1852), Rapport sur l’exposition
cantonale des beaux-arts (1855), Toast au Jura (1855), Les sculptures romaines de Granges entre Soleure et Bienne (1862).
Familie
Gottfried Scholl heiratete 1850 Julie Henriette Schneider (1829-1857).[7] Das Paar hatte vier Kinder: den 1857 im Alter von 3 ½ Jahren verstorbenen Eduard
Gottfried, den Dichter Karl Julius (1850-1886) und die Schwestern Friederika Augusta und Julie Henriette (1857-1895), letztere verheiratet mit dem Neuenstadter Pfarrer Jämes-Louis
Gross.[33] Von seiner Frau erbte Gottfried Scholl dass von ihrem Vater Major Johann Jakob Schneider 1798 ersteigerte Maison blanche in Leubringen, in dem die
Familie die Sommermonate verbrachte. Über dieses Haus schrieb er das Gedicht «La Maison blanche».[7] Nach dem frühen Tod der Mutter, kümmerte sich Scholls
Schwiegermutter, eine Cousine von Aurèle Roberts Frau, um die Kinder.[39]
Die Berner Bundesfeier
Die Berner Bundesfeier vom 20. bis 22. Juni 1853 zur Erinnerung an den Beitritt Berns zum Bund der Eidgenossen 1353, wurde mit grossem Aufwand gefeiert. Auf Anregung von Gottfried Scholl bildete
sich in Biel eine Gruppe, die sich auf eigene Kosten nach den Kostümentwürfen von Dr. Ludwig Stantz einkleidete, um in der Murtener Gruppe am Festzug teilzunehmen. Eine Erinnerung an die aktive
Teilnahme der Bieler Mannschaft an den Kämpfen gegen Burgund.[35]
Die Walliser Erdbebenkatastrophe
Werner Bourquin, Bieler Stadtarchivar: «1855
wurde die Schweiz von einem schweren Erdbeben erfasst. Besonders hart traf es das Wallis, das während drei Wochen praktisch ohne Unterbruch vom Erbeben erschüttert wurde. In St. Niklaus stürzten
beide Wirtshäuser ein, selbst die Kirche wurde völlig verschüttet. Angesichts der grossen Not bildeten sich in der ganzen Schweiz Hilfskomitees zugunsten der um Hab und Gut, Haus und Hof
gebrachten Walliser. In Biel stand Kommandant Gottfried Scholl an der Spitze der Hilfsgesellschaft. Innert weniger Tage konnten von Biel aus 600 Franken an die notleidenden Walliser gespendet
werden.»[32]

Die Villa Choisy
Gottfried Scholl baute 1857 an der Juravorstadt 41 die Villa «Choisy» mit Wasch- und Holzhaus, Hühnerstall, Gewächshaus und Sodbrunnen. 1858 baute Scholl gegenüber seinem Wohnhaus eine an die
Schüss angrenzende Scheune mit Stall, Remise und Garten. 1877 verkauften seine Kinder die Villa Choisy an Dr. Albert Schwab, von dem sie danach Emil Schwab, Direktor der Vereinigten Drahtwerke,
erwarb. Heute beherbergt die Villa die Verwaltung der römisch-katholischen Kirchgemeinde Biel und Umgebung.
Die Bilder zeigen die Villa Choisy, der verzierte Boden, das schön dekorierte Treppenhaus, der Parterre zum 1. Stockwerk und die Remise. Fotos: Heinz Strobel / Philipp Wilhelm K

Der Malakoff-Turm
Im Garten baute Scholl 1857 bei der Villa «Choisy» zur Schützengasse den sogenannten «Malakoffturm» oder «Schützengasseturm».[7] Werner Bourquin:
«Scholl errichtete ihn zur Erinnerung an den von den Franzosen unter General MacMahon im Krimkrieg (1853-1856) erstürmten Turm Malakoff, der stärksten Befestigung von Sewastopol. Der Turm nahm
sich in seiner Gestaltung sehr gut aus und leitete, von der oberen Schützengasse aus gesehen, die Aufmerksamkeit so geschickt auf die Türme und Helmspitzen der Altstadt über, dass Gonzague de
Reynold (1880-1970) glaubte, es handele sich hier um ein vorgeschobenes Stück der mittelalterlichen Stadtbefestigung (citas et Pays suisses - la rue du Stand avec un reste de bastion)». Der über
90 Jahre alte Turm wurde 1951 abgebrochen.[33]
Initiant vom neuen Gemeindespital von Biel
Gottfried Scholl und vier weitere Mitglieder der Aufsichtsbehörde der Bieler Notfallstube (Pfarrer Juste-Aimé Cunier, Dr. Cesar Adolph Bloesch, David Schwab und Ludwig Mürset) hatten 1854 begonnen, ein Kapital anzulegen, welches die Gründung und den Unterhalt eines öffentlichen Gemeindespitals bezweckte. Es sollte die armen Kranken der Bieler Gemeinde und ihrer Umgebung aufnehmen und verpflegen, insbesondere diejenigen, die nicht nach Bern ins Inselspital transportiert werden konnten. Das Kapital von 4450 Franken wurde am 1. Dezember 1860 von den unterzeichneten Gründern dem Einwohnergemeinderat der Stadt Biel als eigentümliche Stiftung eines öffentlichen Gemeindespitals übergeben. Von diesen Pionieren lebte keine mehr, als das neue Spital am 29. November 1866 eingeweiht wurde.[42]
Rechbergers Bieler Chronik
1861 wurden aus Scholls Privatbibliothek Bücher entwendet, darunter das handgeschriebene Manuskript von Rechbergers Bieler Chronik. Durch ein Inserat im Seeländer
Boten setzte er eine Belohnung für die Wiederbeschaffung aus. 1862 brannte sein Haus, doch konnte das Feuer dank der raschen Hilfe der Nachbarn gelöscht werden.
Von schwerer Krankheit gezeichnet
Der Gesundheitszustand des zuckerkranken Gottfried Scholl verschlechterte sich ab 1863 massiv und er musste sich zwangsweise in den Ruhestand begeben. Seine letzten Tage wollte er seiner Familie
ersparen. Der Kunstmaler Aurèle Robert schrieb am 5. Februar 1865 an Baron von Effinger: «Der liebe Herr Scholl, der seit langem sehr leidet, hat Biel mit dem Gedanken verlassen, nicht mehr
zurückzukehren! Obwohl sein Arzt in Evian ihm Hoffnung machte, dass ein milderes Klima sein Leben verlängern könnte, machte sich Herr Scholl keine Illusionen über seinen Zustand, und er wartete
tapfer und in Isolation auf das Ende, das er schon lange vorausgesehen hatte.» [39] Gottfried Scholl starb am 22. Januar 1865 einsam in Montpellier, fern von seinen Angehörigen, seinen Freunden
und seinem geliebten Jura.
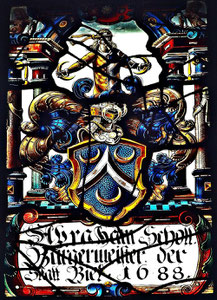
Die Scholl-Strasse in Biel
Die Familie Scholl gehörte zu den ältesten Bieler Familien und brachte während vier Jahrhunderten bedeutende Persönlichkeiten hervor.
Foto links: Wappen des Abraham Scholl (1629-1690), Ururgrossvater von Gottfried Scholl (1803-1865), Burgermeister der Stadt Biel von 1681 bis 1690. Wappenscheibe
von 1688 in der Stephanskirche Biel-Mett. [7]
Werner Bourquin: «Gottfried Scholl war der vorletzte Vertreter jenes alten Bieler Geschlechts, deren Angehörige zu verschiedenen Zeiten das Stadtschreiber-, Burgermeister und bischöfliche Meyeramt ihrer Vaterstadt bekleideten. Die Scholl stammten aus Pieterlen. Bereits 1483 war der Müller Martin Scholl aus Pieterlen in das Bieler Burgrecht aufgenommen worden, und 1514 besass er in Biel Haus und Hof.
«Gottfried Scholl war der vorletzte Vertreter jenes alten Bieler Geschlechts, dessen Angehörige zu verschiedenen Zeiten das Stadtschreiber-, Burgermeister und bischöfliche Meyeramt ihrer Vaterstadt bekleideten. Die Scholl stammten ursprünglich aus Pieterlen. Bereits 1483 war der Müller Martin Scholl von Pieterlen in das Bieler Burgrecht aufgenommen worden, und 1514 besass er in Biel Haus und Hof.

1568 wird auch ein Hans Scholl, damals Ammann zu Pieterlen, als Burger Biels erwähnt. Der Zweig des Gottfried Scholl geht auf jenen Martin Scholl aus Pieterlen
zurück, der 1592 wegen seiner Verdienste um die Stadt beim sogenannten Tauschhandel das Burgerrecht der Stadt geschenkt wurde.»[33] Mit dem Tod von Gottfried
Scholls Sohn Jules Charles 1886 starb die Bieler Scholl-Familie aus. Der Generation Scholl widmet die Stadt Biel seit 1936 die Scholl-Strasse. L
Alexander Adolf Eduard Wildermett (1807-1836), Offizier
19. Schüler am Gymnasium Biel von 1818 bis 1823
Alexander Adolf Eduard Wildermett kam am 4. Januar 1807 als Sohn von Sigmund Heinrich Wildermett (1767-1847) und der Katharina Rengger zur Welt. Er besuchte von 1818 bis 1823 das Gymnasium und trat nach dem Abitur in ein Frankfurter Handlungshaus ein. Von 1825 bis 1829 Leutnant in holländischen Diensten, verlor er seine Stellung wegen der Auflösung des Regiments. Versuche, seine militärische Karriere in Neapel fortzusetzen, scheiterten, doch gelang es ihm eine Offiziersstelle in Batavia zu erhalten. Nach Biel zurückgekehrt, ertrank er im November 1836 in der Madretschschüss.[11] L
1818-
1823
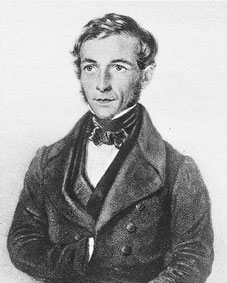
Alexander Schweizer (1808-1888), Theologie-Professor an der Uni Zürich von 1835 bis 1888, Pfarrer am Grossmünster in Zürich
von 1844 bis 1871
44. Schüler am Gymnasium Biel von 1817 bis 1818
Alexander Schweizer kam am 14. März 1808 im Pfarrhaus zu Murten als Sohn des «Lateinischen Schulmeisters» Johann Jakob Schweizer (1771-1843) zur Welt. Die Familie war mit der Pfarrersfamilie Agassiz in Môtier befreundet. Später zogen die Schweizers nach Nidau. Alexander Schweizer erinnerte sich: «Die Nidauer und die Bieler gerieten oft aneinander. Die Nidauer mit dem Neckwort ‹Frösche›, weil im Wassernest die Frösche massenhaft heimisch waren, sodass ihr Quaken mich oft in den Schlaf gesungen hat; die Bieler wurde mit ‹Schissferneli› gescholten, wie ihr Flüsslein Schüss sehr forellenreich war. Als Biel samt dem Jurabezirk von Frankreich losgelassen wurde, sah ich am Fest in Biel als Zeichen zur Einigung ein Transparent, auf welchem der Frosch die Forelle umarmte.»[60]
1818-
1818
«Im Gedächtnis geblieben ist mir vom Unterricht nichts als nur eine Anekdote: Als Professor
Appenzeller nachdem er einem hustenden Schüler etwas Gerstenzucker reicht nun hören musste,
wie die ganze Klasse sich in lebhaftes Hustenwetteifer einliess.»
Schüler Alexander Schweizer
Über seine Zeit am Bieler Gymnasium schrieb Alexander Schweizer in seiner Biographie: «Es galt als selbstverständlich, dass ich, wie mein Vater, Pfarrer werden
sollte. Mit 10 Jahren kam ich ans Gymnasium. Obwohl nur eine Viertelstunde vom elterlichen Pfarrhaus entfernt, trat ich in die von Marie-Louis Blösch gehaltene Pension ein. Unter einer Schar
meist älteren Knaben, die aus nahen und fernen welschen und deutschen Orten herbeiströmten, befanden sich auch zwei fast erwachsene junge Männer namens Heim aus dem Appenzellerland, die ich
später als Gastwirt und Arzt in Gais wiedersah. Unter den Fremden traf ich nur einen Bekannten, Agassiz, den ich sonntags zum Mittagessen ins elterliche Pfarrhaus mitnahm. Nicht ohne Stolz
marschierten wir in der graublauen Uniform der Bieler Gymnasiasten in Nidau ein, nichts ahnend, welche spätere Berühmtheit mich begleitete. Die Kindheitsspiele blieben nun liegen. Latein,
Griechisch, Französisch, Deutsch, Geschichte, Geographie, Mathematik lasteten schwer auf der allzu jugendliche Kraft, weshalb mir das Griechische wieder erlassen wurde. Wenn ich dennoch einen
mittleren Platz erreichte und beim Examen sogar eine Prämie erhielt, mag die Vertrautheit der Lehrer mit dem gastlichen Pfarrhaus meines Vaters mehr dazu beigetragen haben als meine Fortschritte.
Vom Unterricht blieb mir nur eine Anekdote im Gedächtnis: Als Professor Appenzeller nachdem er einem hustenden Schüler etwas Gerstenzucker reichte, musste er mit anhören, wie die ganze
Klasse in einen lebhaften Hustenwetteifer geriet. Jedenfalls lernte ich dort Gehorsam, Toleranz und strenge Ordnung. Für das Mittagessen waren 10 Minuten vorgesehen. So standen rechtzeitig eine
ganze Schar Knaben bereit, um beim ersten Läuten der Essglocke in den Speisesaal zu stürzen und schnell zu verschlingen, was man, besser oder schlechter zubereitet bekommen konnte. Das viele
Sitzen, Lernen und Schreiben fand sei Gegengewicht im Turnen, Exerzieren, Baden, Tanzen, in gemeinsamen Spaziergängen und Ausflügen. Es war ein reges, munteres Treiben.» Alexander Schweizer wurde
dann als 11-jähriger nach Basel «verpflanzt».[6]
Schweizer wurde an den Gymnasien Biel und Basel, sowie an der Gelehrtenschule Zürich (Collegium humanitatis) auf das Theologie-Studium vorbereitet und absolvierte das Karolinum (Theologische
Hochschule). 1831 wurde er für den Zürcher Kirchendienst ordiniert. Dank eines Stipendiums konnte er seine Studien in Berlin fortsetzen, wo damals noch Friedrich Schleiermacher (1768-1834), der
Begründer der modernen wissenschaftlichen Theologie, wirkte. Nach einjährigem Aufenthalt wurde Schweizer bis 1834 Hilfsprediger der reformierten Gemeinde in Leipzig. Dann wechselte er diese
Stelle als Privatdozenten an die neu gegründete Universität Zürich. 1835 beförderte man ihn zum ausserordentlichen Professor.[61]
1840 promovierte Schweizer an der Universität Basel zum Dr. theol. honoris causa. Nachdem er mehreren Jahre als Vikar am Grossmünster amtete, war er von 1843 bis 1871 Pfarrer dieser
Gemeinde. Als Akademiker gehörte Schweizer, der einer der konsequentesten Schüler Schleiermachers war, der Richtung der Vermittlungstheologie an. Er schrieb das grosse Werk «Schleiermachers
Wirksamkeit als Prediger, das Evangelium Johannes, Homiletik der evangelischen Kirche und vor allem die Glaubenslehre nach protestantischen Grundsätzen» (1863 bis 1872, 2 Bände). Aber auch als
Kanzelredner war Schweizer bedeutend; die von ihm herausgegebene Predigtsammlung umfasst nicht weniger als fünf Bände.
Alexander Schweizer stand in Kontakt mit dem Theologen und Politiker Johann Peter Romang (1802-1875), der 1851 Rektor des Bieler Gymnasiums war. An der Jubiläumsfeier der Universität Berlin 1860
vertrat er die Alma mater Turicensis. Nach seinem Rücktritt als Pfarrer blieb er noch 17 Jahre Professor für Praktische Theologie.[61] Alexander
Schweizer wohnte in Zürich im Haus zum Vogelsang im Stadelhofen Nr. 15, dass er 1868 kaufte und umbaute. Später ging das Haus an seinen Sohn, Oberst Alexander Schweizer, und dann an seinen Enkel
Dr. med. Robert Schweizer, über. Er starb am 3. Juli 1888 im Alter von 80 Jahren. L

Auguste Agassiz (1809-1877), Uhrenfabrikant
108. Schüler am Gymnasium von 1819 bis 1822
Auguste Agassiz kam am 15. April 1809 in Môtier als Sohn des Gemeindepfarrers Louis Benjamin Rodolphe Agassiz (1776-1837) und der Marianne Rose (1783-1867) geborene
Mayor, zur Welt. Seine Geschwister waren der spätere Naturforscher Louis (1807-1873), Cécile und Schwester Olympe. Der Sohn von Olympe war Ernest Francillon, Gründer von Longines.
Auguste Agassiz folgte seinem Bruder Louis ins Dufourschulhaus Biel, wo er das Gymnasium besuchte und im Pensionat der Marie Louise Blösch-Moser (1782-1863) wohnte. Auf Wunsch seiner Eltern
absolvierte er eine Lehre in der Bank seines Onkels François Mayor-Fornachon in Neuenburg.
Gründung eines «Comptoir Horloger»
Am 14. August 1832 kam der damals 23-jährige Kaufmann Agassiz kam in seine neue Heimat Saint-Imier, um Uhrmacherei zu betreiben. Dieses Kunsthandwerk wurde im Dorf bereits seit mehr als einem
Jahrhundert in kleinen Werkstätten ausgeübt. Die bedeutendste Fabrik des Ortes war damals die Firma «Raiguel Jeune & Cie.», die grosse Mengen der im Jura produzierten Uhren nach Frankreich
und Deutschland exportierte. Agassiz beschloss für den Uhrenhändler Henri Raiguel tätig zu sein und gründete 1833 zusammen mit Raiguel und Florian Morel ein «Comptoir Horloger». Ab dem 23.
November 1838 hiess dieses Geschäft «Comptoir Agassiz SA». Ab dem 1. Januar 1847 leitete Agassiz das Unternehmen allein und der Firmenname wurde in «Auguste Agassiz» geändert.[27]
Agassiz, der Etablisseur-termineur
Agassiz liess Uhren-Rohwerke durch Spezialisten herstellen, insbesondere die sogenannte «roue de rencontre»-Uhr. Es folgte das «Lépine»-Kaliber mit Zylinderhemmung. Die meisten Beschäftigten
arbeiteten in Heimarbeit auf ihren Bauernhöfen. Viele Uhrenteile bezog Agassiz auch von auswärts und setzte die Werke an verschiedenen Orten zusammen.[29]
Man bestellte die Rohlinge in Fontainemelon, die Zahnräder in Haute-Savoie, die Zifferblätter in La Chaux-de-Fonds und die Gehäuse im französischen Departement Doubs.[31] Der Betrieb selbst übernahm die Vollendung, Prüfung und Feinstellung und konnte, da Agassiz ein geschickter Kaufmann war, mit verschiedenen Ländern Beziehungen
anknüpfen. 1845 wurde ein Vertrag mit dem Sohn des in New York ansässigen Bankiers Mayor-Fornachon abgeschlossen, der die Vertretung übernahm. Seitdem wurde hauptsächlich für Amerika
produziert.[29] Um sein Sortiment zu erweitern, holte er sich den talentierten Techniker Edouard Savoye, einen Uhrmacher aus Le Locle, der neben der
Etablissage am 23. Mai 1852 eine Werkstatt für Remonteure gründete.
Kurzes Ehe-Glück
1840 heiratete Auguste Agassiz seine 18-jährige Cousine Julie Mayor, die Tochter des Bankiers Mayor-Fornachon. Sie hatten drei Kinder. Als seine Frau am 20. Januar 1847 im Alter von 25 Jahren
starb, war Auguste Agassiz am Boden zerstört. Der Sonderbundskrieg und die 48er-Revolution erschwerten die Geschäfte. Er verliess Saint-Imier 1850 und zog nach Lausanne zu seiner Mutter und
seiner Schwester, die mit dem Bankier Francillon verheiratet war. Sie halfen ihm, seine Kinder aufzuziehen.[30]
Neffe Ernst Francillon wird Direktor
Auguste Agassiz übergab sein Unternehmen den beiden ältesten und besten Mitarbeitern, Frédéric Bétrix und Lucien Morel. Agassiz blieb der Patron und kümmerte sich um das Geschäft von Lausanne
aus. Als sich Bétrix und Morel zurückzogen, übernahm 1854 Ernst Francillon (1834-1900) die Leitung. Francillon trat schon früh in das Geschäft seines Onkels Auguste Agassiz ein, nachdem er zuerst
in den Büros von Agassiz ein Praktikum absolvierte und danach eine Uhrmacherlehre im Val-de-Travers gemacht hatte. Auf diese Weise eignete er sich kaufmännische und praktische Kenntnisse an. Als
Francillon Direktor wurde und Agassiz als Berater fungierte, begann sich in der Schweiz eine Uhrenkrise abzuzeichnen. Es wurden zu viele Uhren nach dem Motto Quantität statt Qualität produziert,
während die amerikanische Uhrenfabrikation mit ihren präzisen Maschinen Quantität und Qualität verband.
1819-
1822

Gründung der Uhrenmanufaktur Longines
Nach einer langen, mehrjährigen Krise, beschloss Agassiz 1861 die Liquidation. Das 1832 gegründete Comptoir, das abwechselnd Henri Raiguel, Auguste Agassiz und Ernst Francillon leitete, bedurfte
eine komplette Reorganisation. Mit finanzieller Unterstützung von Auguste Agassiz erfolgte durch Ernst Francillon 1862 die Neugründung im «Ancienne Maison Auguste Agassiz» an der Rue Agassiz
11.[29] Agassiz wurde zum Kommanditär des neuen Unternehmens. 1866, im selben Jahr wie die Gründung der Uhrmacherschule, erwarb Francillon ein Grundstück am
Ufer der Schüss in einem Weiler namens «Les Longines» (lange Wiesen) und baute 1866/67 die berühmte Longines-Fabrik. Der Fluss lieferte die nötige Antriebskraft. Das Verfahren, alle Uhrenteile
mechanisch herzustellen, war bahnbrechend und aus den vielen Heimarbeitern wurden Fabrikarbeiter. Die Uhren wurden zunächst unter dem Namen von Ernst Francillon verkauft. Später erfolgte der
Eintrag der Marke «Longines». Zum 160. Geburtstag des Unternehmens und zum 125. Jubiläum der Marke Longines konnte 1992 im 4. Stock des erweiterten Fabrikgebäudes ein schönes Museum eingerichtet
werden. Heute gehört Longines zur Swatch-Group.
Gemeindepräsident von Saint-Imier
Von 1846 bis 1847 war Auguste Agassiz Gemeindepräsident von Saint-Imier. Er unterstützte insbesondere das Spital und die Schulen finanziell. 1854 schenkte ihm die Gemeinde Saint-Imier in
Dankbarkeit das Burgerrecht. Auguste Agassiz starb nach längerer Krankheit am 25. Februar 1877 in Lausanne. In Saint-Imier wurde ihm eine Strasse gewidmet. L
Die Agassiz-Strasse mit Informationsschild in Saint-Imier.
Philipp Wilhelm K
Quellen/Sources: 1) Markus Bourquin, Bieler Strassennamen, Altstadtleist Biel, Biel 1971; - 2) Jacob Wyss, Die alten Wohnstätten des Gymnasiums in Biel zur
Erinnerung an den in Frühling 1910 erfolgten Umzug dieser Anstalt, Biel, 1910, Sammlung ZB Solothurn; - 3) P. Balmer, Ein Dichter des alten Biel in Der Bund, Nr. 49, 30. 1. 1944, S. 35f; - 4)
Pietro Scandola, Häuser erzählen ... die Geschichte Biels vom Mittelalter bis heute, Biel: Museum Neuhaus, 2010, S. 6ff; - 5) Jacob Wyss, Das Bieler Schulwesen während der ersten hundert Jahre
bernischer Zugehörigkeit, 1815-1915, Biel 1926; - 6) Alexander Schweizer: biographische Aufzeichnungen, von ihm selbst entworfen, Zürich 1889, S8f; - 7) Werner Bourquin und Marcus Bourquin,
Stadtgeschichtliches Lexikon, Büro Cortesi, Biel 1999; - 8) Marcus Bourquin, Biel im Wandel der Zeiten, Bern 1980, S137; - 9) Christoph Lörtscher, Dufour Ost und Dufour West: 660 Jahre
Stadtgeschichte: Biel, 12. 3. 2000; - 10) ksb., Der Bund, Nr. 197, 25. 8. 1969, S. 24; - 11) Ed. Bähler, Sammlung bernischer Biographien, Band 5, Bern 1904, S. 262f; - 12) Bieler Tagblatt, 12. 1.
1952, S. 7; - 13) Journal du Jura, Nr. 186, 12. 8. 1971, S. 4, - 14) Hunziker, Geschichte der schweizerischen Volksschule, Band 3, Zürich 1882, S. 127ff; - 15) Aus dem Leben von Joh. Fried. Boll,
gewes. Pfarrer und Seminardirektor in Hindelbank, Bern 1870, S. 1ff; - 16) Verwaltungsbericht der Direktion der Strafanstalten, Bern 1850, S. 19; - 17) Tagblatt des Grossen Rates des Kanton
Bern, Bern 1853, S. 358; - 18) «Nachruf» in Bieler Tagblatt, Biel, 9. 10. 1943, S. 2; - 19) Tagblatt der Stadt Biel, 22. 5. 1879, S. 4; - 20) Werner Bourquin, Bielerinnen in Zentralblatt
des Schweizerischen Gemeinnützigen Frauenvereins, Bern, 10. 6. 1935, S. 160f; - 21) Emil Blösch, Eduard Blösch und Dreissig Jahre Bernischer Geschichte, Bern 1872, S. 1ff; - 22) Bq, Bieler
Tagblatt, 22. 9. 1961, S. 6; 23) Bieler Tagblatt, 14. 9. 1936, S. 3; - 24) Bq, «Wie Dr. C. A. Bloeschs Stadtgeschichte entstanden ist» Bieler Tagblatt, 2. 4. 1960, S. 3; - 25) Paul Hertig,
«Jean-Louis-Rodolph Agassiz» in Bieler Tagblatt, 20.. 11. 1993, S. 27; - 26) S., «César-Adolphe Blœsch, de Bienne» in Le Jura, Porrentruy, 19. 11. 1863, S. 3; - 27) G.B./F.C., «Génie
horloger» in Journal du Jura, Biel, 20. 8. 1987, S. 9; - 28) «Zum Jubiläum der Uhrenfabrik Longines» in Die Uhrmacher-Woche, Nr. 19/20, Leipzig 1942, S. 108; - 29) André Régis, «Le 80e
anniversaire d’une grande manufacture d’horlogerie jurassien» in La Suisse Libérale, La Chaux-de-Fonds, 20. 5. 1947, S. 1; - 30) GBd, «La saga des Longines» in L'Impartial, La Chaux-de-Fonds, 15.
6. 1984, S. 9 ; - 31) J. M. Nussbaum nach Texten von André Francillon, «Le quatre-vingtième anniversaire de Long» in L'Impartial, La Chaux-de-Fonds, 12. 5. 1947, S. 7; - 32) Werner
Bourquin, «Das grosse Erdbeben vor 80 Jahren» in Bieler Tagblatt, Biel, 25. 7. 1935, S. 2; - 33) Werner Bourquin, «Der Turm an der Schützengasse wird abgerissen» in Bieler Tagblatt, Biel, 3. 4.
1951, S. 3; - 34) Werner Bourquin, «Der Sonnenhof wird abgebrochen» in Bieler Tagblatt, Biel, 25. 7. 1960, S. 3; - 35) Werner Bourquin, «Biels Beteiligung an der bernischen Bundesfeier vor 100
Jahren» in Der Bund, Bern, 21. 1. 1953, S. 3; - 36) Marc-Antoine Kaeser, «Histoire de la collection et du Musée Schwab» in Cahiers d’archéologie romande, Lausanne, 2013, S. 475; - 37) Chantal
Garbani, Hans-Jürg Käser, Erich Fehr, «Vienne 1815-Bienne 2015» in Actes de la Société jurassienne d‘émulation Année 2016, Porrentruy, 2017, S. 138 ; - 38) Gottfried Scholl, «Aus dem Nachlass des
Kommandanten Scholl sel. von Biel» in Tagblatt der Stadt Biel, Biel, 6. 8.1881, S. 4: - 39) Bieler Geschichts- und Museumsverein, «Das steht nicht im Stadtgeschichtlichen Lexikon», Briefkopien
der Fondation-Collection Robert, Bienne, 2003; - 40) «Gründung eines Museums» in Intelligenzblatt für die Stadt Bern, 26. 12. 1861, S. 6; - 41) X., «M. le commandant Scholl» in Le Jura, Band 15,
Nummer 9, Porrentruy, 31. 1. 1865, S. 3 ; - 42) Pfarrer Thellung, «Das neue Gemeindespital von Biel» in Tagblatt der Stadt Biel, Biel, 2. 12. 1866, S. 1;- 43) Emil Blösch, Eduard Blösch und
Dreissig Jahre Bernischer Geschichte, Bern 1872, S. 1ff; - 44) Der Bund, Bern, 10. 2. 1866, S. 1; - 45) «Soziales Leben» in Der Bund, Bern, 3. 6. 1871, S. 3; - 46) Robert Weber, «J. C.
Appenzeller» Die poetische Nationalliteratur der deutschen Schweiz, 1. Band, Starns, 1866, S. 246ff; - 47) «Johann Conrad Appenzeller 1773-1830» in Sammlung Bernischer Biographien, Band 1, Bern
1884, S. 8ff; - 48) J. C. Appenzeller, Berner Volksfreund, 31. 8. 1834, S. 566; - 49) «Die Heimatlosen» in Der Schweizerfreund, 2. 3. 1821, S. 72; - 50) Werner Bourquin, «100 Jahre
Stadttheater Biel» in Bieler Tagblatt, Biel, 31. 10. 1942, S. 5; - 51) Johann Heinrich Heim, Die Heilkräfte der Alpenziegen-Molken und der Molkenkurort Gais, Zürich, S. 129f; - 52) Johann Conrad
Appenzeller, Thomas Wyttenbach oder die Reformation zu Biel, Bern, 1928, S. 15ff; 53) Margrid Wick-Werder, «Vom Armenhaus zum Krankenhaus» in Bieler Jahrbuch 2015, S. 164; - 54) «Der Mordbrand
von Madretsch» in Der aufrichtige und wohlerfahrene Schweizer-Bote, Aarau, 24. 12. 1829, S. 412; - 55) Emil Rothenbach, Referat über die Fragen: Was hat in neuerer Zeit den Weg ins Zuchthaus
ebener oder leichter gemacht?, 1856, S. 40; - 56) Franz Brümmer. «Adam Friedrich Molz» in Deutsches Dichter-Lexikon, Band 2, Stuttgart, 1877, S. 105; - 57) «Adam Friedrich Molz erhält
Predigeramt» in Berner Wochenblatt, 1. 9. 1810, S. 372: - 58) Dr. Bourquin, «150 Jahre Ersparniskasse Biel» in Bieler Tagblatt, 20. 9. 1973, S. 7; - 59) E. Martig «Geschichte des Lehrerseminars
in Münchenbuchsee», Bern 1883, 87ff; - 60) «Aus der Jugendzeit Alexander Schweizers» in Der Bund, Bern, 14. 12. 1888, S. 1f; - 61) «Zur Erinnerung an den hundertjährigen Geburtstag von
Prof. Dr. theol. Alexander Schweizer» in Chronik der Stadt Zürich, Zürich, 14. 3. 1908, S. 93; 62) E. Bähler, «Bilder aus dem alten Biel aus Tagebüchern und Familienpapieren» in Blätter für
bernische Geschichte, Kunst und Altertumskunde, Bern, August 1907, S. 214f; - 63) Oberrichter W. Schneeberger, «Die Frau als Lehrerin» in Berner Schulblatt, Bern, 9. 11. 1963, S. 571; - 64) A.
Jaggi, «Hundert Jahre deutsches Lehrerseminar des Kantons Bern» in Berner Schulblatt, Nr. 26, Bern, 1933, S. 319; 65) «Zum Tod von Fritz Blösch» in Berner Zeitung, Bern, 29. 12. 1887, S. 3; - 66)
Das «Eidgenössische Fabrikgesetzt» in Grütlianer, 8. 9. 1875, S. 2; - 67) «Schenkung Blösch» in Journal du Jura, Biel, 11. 1. 1888, S. 3; - 68) M, «Nekrolog Fritz Bloesch» in Tagblatt der Stadt
Biel, 30. 12. 1887, S. 4; - 69) «1. Schweizerische Strom-Fernübertragung» in Le bien public, 1. 4. 1884, S. 1
Postadresse: Altstadtleist Biel, Obergässli 11, 2502 Biel/Bienne. Lokal: Brunngasse 11, Tel. 032 323 42 84,
Öffnungszeiten auf Anfrage
Adresse postale: Guilde de la vieille ville, Ruelle du Haut 11, 2502 Biel/Bienne. Local: Rue des Fontaines 11, Tel: 032 323 42 84.
Heures d'ouverture sur demande.